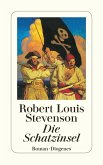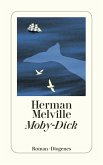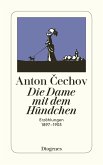Billy Budd ist ein junger Mann, der zur Zeit der Nore-Meuterei, 1797, in der British Royal Navy dient. Im Affekt erschlägt er einen Kumpan und wird zum Tod verurteilt. Der Richterspruch droht eine jener Meutereien auszulösen, denen er gerade hätte vorbeugen sollen. Es ist der Verurteilte selbst, der die Mannschaft beschwichtigt. Seine letzten Worte lauten: »Gott segne Kapitän Vere.«
»Er war der modernste unter den dreien - Poe, Hawthorne, Melville; er war auch der pessimistischste. Er hatte stets den Verdacht, daß etwas im Menschen korrupt bleiben würde.« Elio Vittorini

Herman Melvilles Erzählungen sind großartig und atemberaubend spannend. Jetzt liegt eine neue Übersetzung vor, die alle bisherigen weit übertrifft.
Von Wolfgang Schneider
Es gibt in der Weltliteratur wohl kaum einen anderen Erzählband, der mit einem ähnlich breiten Spektrum aufwarten kann wie Herman Melvilles "Piazza Tales", Kernstück des vorliegenden Bandes. Da haben wir eine der berühmtesten Novellen überhaupt, angesiedelt im babylonischen Ziegelofen New York, wo um 1850 die Moderne zu brodeln beginnt: die rätselhafte Geschichte des Lohnschreibers Bartleby mit seinem Ersten Hauptsatz der Verweigerungsdynamik: dem ebenso schlichten wie rätselhaften "Ich möchte lieber nicht". Er möchte lieber nicht ein menschliches Kopiergerät sein; eigentlich möchte er überhaupt nichts und bleibt dabei doch unverbindlich freundlich. Der Mensch ohne Willen ist eine Irritation für eine Gesellschaft, die zusammengehalten wird von den Ambitionen ihrer Mitglieder.
Es ist eine Geschichte, die man nach Kafka erst zu lesen gelernt hat, im Gegensatz zu den Zeitgenossen, die an den "Piazza Tales" vor allem die "Encantadas" geschätzt haben, eine düster-atmosphärische Episodenfolge über die Galapagos-Inseln, die Melville, anders als sein Zeitgenosse Darwin, als verworfene, metaphysisch unwirtliche, von Reptiliengezisch beherrschte Weltregion beschreibt. Eine danteske Vulkangestein-Einöde wird vors Leserauge gerückt, uralte Riesenschildkröten kriechen darin herum wie die verwunschenen Gefangenen einer Strafkolonie. Das stärkste Kapitel widmet sich der Robinsonade einer Frau - in Melvilles epischer Welt erwähnenswert genug. Bei der "einsamen, schiffbrüchigen Seele" Hunnila schimmert eine Wahlverwandtschaft mit Bartleby durch, und in einem beiläufigen Satz formuliert Melville eine ganze Poetik: "Wer nicht mitfühlt, der liest umsonst."
Dann gibt es eine Renaissance-Novelle über einen Turmbaumeister, Glockengießer und Automaten-Erfinder, der zu hoch hinaus will und am Ende von seinem eigenen Klöppler-Geschöpf erschlagen wird - die Geschichte einer Hybris, die etwas von Poe oder E.T.A. Hoffmann hat. An Kleist erinnert "Benito Cereno", die ungeheuerliche Erzählung über die Rebellion auf dem Sklavenschiff San Dominick. Hier hat Melville den auf den Bürgerkrieg zutreibenden Grundkonflikt der amerikanischen Gesellschaft verdichtet und moralisch aufrüttelnd dargestellt - eine atemberaubend spannende Lektüre mit Schreckensbildern von filmischer Intensität. Gleich anschließend lernt man den Autor als Satiriker kennen: In der Kurzgeschichte "Der Blitzableitermann" geht es um einen geschäftstüchtigen Handlungsreisenden, der den Menschen mit schauerlicher Dramatik die Gewitterfurcht einredet, auf dass sie ihm seine Ware abkaufen. Und als Zugabe folgt "Billy Budd", das postume Spätwerk, das erst 1924 aus einer verschlossenen Brotdose ans Licht der staunenden, gerade zur Melville-Wiederentdeckung ansetzenden literarischen Öffentlichkeit kam. "Oh, hätte ich das geschrieben ... ,Billy Budd' ist wirklich eine der schönsten Geschichten der Welt!" - so das Urteil Thomas Manns.
Die Grundthemen des Leidens und der Einsamkeit, des menschlichen Irrens und der Fehldeutung der Welt finden sich schon in der allegorischen Einleitungsgeschichte "Die Galerie" ("The Piazza"). Sie zeigt Melville stilistisch etwas überbordend, im Übergang zum Morgenland-Epos "Clarel". Von einem schrulligen Mann ist die Rede, der sich an sein Haus in den Berkshires eine Galerie anbauen lässt, ausgerechnet nach Norden. Dort geht er wie ein Kapitän auf Deck hin und her und wälzt Menschheitsgedanken. In der Ferne der reizvollen Hügellandschaft sieht er dabei immer ein Licht schimmern - wohl der Sonnenreflex auf dem Dach eines feenhaften Anwesens, und er wiegt sich in Träumereien über die Wesen, die dort wohnen. Eines Tages macht er sich auf den Weg dorthin. Und findet statt einer Fee in einer verfallenen Kate ein verängstigtes, deprimiert vor sich hin arbeitendes Waisenmädchen. Sie erzählt ihm, dass sie fern in der Ebene immer so ein wunderbares Licht in der Nacht blinken sehe und sich frage, welcher glückliche Mensch in dem herrlichen Haus dort wohl wohnen möge. Betroffen hütet sich der Wanderer, die Sache aufzuklären.
Es war die entscheidende Wende der literarischen Moderne, dass nicht mehr vordringlich auf das "Was", sondern vor allem auf das "Wie" des Erzählens geachtet wurde. Erst dadurch kamen auch die merkwürdig ambivalenten, zu Selbsttäuschungen aufgelegten Erzählerfiguren Melvilles in den Blick, sei es der Mann auf der Galerie, sei es der prätentiöse Jurist, der mit aller verfügbaren Selbstgefälligkeit die Geschichte von Bartleby mitteilt, oder sei es der vertrauensselige Kapitän Delano, aus dessen alle Zeichen missdeutender Sicht die düsteren Ereignisse in "Benito Cereno" geschildert werden - ein hochfaszinierendes Spiel mit der Erzählperspektive.
Delanos gutmütige Meinungen über die friedfertig-dienstwilligen "Neger" entsprechen der sentimentalen Menschenfreundlichkeit des drei Jahre zuvor veröffentlichten Anti-Sklaverei-Bestsellers "Onkel Toms Hütte". Sie werden vom Horror der Geschehnisse deutlich widerlegt. Babo, der Anführer der Rebellen, ist mit seiner perfiden Intelligenz das Gegenteil des "Onkel Tom" - eine Durchkreuzung rassistischer Klischees, die heute bisweilen selbst als politisch unkorrekt empfunden wird. Das belebt die Lektüre, zumal die Motivierung der Grausamkeiten nicht miterzählt werden muss: Sie findet im Senegal mit dem Brandeisen statt. Der Hallraum dieser Erzählung ist enorm. Carl Schmitt und sein Kreis fanden in ihr die beste Parabel auf die Nazi-Diktatur; "Jüngers ,Marmorklippen' verhielten sich dagegen wie eine Kitschpostkarte", schrieb Nicolaus Sombart. "Benito Cereno" lässt sich aber leicht auch auf heutige Geiselnahmen oder Entführungen übertragen. Mit Recht hat Melvilles Biograph Andrew Delbanco die Novelle deshalb als aktuellstes seiner Werke bezeichnet: "verzweifelte Menschen im Griff einer rachsüchtigen Wut, die von denen, gegen die sie sich richtet, nicht einmal ansatzweise verstanden wird".
Auch "Billy Budd" ist keine zeitentrückte Matrosengeschichte, sondern eingepasst in den historischen Hintergrund der Französischen Revolution, die auch die Autorität auf den Schiffen zu untergraben droht. Meuterei liegt in der Luft. So erscheint die geradezu rechtsphilosophisch ausgelotete Bordjustiz, die zu Billys Hinrichtung führt und zunächst wie schreiende Ungerechtigkeit wirkt, als Statuierung eines Exempels. Billy und sein schurkischer Widersacher, der an Shakespeares Jago erinnernde Waffenmeister Claggart, sind merkwürdige Komplementärgestalten; Claggart ist Billys finsterer Zwilling. "Frommer Glaube" und "Banditenraserei" lägen in der menschlichen Zwienatur meist dicht beieinander, hat Melville einmal geschrieben. Dieses Menschenbild, gleichermaßen fern von Illusionsbildung wie von Zynismus, prägt auch "Billy Budd", prägt all diese grandiosen Erzählungen.
Die ambitionierte, von gründlicher Melville-Gelehrsamkeit flankierte Neuübersetzung ist ebenso schön wie profund. Michael Walter und Daniel Göske übertreffen die bisherigen Übertragungen bei weitem. Gekonnt folgen sie Melville in alle sprachlichen Register, ins Spröde und Lyrisch-Erhabene, Ironische und Pathetische, Exakte und Ornamentale. Sie finden Entsprechungen für seinen Sprachwitz und seine mitunter tückische Grammatik, bewegen sich auch auf Augenhöhe, was das geographisch-seemännische Sachwissen und die Einsprengsel nautischer Fachsprache betrifft. Fein, dass "cat's paw" - gemeint ist damit eine leichte Kräuselung der See bei aufkommender Brise - nun zur wörtlichen Entsprechung "Katzenpfötchen" gefunden hat. Und mit welchem Genuss liest man jetzt die skurrilen, mit neuer Treffsicherheit wiedergegebenen Szenen aus der Wall Street - Bartlebys knurrige Kollegen Puter und Kneifzange bieten fulminante Büro-Comedy angesichts surrealer Arbeitsbedingungen. Groß ist der Unterschied vor allem zur klassizistisch polierten "Billy Budd"-Übersetzung von Richard Moering, die Thomas Manns Entzücken hervorrief und noch vor einem Jahr von Christian Brückner als Hörbuch eingelesen wurde. Der O-Ton dieses Alterswerks kommt sehr viel unausgeglichener und ungeschliffener daher.
Zu loben sind der konzentrierte Seitenkommentar und das ausführliche Nachwort, philologisch akkurat und leserfreundlich zugleich. Einen Schönheitsfehler hat aber auch dieses Buch: die Übersetzung seines berühmtesten Satzes. Gemeint ist die Bartleby-Formel "I would prefer not to". "Ich würde vorziehen, es nicht zu tun" oder "Eigentlich möchte ich nicht", lauten eingeführte Varianten; John und Peter von Düffel haben sich vor einigen Jahren für ein unakzeptables "Ich möchte bevorzugtermaßen nicht" entschieden. Hier nun heißt es: "Es ist mir nicht genehm." Das mag zwar dem etwas nasalen Klang und der dezenten Höflichkeit des Originals entsprechen. Trotzdem wirkt es sperrig und sehr Schriftdeutsch und kann nicht wirklich bestehen vor dem Anspruch, den die Übersetzer selbst formulieren: Der ostinate Satz sei eine "im Englischen durchaus gebräuchliche Wendung".
Vielleicht kommt eine Neuübersetzung nicht umhin, an so zentralem Punkt einen Neuvorschlag zu wagen. Trotzdem wäre es besser bei jenem mundgerechten Sechssilber geblieben, der seit der Installierung von Bartleby als Renitenz-Ikone der kapitalistischen Moderne auch hierzulande sprichwörtlich geworden ist: "Ich möchte lieber nicht." Punktum. Kein anderer Satz kann die merkwürdige Mischung von Sanftmut und Aufsässigkeit treffender ausdrücken.
Herman Melville: "Billy Budd". Die großen Erzählungen. Aus dem Englischen von Michael Walter und Daniel Göske. Hanser Verlag, München 2009. 569 S., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Keinen Zweifel lässt der Rezensent Wolfgang Schneider daran, dass hier eine der Inkunabeln der Literatur der Moderne in Neuübersetzung vorliegt. Gerade die Ambivalenzen der Erzählerfiguren von Hermann Melvilles Texten nämlich machten das für seine Zeitgenossen oft Unverständliche, jedenfalls Verstörende aus. Jede für sich geht Schneider die wichtigsten der in diesem Band versammelten Erzählungen durch und erklärt, dass trotz des verdientermaßen legendären Status von "Bartleby" die Rassismus-Klischee-Durchkreuzung des "Benito Cereno" diesen Text zum wohl "aktuellsten" des Bandes macht. Nur Lob und Preis hat Schneider für die den "ungeschliffeneren" Originalen ausgesprochen nahe kommenden Übersetzungen von Michael Walter und Daniel Göske. Mit einer, dann aber doch nicht ganz unwichtigen Ausnahme. Gerade der berühmteste aller Melville-Sätze, Bartlebys "I would prefer not to", gefällt ihm in der hergebrachten Fassung - "Ich möchte lieber nicht" - besser als im Neu-Übertragungs-Wagnis "Es ist mir nicht genehm."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH