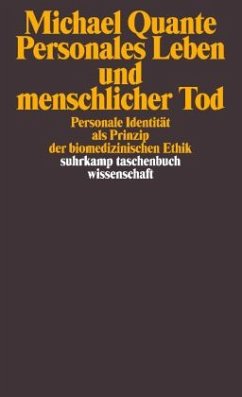Dieter Birnbacher
Broschiertes Buch
Bioethik zwischen Natur und Interesse
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!




Der Band versammelt die wichtigsten Arbeiten zur Bioethik eines der weltweit einflußreichsten Philosophen. Themen sind u. a. Naturschutz, Tiertötung, Suizidprävention, Stammzellenforschung.
Produktdetails
- suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1772
- Verlag: Suhrkamp
- Artikelnr. des Verlages: STW 1772
- 3. Aufl.
- Seitenzahl: 395
- Erscheinungstermin: April 2021
- Deutsch
- Abmessung: 177mm x 108mm x 19mm
- Gewicht: 314g
- ISBN-13: 9783518293720
- ISBN-10: 3518293729
- Artikelnr.: 14109676
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Scharf geht Rezensent Michael Pawlik mit den nun vorliegenden Aufsätzen des "bekennenden Utilitaristen" und Bioethikers Dieter Birnbacher ins Gericht. Vor allem Birnbachers Überlegungen zum Wert menschlicher Embryonen sowie seine Auseinandersetzung mit Autoren, die für einen umfassenden Lebensschutz argumentieren, fordern Pawlik heraus. Kritik übt er an der Auffassung des Autors, die subjektive Erlebnisfähigkeit eines Wesens sei Mindestbedingung für dessen Verletzbarkeit. Bei menschlichen Embryonen sehe der Autor das Kriterium der Subjektivität zumindest in der Frühphase nicht gegeben, weshalb wir ihnen gegenüber auch keine Pflichten hätten. Geradezu verärgert zeigt sich Pawlik darüber, dass sich Birnbacher "mit der Feder der Toleranz schmückt", wenn er auch den Empfindlichkeiten und Ängsten der Gegenseite einen Platz innerhalb der utilitaristischen Folgenabwägung zugesteht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»[Birnbacher] gibt eine anspruchsvolle Zusammenfassung seiner Positionen zu Fragen der Bioethik. Klarheit, Präzision und profundes Wissen fallen in allen Artikeln Birnbachers auf. Der Leser gewinnt einen fundierten Eindruck in die jeweilige Fragestellung, da Birnbacher zumeist den state of the art referiert, bevor er seine eigene Position darstellt.« Stefan Lorenz Sorgner Spektrum der Wissenschaft
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für