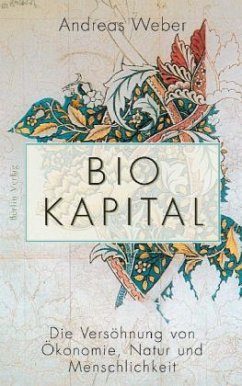Die Menschheit bedrückt eine Verkettung kaum lösbarer Probleme: der Verlust von klimatischer Stabilität und natürlicher Vielfalt; die Globalisierung und der Abgrund zwischen Arm und Reich - aber auch die Rastlosigkeit, Hektik und Sinnleere, unter denen gerade Bewohner wohlhabender Regionen leiden. Für Andreas Weber sind all diese Probleme auf eine einzige Ursache zurückzuführen: auf eine Wirtschaftsreligion, die alles dem Wachstum unterordnet und deren Grundgedanken in einem falschen Bild vom Leben und einer falschen Idee vom Menschen wurzeln. Boomender Wohlstand allein macht nicht glücklicher - Menschen begehren nicht nur Güter, sondern Zufriedenheit und Glück in der Gemeinschaft. Und weder in der Natur noch in der menschlichen Biologie ist ein ungebremster Wettkampf aller gegen alle die treibende Kraft. Weber beschreibt und fordert deshalb eine neue, ,ökologische Ökonomie , die mit der Natur wirtschaftet - nicht gegen sie. Gesundheit, seelische Zufriedenheit, ökologisches Gedeihen und eine dauerhafte, gerechte und auf die Zukunft hin angelegte Wirtschaft sind nach seiner Überzeugung überhaupt nur gemeinsam möglich - darin liegt der wahre Fortschritt. In seinem anschaulichen und klugen Buch stellt Weber Pioniere der realen Nachhaltigkeitswende vor, etwa den Ökonomen Robert Costanza, der als Erster den Gesamtwert aller Dienstleistungen des Planeten berechnet hat. Und er besucht Vorbild- Orte wie die Kleinstadt Varese in den ligurischen Bergen und ein verstecktes Alpental, die beide auf überschaubare Kreislaufwirtschaft setzen, mit grüner Wirtschaft hohe Renditen verzeichnen und überdurchschnittlich glücklichen Menschen Heimat sind.

Der Biologe Andreas Weber hält es mit Revolutionen. In seinem letzten Buch ging es um die "Revolution der Lebenswissenschaften", das nun erschienene skizziert eine "revolutionäre und existentiell neue Wirtschaft". In beiden Fällen verdankt sich das Revolutionäre der Überlegungen dem entschlossen geübten Verfahren, eine endlich greifbare Umwälzung unseres fundamental falschen Welt- und Selbstverständnisses vor Augen zu stellen.
Im früheren Buch diente dazu die Diagnose, nach der die Biologie eben erst entdeckt hätte, dass Organismen keine Maschinen oder Uhrwerke sind, die "aus sauber getrennten Bausteinen bestehen", ihre Individualentwicklung nicht der Umsetzung einer genetischen "militärischen Befehlskette" gleichkommt und sie auch nicht bloß starre Verhaltensprogramme abspulen. Schief war daran nur, dass es eine "auf das Gefühl als Zentrum des Lebens" basierte "schöpferische Ökologie" brauche, um diesen nicht eben neuen Einsichten gerecht zu werden.
Im neuen Buch geht es darum, dass sinnvolles ökonomisches Bilanzieren den Umgang mit natürlichen Ressourcen in Anschlag zu bringen hat, ökonomische Prozesse mit ökologischen eng zusammenhängen und der Zuwachs von Bruttosozialprodukten per se kein Indikator für eine mittel- bis langfristig sinnvolle Entwicklung ist. Auch das sind nicht gerade neue Erkenntnisse. Selbst wenn es eines ist, sie allgemein zu formulieren, und etwas anderes, aus ihnen konkrete Ansätze zum Wirtschaften in lokalen, nationalen oder globalen Kontexten zu entwickeln.
Auf solche Ansätze kommt Weber zwar immer wieder zu sprechen. Aber der Ton des Buches ist dabei auf die entschiedene Überhöhung der Leitideen gestimmt (Andreas Weber: "Biokapital". Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlichkeit. Berlin Verlag, Berlin 2008. 240 S., geb., 19,90 [Euro]). Aus dem Zusammenhang von Ökologie und Ökonomie wird in diesem Zeichen gleich "die Einheit der ökonomischen und ökologischen Kreisläufe". Denn um solche Einheit im Zeichen einer übergreifenden Natur geht es, mit der die "fühlende, schöpferische Produktivität des Lebendigen" zum Maßstab unseres Handelns werden soll. Auf diesem Weg winkt dann "inneres Gleichgewicht", "Gesundheit der Biosphäre", "seelische Gesundheit" und Heimat obendrein.
Die Notwendigkeit einer Aufwertung des Naturkapitals ist einzusehen. Dabei geht es um Preise, wenn es auch äußerst schwierig ist, für sie einen Markt zu fingieren, mit dem sich konkrete Zahlen plausibel machen lassen. Doch Weber möchte von den "bloßen" Preisen zu "objektiven" Werten kommen, die für alle Menschen, ja vielleicht für alle Lebewesen gelten. Diesen "Keim objektiver Werte" meint er in normativen Vorgaben einer florierenden Biosphäre finden zu können, in der "das Vielfältige oft das Schöne und das Schöne das Gute: das auch wirtschaftlich Nachhaltige ist".
Und als ob ein solches Zusammenklappen von Natur und Norm nicht schon deutlich genug formuliert wäre, kommt dann noch ein Wohlstand ins Spiel, "der sich nicht in Euro-Münzen misst, sondern in Glücksmomenten. In einem Gefühl der Heimkehr." Wer da ernsthaft Neigung verspüren sollte, sich auf die Glücksmomente des Autors verpflichten zu lassen und mit ihm heimzukehren, dem seien dessen Naturschilderungen als Vorschein solchen ökologisch grundierten Gelingens ans fühlende Herz gelegt: Wenn etwa "das blasse Silber der Dämmerung die knorrigen Eichen an den Teichen zu Skulpturen aus einem vergangenen Märchenland erstarren lässt" und "hinter den gekrümmten Eichenästen, eingewickelt in Dunkelheit, ungeahntes Leben schwillt".
Was da "als Spur von Wildnis unter der Oberfläche des Alltags" keimt, muss natürlich das andere einer letztlich bloß rechnenden Vernunft sein und hört auf die Namen Empfindung und Seele. Im Umkehrschluss gilt, dass Ökonomie wie Naturwissenschaft in unheilvoller Allianz bisher nur an der vollständigen Entzauberung der Natur im Allgemeinen und unserer eigenen im Besonderen gearbeitet haben. Das geht bei Weber ruck, zuck. Zuerst Darwin lesen, als ob es seine "Bulldogge" Huxley oder spätere Sozialdarwinisten wären, dann Richard Dawkins' "egoistische Gene" als unausweichliche Konsequenz hinstellen: überall bloß Konkurrenz, kalte Nutzenmaximierung und seelenlose Mechanik.
Mit Gewalt reißt es diesen Autor immer zum rhetorisch Nächstliegenden, das sich für seine Erweckungsrhetorik einspannen lässt. Ganz entzaubert muss die Welt sein, auf dass er uns mit der Aussicht beglücke, wieder zurück zur Seele zu finden. Weil es ja möglich ist, dass irgendwie alles mit allem versöhnt wird: Natur und Geist, Vernunft und Empfindung, Arbeit und Heimkehr. Darunter tut es dieser Autor nicht. Eine wohlwollende Kritikerin hat darin die Wiederkehr der Romantik sehen wollen. Die möchten wir aber Andreas Weber so wenig überlassen wie die Ökologie.
HELMUT MAYER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Weder was Romantik noch was Ökologie ist möchte Helmut Mayer sich von diesem Autor auseinandersetzen lassen. Zwar erkennt Mayer die Notwendigkeit, aus der Verbindung von Ökologie und Ökonomie konkrete Handlungsansätze zu entwickeln. Dies jedoch gelingt dem Autor gar nicht. Stattdessen sieht sich Mayer mit einer Überhöhung von Leitideen ins Objektive konfrontiert, die ihm bald gehörig auf die Nerven geht. Die von Andreas Weber angepeilten Glücksmomente hin oder her - des Autors gefühlige Naturschilderungen, das Gerede von Empfindung und Seele und der Generalverdacht gegen Ökonomie und Naturwissenschaft lassen den Rezensenten davonlaufen vor dieser "Erweckungsrhetorik".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH