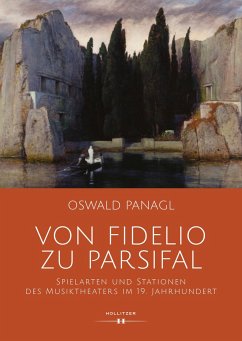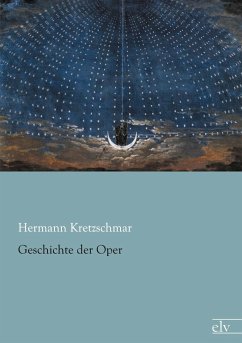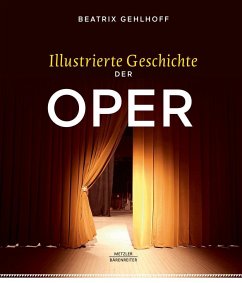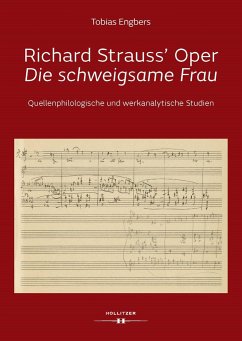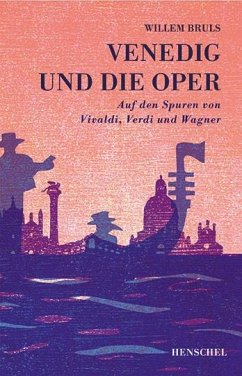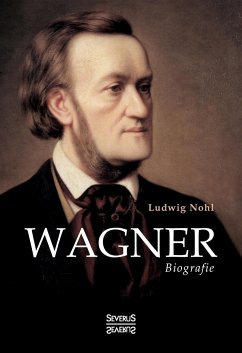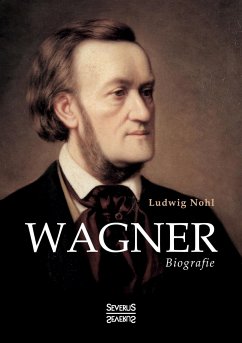Bis der reitende Bote des Königs erscheint
Über Oper und Literatur

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ein Streifzug durch die Operngeschichte und das Wechselspiel zwischen Text und Musik - so unterhaltsam wie anregend.Nur selten in der Operngeschichte gab es glückliche Partnerschaften zwischen den Komponisten und ihren Textdichtern. So tauchen auf Verdis 27 Opernpartituren die Namen von vierzehn Librettisten auf. Der Wettstreit um den Vorrang von Ton oder Wort durchzieht die gesamte Geschichte der Oper. Im 18. Jahrhundert übte Pietro Metastasio seine uneingeschränkte Herrschaft aus - Kesting nennt ihn »den einflussreichsten Operndichter der Geschichte«. Seine Textbücher wurden an die tau...
Ein Streifzug durch die Operngeschichte und das Wechselspiel zwischen Text und Musik - so unterhaltsam wie anregend.Nur selten in der Operngeschichte gab es glückliche Partnerschaften zwischen den Komponisten und ihren Textdichtern. So tauchen auf Verdis 27 Opernpartituren die Namen von vierzehn Librettisten auf. Der Wettstreit um den Vorrang von Ton oder Wort durchzieht die gesamte Geschichte der Oper. Im 18. Jahrhundert übte Pietro Metastasio seine uneingeschränkte Herrschaft aus - Kesting nennt ihn »den einflussreichsten Operndichter der Geschichte«. Seine Textbücher wurden an die tausendmal vertont, auch noch von Mozart, der eigentlich die Auffassung vertrat, in der Oper habe die Poesie »der Musick gehorsame Tochter« zu sein, und in Lorenzo Da Ponte seinen einzigartigen Librettisten fand. Das 19. Jahrhundert brachte Textdichter wie Eugène Scribe, Felice Romani und Arrigo Boito hervor, nicht zuletzt den Sonderfall Richard Wagner, der sein eigener Textdichter war. Im 20. Jahrhundert stellten sich Autoren von Rang wie Hugo von Hofmannsthal, Stefan Zweig, Jean Cocteau und W. H. Auden in den Dienst der Komponisten. Bertolt Brecht, auch er ein fleißiger Textlieferant für das Musiktheater, ließ in der »Dreigroschenoper« zum Schluss den reitenden Boten des Königs erscheinen: »Damit ihr wenigstens in der Oper seht, wie einmal Gnade vor Recht ergeht.«