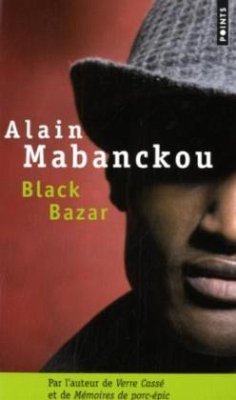Der Erzähler, ursprünglich aus dem Kongo, lebt seit mehr als fünfzehn Jahren in Paris. Als ihn seine Lebensgefährtin verlässt, beginnt er das Jips, eine Bar im ersten Bezirk, zu frequentieren. Er begegnet dort Menschen, die ihm seine literarische Begabung bewusst machen. Ermutigt macht er sich daran, die Verrücktheiten der Welt, die ihn umgibt, in einer Mischung aus Sarkasmus und Komik zu Papier zu bringen.

Hallo, Yves Saint-Laurent! Hallo Yves-der-Ivorer! Mit dem Romanautor Alain Mabanckou im Schwarzenviertel Goutte d’Or in Paris
Kurz vor der Verabschiedung kommt mir für einen Moment der Verdacht, ob das hier alles inszeniert ist. Erst die zwei Studenten, die uns auf offener Straße anhalten, den Roman in der Hand, und um eine Widmung bitten. Dann der Laienprediger aus dem Kongo, der sagt, er bete täglich für Alain Mabanckou, „weil Sie unsere Sache vertreten.” Zehn Meter weiter stürzt dann noch eine Frau über die Straße, sie quiekt seinen Namen, „Alain Mabanckouuu! Alain Mabanckouuuu!” und wirft sich ihm an den Hals, als kenne sie ihn seit Jahren. In ihrer anschmiegsamen Begeisterung hat diese junge Schwarze etwas Gallertartiges, so als werde sie nur noch durch ihre Kleider zusammengehalten und würde am liebsten hier vor ihm auf dem Trottoir zerfließen.
Alain Mabanckou, der den einstündigen Spaziergang durch die Nebenstraßen von Goutte d’Or und durch seinen eigenen Schriftstellerruhm bislang sichtlich genossen hat, ist nun doch peinlich berührt, er gibt der Frau schnell ein Autogramm, während sie sagt: „Was Sie alles für die Négritude getan haben . . . Sie sind unser Obama.”
La Goutte d’Or. Goldtropfen. Schäbige Viertel haben oft klingende Namen. Man ist hier nur einen Kilometer entfernt vom Montmartre, dem touristischen Epizentrum Frankreichs, in dem noch immer das Postkartenidyll mit akkordeonspielenden Clowns verkauft wird. Hier hingegen verkaufen schwarze Frauen aus kleinen rostigen Eimern irgendwelche schrumpeligen Früchte, die man in keinem französischen Supermarkt bekäme. Jeder zweite Laden bietet Hautaufhellungsprodukte, und wäre da nicht die Pariser Architektur, man könnte glauben, man befinde sich in einem schwarzafrikanischen Land. Mabanckou steckt einer alten Verkäuferin, die er zu kennen scheint, 20 Euro zu und sagt: „Schwarze Leute, schwarzes Essen, schwarze Läden, nur dass die Häuser leider alle den Chinesen gehören. – Schauen Sie, der da,” unterbricht er sich selber, „noch so ein Farbflüchtling”.
Vor uns läuft ein junger Mann, der ein vernarbtes, dunkles Gesicht mit hellen Flecken hat. Mabanckou zeigt alle paar Meter auf Passanten mit solchen Pigmentinseln in der Haut, Leute, die die aggressiven Chemikalien benutzt haben, mit denen man angeblich weißer wird. Setzt man die Mittel ab, wird die Haut oft dunkler als zuvor. „Pauvre peau”, murmelt Mabanckou, „arme Haut”.
Wunderbar. Pauvre peau. Das wäre ein guter Titel gewesen für „Black Bazar” den Roman, mit dem Mabanckou im vergangenen Jahr in Frankreich für Furore sorgte und der soeben auf deutsch erschienen ist (Alain Mabanckou: Black Bazar. Aus dem Französischen von Andreas Münzner. Libeskind Verlagsbuchhandlung, München 2010. 271 S., 19,80 Euro). Pauvre peau. Das ist das Thema dieses Romans, eines Buchs, das, um mal eine dieser verlegerischen Marketingphrasen umzuformulieren, über die Haut geht.
Erzählt wird es von einem namenlosen Mann aus dem Kongo, der in einer Pariser Bar hockt und die „B-Seiten” der vorbeiflanierenden Frauen taxiert. Er hat einen derart fachmännischen Blick entwickelt, dass ihn seine Freunde Arschologen nennen, was plumper, breiter, derber klingt als der „Fessologue” im Original. Seine Theorie: Man kann vom Hintern einer Frau auf ihren Charakter schließen, eine Theorie, die zumindest bei seiner eigenen Frau nicht gestimmt zu haben scheint: Er verfiel ihrem Hintern, „denn er schwang im Gegenuhrzeigersinn”, sie aber ließ ihn schnell sitzen, mit einem Bongospieler. Alles, was ihm geblieben ist, sind seine teuren Markenklamotten.
Alain Mabanckou einen modebewusten Autor zu nennen, wäre untertrieben. Auf jedem Foto trägt er ein anderes auffälliges Outfit. An diesem Tag hat er nicht ganz die flamboyante Aura, die ihn auf den Fotos umglänzt und die auch seinem Helden so wichtig ist. Braune Strickjacke, Ballonmütze, alte Weston-Schuhe – für einen bekennenden Sapeur fast schon Understatement. Sape, das ist die Abkürzung für „Société des Ambianceurs et des Personnes élégantes”, eine Mode, die in den sechziger Jahren in Kongo aufkam. Rückkehrer brachten dandyeske Dreiteiler und Zweireiher mit in die Heimat, die zeigen sollten, dass sie es in Europa zu etwas gebracht hatten.
Mabanckou wurde 1966 in der Republik Kongo geboren, der unauffälligen Nachbarrepublik des riesigen Nachrichtenschreckenkongos, aus dem täglich the horror, the horror vermeldet wird. „Das ist eine meiner intensivsten Kindheitserinnerungen: Die Rückkehrer, die in schillernden Anzügen durch die Straßen defilierten, um bewundert zu werden. Wir wussten, dass das alles nur Bluff war und haben sie trotzdem bewundert.”
Der Held in „Black Bazar” kann seitenlang über den genauen Ton eines grünen Yves-Saint-Laurent-Sakkos dozieren. Vielleicht, so schwant einem nach den ersten Kapiteln, vielleicht kleidet er sich nur deshalb so knallbunt, weil er die eigene Hautfarbe übertönen will. Weil er hofft, dass eben doch nicht diese Farbe einen Menschen definiert, sondern das, was er anhat. Dass man sich in der Fremde komplett neu erfinden kann. Dass das nicht klappt, sieht man schon daran, dass der Erzähler selbst jeden hartnäckig nach seiner Herkunft katalogisiert: Die Figuren in „Black Bazar” heißen Yves-der-Ivorer-schlechthin, Vladimir-der-Kameruner oder Bosco-der-Streuner-aus-dem-Tschad. Mabanckou orchestriert den selbstgerecht-frustrierten Opferdiskurs der Zukurzgekommenen, das patriotische Gerede der Überassimilierten, die abgestandenen Machosprüche des Erzählers zu einem dissonanten Chor der Exilanten, die sich die Klischees derart deftig gegenseitig um die Ohren hauen, dass man sich beim verbalen Mudwrestling wähnt. „In welcher Welt leben wir eigentlich, wenn die Leute ständig die kleinen Gewissheiten zerstören, die unsere Vorurteile festigen”, fragt der Erzähler einmal.
Yves-der-Ivorer, Vladimir-der-Kameruner: Die Figuren ziehen diese Anhängsel so hartnäckig durch den Text wie ihre Farbe, der sie nicht entkommen, auch wenn sie noch so überassimiliert daherreden: Es gibt da einen Nachbarn des Erzählers, der ihn mit kleinkariertem Hausmeisterhass verfolgt, ihm hinter der Wohnungstür auflauert und ihn unflätig beschimpft. „Blöder Kongolese! Geh zurück nach Hause!” Erst nach vielen Seiten wird en passant erwähnt, dass dieser Nachbar selbst ein Schwarzer von den Antillen ist. So strampeln sich all die Schwarzen in „Black Bazar” ab, keine Schwarzen mehr zu sein oder zumindest etwas heller als die anderen. „Solche wie den Hausmeister gibt es haufenweise, die sind schärfer als die Einpeitscher vom Front National”, sagt Mabanckou und nimmt auf dem Markt eine weiße Frucht in die Hand. „Die muss man gut würzen und im eigenen Sud kochen. Dann schmeckt das wunderbar leicht.”
Gut würzen. Wunderbar leicht: Genau das ist Mabanckou in seinem Roman gelungen. Es geht darin um Immigration und Identität, um Vorurteile und den Binnenrassismus der Schwarzen untereinander. Das klingt tonnenschwer, zumal Frantz Fanon, Pap Ndiaye, Aimé Césaire durch die Kulissen dieser Burleske geistern. Aber der Kolonialismus- und Identitätsdiskurs ist so gut eingearbeitet in das schnoddrig-selbstgerechte Gerede seines Helden, dass er nie belehrend wirkt.
Mabanckou wird auf der Straße von einem Café-Besitzer erkannt und auf einen Espresso eingeladen. Der Laden ist leer, nur in einem Eck sitzen drei Sapeurs, makellos rausgeputzt, aber sturzbetrunken, und singen windschiefe Lieder. Ein elender Anblick. „Ich kenn’ das Lied”, sagt Mabanckou, „ist aus Brazzaville. Heimweh, Schmerz, die ganze Palette.” Er trinkt seinen Espresso auf Ex, als sei er wütend, und sagt: „Wenn ein schwarzer Amerikaner leidet, muss er etwas an den Verhältnissen in Amerika ändern, er hat keinen anderen Ort, an den er gehen kann. Wenn einer von uns leidet, sagt er sich, bevor es zu schlimm wird, gehe ich zurück nach Kamerun oder Ghana. Was sie nicht tun. Durch diesen Selbstbetrug kämpfen sie nicht um einen Platz in dieser Gesellschaft, sondern leben auf ewig in between.” Mabanckou wechselt während des Gesprächs oft ins Englische, er unterrichtet seit Jahren in L. A. an der UCLA, pendelt zwischen Paris, Kalifornien und seinem Geburtsort Pointe-Noire. Als was sieht er sich? Als Franzose? Als Kongolese? Als frankophoner Autor? „Als Kongolese, der französische Bücher schreibt. Aber bestimmt keine frankophonen.”
Frankophone Literatur, noch so ein feiner Unterschied, die politisch korrekte Formulierung dafür, dass ein Buch nicht in Frankreich geschrieben wurde, sondern in einer ehemaligen Kolonie. „An dem Tag, an dem es in Le Monde nicht mehr heißt, dieser oder jener Afrikaner sei der schwarze Céline, sondern erstmals, dass Stéphane Audeguy der neue Kourouma ist, lade ich ganz Paris auf ein Bier ein”. Dann muss er los, eine Fernsehdebatte, Integration, Immigration. „Es geht um die Schwarzen. Als Delinquenten, als Räuber. Als schwarzer Block. Und ich bin die frankophone Quote”, sagt Alain-der-Kongolese-mit-dem-grimmen-Humor. ALEX RÜHLE
Setzt man die Aufheller ab, wird die Haut oft dunkler, als sie war
Gut würzen. Wunderbar leicht. Das ist in diesem Roman gelungen.
Alain Mabanckou Foto: Getty Images
Sapeurs, so nennt man die Mitglieder der Sape, der „Société des Ambianceurs et des Personnes élégantes”, die in den siebziger Jahren in der Republik Kongo entstand. Das Ganze war halb Statusangeberei, halb politische Provokation, schließlich schrieb Mobutu im benachbarten Zaire dogmatisch antikoloniale Einheitskleidung vor. Mittlerweile ist die Mode längst nach Frankreich rübergeschwappt, wo sich die Schwarzen in den Banlieues großartig farbenfrohe Wettbewerbe liefern. Der Erzähler aus Alain Mabanckous Roman ist selbst bekennender Sapeur und kleidet sich dementsprechend schillernd. Foto: Hector Mediavilla/Picturetank/Agentur Focus
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de