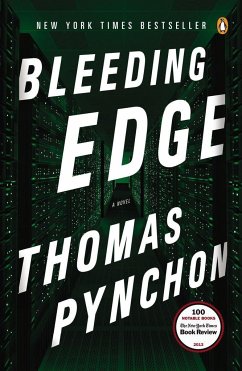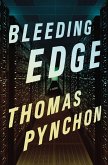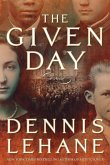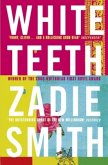A New York Times besteller!
It is 2001 in New York City, in the lull between the collapse of the dot-com boom and the terrible events of September 11th. Silicon Alley is a ghost town, Web 1.0 is having adolescent angst, Google has yet to IPO, Microsoft is still considered the Evil Empire. There may not be quite as much money around as there was at the height of the tech bubble, but there s no shortage of swindlers looking to grab a piece of what s left.
Maxine Tarnow is running a nice little fraud investigation business on the Upper West Side, chasing down different kinds of small-scale con artists. She used to be legally certified but her license got pulled a while back, which has actually turned out to be a blessing because now she can follow her own code of ethics carry a Beretta, do business with sleazebags, hack into people s bank accounts without having too much guilt about any of it. Otherwise, just your average working mom two boys in elementary school, an off-and-on situation with her sort of semi-ex-husband Horst, life as normal as it ever gets in the neighborhood till Maxine starts looking into the finances of a computer-security firm and its billionaire geek CEO, whereupon things begin rapidly to jam onto the subway and head downtown. She soon finds herself mixed up with a drug runner in an art deco motorboat, a professional nose obsessed with Hitler s aftershave, a neoliberal enforcer with footwear issues, plus elements of the Russian mob and various bloggers, hackers, code monkeys, and entrepreneurs, some of whom begin to show up mysteriously dead. Foul play, of course.
With occasional excursions into the DeepWeb and out to Long Island, Thomas Pynchon, channeling his inner Jewish mother, brings us a historical romance of New York in the early days of the internet, not that distant in calendar time but galactically remote from where we ve journeyed to since.
Will perpetrators be revealed, forget about brought to justice? Will Maxine have to take the handgun out of her purse? Will she and Horst get back together? Will Jerry Seinfeld make an unscheduled guest appearance? Will accounts secular and karmic be brought into balance?
Hey. Who wants to know?
The Washington Post
Brilliantly written a joy to read Bleeding Edge is totally gonzo, totally wonderful. It really is good to have Thomas Pynchon around, doing what he does best. (Michael Dirda)
Slate.com
"If not here at the end of history, when? If not Pynchon, who? Reading Bleeding Edge, tearing up at the beauty of its sadness or the punches of its hilarity, you may realize it as the 9/11 novel you never knew you needed a necessary novel and one that literary history has been waiting for."
The New York Times Book Review
Exemplary dazzling and ludicrous... Our reward for surrendering expectations that a novel should gather in clarity, rather than disperse into molecules, isn t anomie but delight. (Jonathan Lethem)
Wired magazine
The book s real accomplishment is to claim the last decade as Pynchon territory, a continuation of the same tensions between freedom and captivity, momentum and entropy, meaning and chaos through which he has framed the last half-century."
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
It is 2001 in New York City, in the lull between the collapse of the dot-com boom and the terrible events of September 11th. Silicon Alley is a ghost town, Web 1.0 is having adolescent angst, Google has yet to IPO, Microsoft is still considered the Evil Empire. There may not be quite as much money around as there was at the height of the tech bubble, but there s no shortage of swindlers looking to grab a piece of what s left.
Maxine Tarnow is running a nice little fraud investigation business on the Upper West Side, chasing down different kinds of small-scale con artists. She used to be legally certified but her license got pulled a while back, which has actually turned out to be a blessing because now she can follow her own code of ethics carry a Beretta, do business with sleazebags, hack into people s bank accounts without having too much guilt about any of it. Otherwise, just your average working mom two boys in elementary school, an off-and-on situation with her sort of semi-ex-husband Horst, life as normal as it ever gets in the neighborhood till Maxine starts looking into the finances of a computer-security firm and its billionaire geek CEO, whereupon things begin rapidly to jam onto the subway and head downtown. She soon finds herself mixed up with a drug runner in an art deco motorboat, a professional nose obsessed with Hitler s aftershave, a neoliberal enforcer with footwear issues, plus elements of the Russian mob and various bloggers, hackers, code monkeys, and entrepreneurs, some of whom begin to show up mysteriously dead. Foul play, of course.
With occasional excursions into the DeepWeb and out to Long Island, Thomas Pynchon, channeling his inner Jewish mother, brings us a historical romance of New York in the early days of the internet, not that distant in calendar time but galactically remote from where we ve journeyed to since.
Will perpetrators be revealed, forget about brought to justice? Will Maxine have to take the handgun out of her purse? Will she and Horst get back together? Will Jerry Seinfeld make an unscheduled guest appearance? Will accounts secular and karmic be brought into balance?
Hey. Who wants to know?
The Washington Post
Brilliantly written a joy to read Bleeding Edge is totally gonzo, totally wonderful. It really is good to have Thomas Pynchon around, doing what he does best. (Michael Dirda)
Slate.com
"If not here at the end of history, when? If not Pynchon, who? Reading Bleeding Edge, tearing up at the beauty of its sadness or the punches of its hilarity, you may realize it as the 9/11 novel you never knew you needed a necessary novel and one that literary history has been waiting for."
The New York Times Book Review
Exemplary dazzling and ludicrous... Our reward for surrendering expectations that a novel should gather in clarity, rather than disperse into molecules, isn t anomie but delight. (Jonathan Lethem)
Wired magazine
The book s real accomplishment is to claim the last decade as Pynchon territory, a continuation of the same tensions between freedom and captivity, momentum and entropy, meaning and chaos through which he has framed the last half-century."
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Eine Legende lebt literarisch wieder auf: Thomas Pynchon rekonstruiert in seinem Roman "Bleeding Edge" die vergangene Zukunft des Internets.
Von Peter Körte
Auch Phantome können zu real werden. Nicht weil er 2004 in den "Simpsons" aufgetreten ist, mit einer Papiertüte über dem Kopf, auch nicht, weil seit Jahren ein unscharfes Straßenbild von ihm aus New York existiert, nicht wegen abnehmender Unsichtbarkeit seines Autors löst ein neuer Roman von Thomas Pynchon kaum noch jenes große Raunen aus, das ihn früher ankündigte. Das hat mit den Romanen selbst zu tun, vor allem aber mit der Welt, aus der und in die sie kommen. In Zeiten von Big Data, von Wikileaks und Whistleblowern ist aus wilden Verschwörungstheorien von gestern immer häufiger die nüchterne Agenturmeldung von heute geworden.
Weil er aber nun mal dieses unheimliche seismographische Gespür besitzt, diesen Blick für die irrwitzigen Querverbindungen unserer Welt, ist Thomas Pynchon zuletzt ein wenig ausgewichen, ins Genre des Kriminalromans, ins verkiffte Kalifornien der siebziger Jahre ("Natürliche Mängel", 2010) oder ins frühe zwanzigste Jahrhundert wie in "Gegen den Tag" (2006). Auch wenn er sich jetzt mit "Bleeding Edge" wieder der Gegenwart nähert, hält er sich im Windschatten der Zeitgeschichte. Der Roman beginnt zwar im Frühjahr 2001 in New York und endet dort ein knappes Jahr später, aber als 9/11-Roman lässt er sich nur mit einiger Willkür begreifen.
Auch diesmal treibt Pynchon ein Vexierspiel mit Motiven des Kriminalromans. Es gibt eine einsame Ermittlerin, mysteriöse Gestalten, Leichen und ein schwer durchschaubares Netzwerk des Bösen, dessen konspirativer Radius aber überschaubar bleibt. Maxine Tarnow, Betrugsermittlerin und Inhaberin der Agentur "Ertappt - geschnappt", ist geschieden, hat zwei Söhne und ist so etwas wie eine Eingeborene von Manhattans Upper West Side. Ein Bekannter, der leicht durchgedrehte Filmemacher Reg Despard, bringt sie auf die Spur einer Firma namens "hashslingrz", die als eine der wenigen das Platzen der Dotcomblase unbeschadet überlebt hat. Maxine entdeckt finanzielle Unregelmäßigkeiten, dubioses Geschäftsgebaren, den sinistren Chef Gabriel Ice und dazu viele getriebene, verängstigte, verärgerte IT-Existenzen aus der Reservearmee der arbeitslos gewordenen Nerds.
Pynchon hat natürlich auch noch immer die Gabe, bizarre Orte und Szenen zu entdecken, zu erfinden oder in surrealistischer Manier Dinge nebeneinander zu stellen, bis es wirkt wie "das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch". Die Namen der Figuren haben diesen leicht irren Klang, werden auf einmal im Deutschen lautmalerisch; wenn man etwa "Vyrva" nur oft genug ausspricht, wird es wirklich wirr. Und den "freiberuflichen Riecher" Conkling Speedwell, der besessen ist von der Frage nach Hitlers Aftershave, wird man so wenig vergessen wie die beiden Russenmafia-Gehilfen Mischa und Grischa, die sich an Halloween 2001 als Bin Ladin verkleiden.
Von solchen kleinen Leuchtfeuern abgesehen, mäandert der Roman jedoch vor sich hin. Die Ermittlungen verlaufen schleppend, ein ominöser Nick Windust taucht auf, der allen Geheimdiensten angehören könnte - oder auch keinem. Große Fragezeichen springen wie im Pop-up-Buch aus dem Text, wenn Maxines Ex-Mann Horst Loeffler zwei Tage vor den Anschlägen auffällt, dass an der Börse auf den Fall von United-Airlines- und American-Airlines-Aktien spekuliert wird. Oder wenn Maxine ein Video vom Dach eines Hauses in Manhattan zugespielt wird, das Männer mit Stinger-Raketen zeigt, die eine Boeing am Himmel anvisieren.
Mehr als solche Andeutungen gibt es nicht, weil Pynchon viel zu klug und sein Erzählen viel zu verspielt ist, um das Dotcom-Szenario per Hyperlink mit den Ereignissen von 9/11 zu verknüpfen. Und er vermeidet es zum Glück, wie ein zu spät gekommener Reporter von New York am 11. September 2001 und in den Tagen danach zu berichten.
Es geht in diesem Buch um etwas ganz anderes, das Pynchon-Lesern vertraut ist. Angetrieben von einem tiefsitzenden anarchischen Impuls, interessiert sich Pynchon für Welten und Zustände, in denen sich noch keine neue Ordnung formiert hat, wo der Möglichkeitshorizont weit ist und der Erwartungsüberschuss groß. Was in "Gegen den Tag" die Welt des frühen zwanzigsten Jahrhunderts war, in der vor dem Triumph von Quantenphysik und Relativitätstheorie Wissenschaft, Spekulation und Obskurantismus koexistierten; was in "Mason & Dixon" (1998) die Ungeschiedenheit der vielfältigen Wissens- und Weltmodelle des achtzehnten Jahrhunderts war, vor dem Monolog der Vernunft, das sind in "Bleeding Edge" die stürmischen Jahre des Internets.
Der Titel "Bleeding Edge" ist ein Wegweiser: der Begriff für eine Technologie, die brandneu ist, völlig unerprobt und daher höchst riskant. Pynchon lokalisiert sie in den Tiefen des Webs, wo keine Suchmaschine hinreicht. "DeepArcher" heißt eine virtuelle Welt (entfernt vergleichbar mit "Second Life"), von der ihre beiden Erfinder sagen, sie solle "ein riesiges Motel für die Geplagten" sein, eine "Zuflucht". Man könnte auch sagen, sie sei ein Unort oder gleichfalls: eine Utopie. Frei von Kontrolle und Hierarchien, noch nicht modelliert nach den Gesetzen von Big Data und des Cyberkapitalismus - wie "ein unsichtbarer, sich selbst verschlüsselnder Pfad, der nicht zurückverfolgt werden kann".
So imaginiert Pynchon in der Unordnung nach der geplatzten Dotcom-Blase den historischen Ort, an dem das Internet eine Zukunft gehabt hätte, die anders ausgefallen wäre als die real gewordene. Das mag eine - historisch unvermeidliche - Illusion gewesen sein oder nur eine Rückprojektion. In jedem Fall steckt darin eine säkulare Erlösungsphantasie. Der Sündenfall des Netzes, so drückt es Maxines Vater aus, sei dessen Herkunft aus dem militärischen Komplex des Kalten Kriegs. Und einer der IT-Zauberer sagt, mit dem Internet sei es jetzt sowieso vorbei: ",Man spielt mit uns, Maxi, aber die Karten sind gezinkt, und das Spiel ist erst vorbei, wenn das Internet - das echte, der Traum, das Versprechen - zerstört ist."
Da spricht natürlich der alte Maschinenstürmer Thomas Pynchon, der vor dreißig Jahren in einem Essay die Frage bejahte: "Is it OK to be a Luddite?"
Zu diesem Gestus passt sehr gut die Rolle des Sammlers, der in "Bleeding Edge" unermüdlich Material aus Werbeslogans, Supermarktflyern, Hiphop-Songs, IT-Slang, Fernsehserien und Filmen jener Jahre aufliest und ausbreitet; lauter Anspielungen und Zitate, von denen Evgeny Morozov gesagt hat, in zwanzig Jahren werde man wohl eine App brauchen, um sie noch entziffern zu können.
Diese Haltung ist nicht unsympathisch, sie ist auch nicht uninteressant - aber sie ist als Begleiterin auf mehr als sechshundert Seiten ziemlich ermüdend. Denn unter der popkulturellen Überfülle hört man ein wenig zu monoton jenen romantischen Refrain, den man spätestens seit "Mason & Dixon" kennt. Er klingt wie der berühmte Satz des jungen Brecht: "Das Chaos ist aufgebraucht. Es war die beste Zeit."
Thomas Pynchon: "Bleeding Edge". Roman.
Aus dem Englischen von Dirk von Gunsteren.
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2014. 608 S., geb., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Thomas Pynchon, America's greatest novelist, has written the greatest novel about the most significant events in his country's 21st century history. It is unequivocally a masterpiece. Stuart Kelly Scotsman