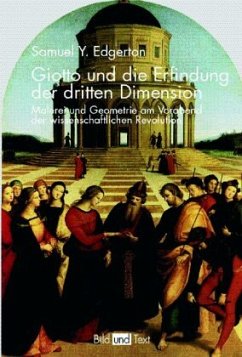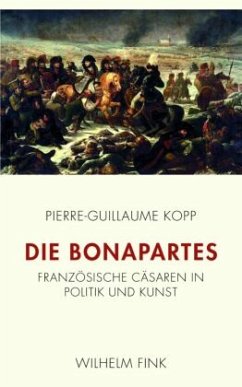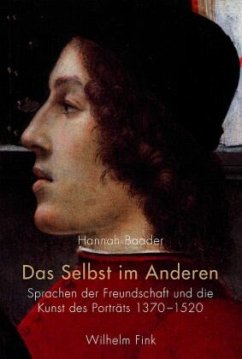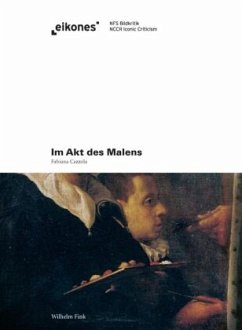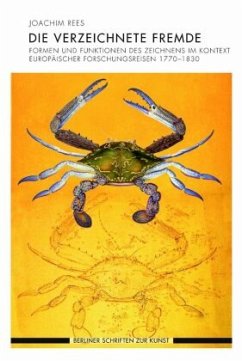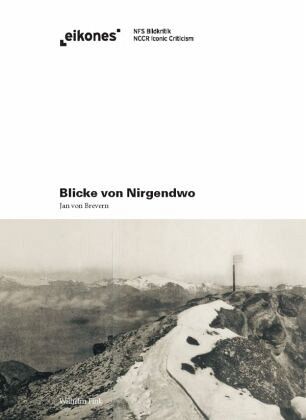
Blicke von Nirgendwo
Geologie in Bildern bei Ruskin, Viollet-le-Duc und Civiale
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
72,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wer zeichne, so Eugène Viollet-le-Duc, der lerne zu sehen - »und Sehen ist Wissen«. Für die Geologie, die sich um 1850 in einer Theoriekrise befindet, leitet sich daraus ein Versprechen ab: Die Produktion neuer Bilder würde helfen, endlich die großen erdgeschichtlichen Fragen zu lösen. Der Zeichnung kommt hierbei eine wichtige Funktion zu. Doch die größten Hoffnungen konzentrieren sich auf ein junges Medium, dessen Potentiale noch kaum abschätzbar erscheinen - die Fotografie. In sechs Kapiteln fächert Jan von Brevern die historischen, technischen und ästhetischen Bedingungen geolog...
Wer zeichne, so Eugène Viollet-le-Duc, der lerne zu sehen - »und Sehen ist Wissen«. Für die Geologie, die sich um 1850 in einer Theoriekrise befindet, leitet sich daraus ein Versprechen ab: Die Produktion neuer Bilder würde helfen, endlich die großen erdgeschichtlichen Fragen zu lösen. Der Zeichnung kommt hierbei eine wichtige Funktion zu. Doch die größten Hoffnungen konzentrieren sich auf ein junges Medium, dessen Potentiale noch kaum abschätzbar erscheinen - die Fotografie. In sechs Kapiteln fächert Jan von Brevern die historischen, technischen und ästhetischen Bedingungen geologischer Bilder im 19. Jahrhundert auf. Im Zentrum stehen dabei die »Bildexperten« John Ruskin, Eugène Viollet-le-Duc und Aimé Civiale. Auf ihren Skizzen und Fotografien, so die Überzeugung, wurde etwas sichtbar, das dem bloßen Auge verborgen blieb. Was man Bildern alles zutraute, aber auch, wie mit ihnen gearbeitet werden musste, damit sich die Erwartungen erfüllten: davon handelt »Blicke von Nirgendwo«.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.