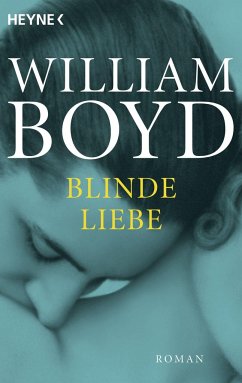Ein Mann, dessen Herz sich nicht umstimmen lässt. Eine Liebe, die von Paris über St. Petersburg bis ans Ende der Welt führt.
Brodie Moncur hat das absolute Gehör und gilt als Genie unter den Klavierstimmern. Als er in Paris dem grandiosen Pianisten John Kilbarron begegnet, nimmt sein Leben eine dramatische Wendung. Rasch zeigt sich, dass Brodies Künste unverzichtbar für Kilbarron sind. Gemeinsam feiern sie Triumphe in ganz Europa, führen in St. Petersburg ein luxuriöses Leben, das Brodie, aufgewachsen in einem schottischen Dorf als Sohn eines tyrannischen Pfarrers, sich nie hätte erträumen lassen. Und doch ist das alles für Brodie unwichtig. Denn der wahre Grund, weshalb er in die Dienste des genialen, aber unberechenbaren Pianisten eingetreten ist, ist dessen Geliebte, die russische Sopranistin Lika.
Brodie weiß, dass diese Liebe unmöglich ist, und setzt doch alles für sie aufs Spiel - auch sein eigenes Leben. Denn der Klavierstimmer, der mit wenigen Handgriffen über Erfolg oder Misserfolg eines Konzerts, ja einer Pianistenkarriere entscheiden kann, folgt seinem Herzen, das sich nicht umstimmen lässt.
Brodie Moncur hat das absolute Gehör und gilt als Genie unter den Klavierstimmern. Als er in Paris dem grandiosen Pianisten John Kilbarron begegnet, nimmt sein Leben eine dramatische Wendung. Rasch zeigt sich, dass Brodies Künste unverzichtbar für Kilbarron sind. Gemeinsam feiern sie Triumphe in ganz Europa, führen in St. Petersburg ein luxuriöses Leben, das Brodie, aufgewachsen in einem schottischen Dorf als Sohn eines tyrannischen Pfarrers, sich nie hätte erträumen lassen. Und doch ist das alles für Brodie unwichtig. Denn der wahre Grund, weshalb er in die Dienste des genialen, aber unberechenbaren Pianisten eingetreten ist, ist dessen Geliebte, die russische Sopranistin Lika.
Brodie weiß, dass diese Liebe unmöglich ist, und setzt doch alles für sie aufs Spiel - auch sein eigenes Leben. Denn der Klavierstimmer, der mit wenigen Handgriffen über Erfolg oder Misserfolg eines Konzerts, ja einer Pianistenkarriere entscheiden kann, folgt seinem Herzen, das sich nicht umstimmen lässt.

Wahrheitskapseln in der Fiktion: William Boyds Roman "Blinde Liebe" erzählt von Tschechow als Gast in Nizza und schickt einen jungen Schotten um die Welt.
Dieser Autor ist ein Könner. Souverän bespielt er seit bald vierzig Jahren viele Genres, kann Romanzen ebenso wie Krimis schreiben, Liebesdramen, existenzialistisch eingefärbte Lebenschroniken, pikareske Reisebücher, raffinierte Parodien und Komödien, Historienschinken oder ausgekochte Spionagethriller: William Boyd gelingt das alles. Gewiss bleiben Höhepunkte seines Schaffens wie "Eines Menschen Herz" (2002), die melancholisch grundierte Tagebuchfiktion eines Schriftstellers, der durchs zwanzigste Jahrhundert und um die halbe Welt flaniert, in besonderer Erinnerung. Doch auch wenn man in anderen Fällen später nicht mehr so recht weiß, wovon dieser oder jener Boyd-Roman eigentlich gehandelt hat, wird man immer wissen, er war gut zu lesen. Und besonders einprägsam ist stets, wenn wieder einmal Fakten und Fiktionen in schwindelnde Verbindung gebracht werden. Darin ist Boyd Virtuose.
Unvergessen bleibt sein Coup, als er einst die Prätentionen der New Yorker Kunstwelt mit der Biographie eines erfundenen Malers schonungslos entlarvte. Ganz ähnlich spielte auch sein letzter Roman, der Bestseller-Erfolg "Die Fotografin" (2016), mit den Erwartungen und Möglichkeiten des Dokumentarischen, das gleichwohl erst im Kontext einer ausgedachten Story Macht gewinnt. Umgekehrt lagert er gern kleine Wahrheitskapseln als historische Erkennungsmarken in die Fiktion ein, vor allem wenn er Schriftstellern wie Ian Fleming oder auch Virginia Woolf namenlose Auftritte in seinen Geschichten gibt. Im aktuellen Roman, seinem fünfzehnten, nutzt er dafür Anton Tschechow.
"Was wäre das für eine Welt, in der niemals etwas schiefliefe, in der alles immer beim Alten bliebe, das Leben einem vorgezeichneten Weg folgte - in der die Familie immer reizend, Freunde und Geliebte stets zuverlässig und treu wären?" So spricht ein lungenkranker Russe, der Spitzbart trägt und sich als Arzt vorstellt, als er 1898 in Nizza einen jungen Schotten trifft, den Helden von Boyds Geschichte, der dort ebenfalls zur Lungenkur ist. Die Frage beantwortet der Russe selbst - "eine solche Welt würde mir, glaube ich, nicht gefallen. Wir sind für Komplikationen geschaffen, wir Menschen" - und warnt den jungen Leidensbruder dennoch eindringlich vor Sängerinnen und Aktricen, besonders russischen, weil diese alles kompliziert machen.
Der Name Tschechow wird hier nicht genannt. Im Vorsatz des Romans jedoch erfahren wir durch ein Zitat, dass Tschechow in seinem letzten Lebensjahr ein weiteres Theaterstück plante, in welchem der Held eine Frau liebt, "die seine Gefühle entweder nicht erwidert oder die ihm untreu ist". Aus diesem Stück ist nie etwas geworden, Tschechows Lungenleiden ließ ihn vorher sterben. Nun macht Boyd daraus einen Roman.
Angesiedelt um die vorletzte Jahrhundertwende, erzählt er die Geschichte eines jungen schottischen Klavierstimmers namens Brodie, der sich unsterblich in eine russische Sängerin verliebt und bald eine leidenschaftliche Beziehung mit ihr führt, obgleich sie an der Seite eines anderen Mannes lebt, eines genialischen, irisch ungestümen sowie trunksüchtigen Klaviervirtuosen, für den der Liebhaber auch noch selbst arbeitet. Die Sängerin heißt Lika - tatsächlich wie eine Affäre Anton Tschechows -, und sie hat ein Hündchen, so wie die Titelfigur einer der bekanntesten von Tschechows Erzählungen. Und das sind nur einige der wundersamen Komplikationen, für welche dieser Roman wie geschaffen ist. Später treten beispielsweise noch zwei trinkfeste Iren auf, erkennbar James Joyce und sein Bruder Stan, und sorgen dafür, dass der Held sein Leben fortan auf den Andamanen fristet. Doch solche metafiktionalen Spielereien mit der Literaturgeschichte kann man auch getrost beiseitelassen.
Eigentlich genügt es, wenn man sich hier lustvoll auf den bunten Bilderbogen der wechselnden Schauplätze und opulenten Szenerien einlässt - von Edinburgh führt Brodies Leben uns erst ins Paris des Fin de Siècle, dann nach Nizza, nach Sankt Petersburg und in die russische Provinz, später nach Biarritz und über Graz und Triest bis in den Golf von Bengalen - und einfach dem Sog des Erzählens folgt. Denn Boyd erzählt gekonnt wie immer und bietet jede Menge auf - einen alttestamentarischen Vater, einen missgünstigen Bruder, eine reiche Mäzenin, gute Diners, etliche Huren, ein Duell, Täuschungsmanöver, Verfolgungswahn, Betrug, Intrigen, etwas Sex und ganz viel Herzschmerz -, um 500 Seiten prall zu füllen.
Wen kümmert es, dass vieles davon oft erprobt und manches etwas eingefahren wirken mag? Von einem Autobauer wird auch niemand fordern, dass er das Rad neu erfindet. Und doch nutzt Boyd diesmal einen besonderen Clou. Seine Geschichte wird ganz aus der Sicht ihres unglücklichen Helden dargeboten, die allerdings durchweg getrübt ist. Brodie verfügt zwar über ein ausgezeichnetes Gehör, was ihn zu seinem musikalischen Beruf befähigt, seine Augen aber sind nicht gut, weshalb er eine starke Brille braucht. Außerdem macht ihn auch seine Liebe, wie schon im Titel angekündigt, blind. So kommt es, dass wir Leser, obschon durchweg auf seine Perspektive festgelegt, oft mehr wahrnehmen als der Held und alles Unglück, das ihm droht, wie auch die schrecklichen Verhältnisse, in die er sich verstrickt, viel eher als er kommen sehen. Daraus entsteht die größte Spannung, weil uns der Autor einerseits das Unausweichliche ahnen lässt und andererseits doch immer wieder überrascht.
Er ist und bleibt eben ein Könner. Und so beschleicht uns nur ganz selten das Gefühl, dass wir am Ende doch viel lieber wüssten, was Tschechow wohl aus der Geschichte gemacht hätte.
TOBIAS DÖRING
William Boyd: "Blinde Liebe". Roman.
Aus dem Englischen von Ulrike Thiesmeyer. Kampa Verlag, Zürich 2019. 512 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Für den Rezensenten Tobias Döring ist William Boyd ein Alleskönner, der geschickt mit den Genres jongliert. Entsprechend erfreut nimmt der Kritiker Boyds inzwischen fünfzehnten Roman zur Hand, den er zwar nicht zu dessen besten Romanen zählt, aber immer noch originell und absolut lesenswert findet. Erzählt wird die an ein von Anton Tschechow nie realisiertes Drama angelehnte Geschichte um einen jungen Schotten, der sich Ende des 19. Jahrhunderts in Nizza zur Lungenkur einfindet und sich dort in eine russische Sängerin verliebt, die mit einem irischen, "trunksüchtigen" Klaviergenie liiert ist. Ganz hingerissen von Boyds "opulenten Szenerien" und der Sogkraft des Romans reist der Kritiker mit Boyds Helden von Edinburgh ins Paris des Fin de Siecle, über Nizza, Sankt Petersburg und Triest bis in den Golf von Bengalen und lässt sich dabei von reichen Mäzeninnen, Huren, Intrigen, "etwas Sex und ganz viel Herzschmerz" bestens unterhalten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH