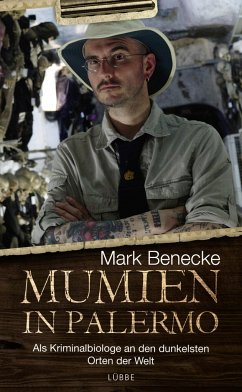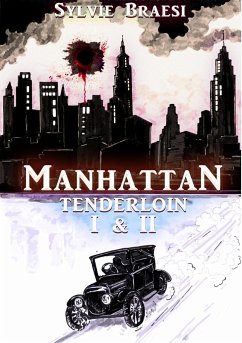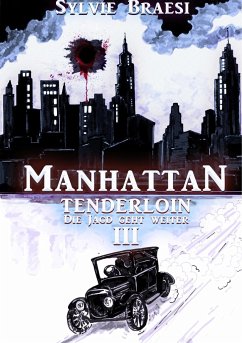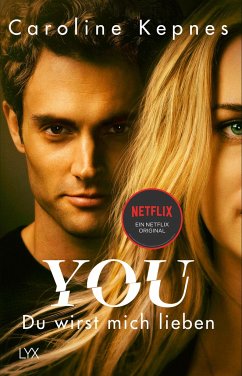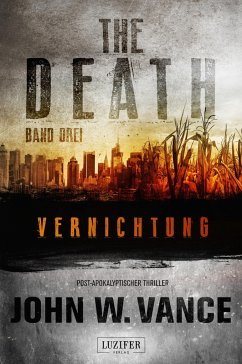Nicht lieferbar

Walter Kirn
Gebundenes Buch
Blut will reden
Eine wahre Geschichte von Mord und Maskerade
Übersetzung: Lösch, Conny
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Im Sommer 1998 begibt sich Walter Kirn, ein vielversprechender junger Romanautor, auf eine ungewöhnliche Reise: Er bringt einen behinderten Jagdhund von Montana nach Manhattan - in das Apartment von Clark Rockefeller, einem Finanzinvestor und Kunstsammler, der den Hund via Internet adoptiert hat. So beginnt eine fünfzehn Jahre währende Beziehung, die Kirn immer tiefer in die bizarre Welt eines absonderlichen Multimillionärs hineinzieht, der sich am Ende als Hochstapler, Kidnapper und eiskalter Mörder erweist.Denn Clark Rockefeller ist in Wahrheit weder ein Rockefeller noch ein Freund. Er ...
Im Sommer 1998 begibt sich Walter Kirn, ein vielversprechender junger Romanautor, auf eine ungewöhnliche Reise: Er bringt einen behinderten Jagdhund von Montana nach Manhattan - in das Apartment von Clark Rockefeller, einem Finanzinvestor und Kunstsammler, der den Hund via Internet adoptiert hat. So beginnt eine fünfzehn Jahre währende Beziehung, die Kirn immer tiefer in die bizarre Welt eines absonderlichen Multimillionärs hineinzieht, der sich am Ende als Hochstapler, Kidnapper und eiskalter Mörder erweist.
Denn Clark Rockefeller ist in Wahrheit weder ein Rockefeller noch ein Freund. Er ist Christian Gerhartsreiter, ein Psychopath, der seine ganze Umgebung, seine eigene Ehefrau und auch sich selbst in einem Netz aus Lügen gefangen hält. Während Kirn eine zweite Reise antritt in die Abgründe der menschlichen Seele, entdeckt er nicht nur einen Mann, den er kaum kannte - einen echten Mr. Ripley und Zombie-Gatsby, der sich mit Mord und Maskerade seine eigene Realität erschaffen hat. Er entdeckt auch, wer auf der Liste seiner zukünftigen Opfer weit oben stand: Er selbst.
Denn Clark Rockefeller ist in Wahrheit weder ein Rockefeller noch ein Freund. Er ist Christian Gerhartsreiter, ein Psychopath, der seine ganze Umgebung, seine eigene Ehefrau und auch sich selbst in einem Netz aus Lügen gefangen hält. Während Kirn eine zweite Reise antritt in die Abgründe der menschlichen Seele, entdeckt er nicht nur einen Mann, den er kaum kannte - einen echten Mr. Ripley und Zombie-Gatsby, der sich mit Mord und Maskerade seine eigene Realität erschaffen hat. Er entdeckt auch, wer auf der Liste seiner zukünftigen Opfer weit oben stand: Er selbst.
Walter Kirn, geb. 1962, ist ein amerikanischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Essayist. Sein Roman "Up in the Air" wurde 2009 mit George Clooney verfilmt.
Produktdetails
- Verlag: Beck
- Originaltitel: Blood will out
- Seitenzahl: 288
- Erscheinungstermin: 16. Juli 2014
- Deutsch
- Abmessung: 220mm x 143mm x 24mm
- Gewicht: 494g
- ISBN-13: 9783406667688
- ISBN-10: 3406667686
- Artikelnr.: 40746515
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Verrückte Story, meint Peter Praschl angesichts von Walter Kirns Versuch, einem Betrug aufzuarbeiten, dem er über 10 Jahre hinweg aufgesessen ist. Der Schriftsteller glaubte, einen Rockefeller als Freund zu haben. Stattdessen handelte es sich um einen Hochstapler und Mörder. Wie Kirn den Gang der Selbstanalyse und Selbsterkenntnis darstellt, fasziniert Praschl sichtbar. Zumal es dem Autor laut Rezensent gelingt, die Manöver des Verführens für den Leser nachvollziehbar zu machen und gar eine dämonische Seelnverwandtschaft zwischen sich und dem Mörder und Betrüger anzudeuten. Verwirrt hat Praschl der Umstand, dass er als Leser am Ende nicht mehr weiß, wer hier gewinnt: der Verführte mit seiner Aufarbeitung oder der Verführer, der nun eine tolle Story bekommen hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Gatsby, der Ripper
Die irrste Hochstaplergeschichte der Welt: Ein junger Bayer zieht nach Amerika, wird ein Rockefeller und ein Mörder. Jetzt hat sein Freund, der Schriftsteller Walter Kirn, den Fall aufgeschrieben: Über unsere Eitelkeit, unsere Liebe zur Täuschung und unseren Wunsch, das eigene Leben wie einen Roman zu schreiben
Er nennt ihn immer noch Clark. Das ist ja auch der Name, unter dem Walter Kirn seinen Freund kennengelernt hat: Clark Rockefeller. Wohnhaft in Boston. Verheiratet, Vater einer Tochter. Mitglied einer amerikanischen Familie, die in einem Land, das keine Aristokratie besitzt, ungefähr das ist, was in Europa mal die Bourbonen oder Hohenzollern waren: das Superestablishment. Der allerkleinste
Die irrste Hochstaplergeschichte der Welt: Ein junger Bayer zieht nach Amerika, wird ein Rockefeller und ein Mörder. Jetzt hat sein Freund, der Schriftsteller Walter Kirn, den Fall aufgeschrieben: Über unsere Eitelkeit, unsere Liebe zur Täuschung und unseren Wunsch, das eigene Leben wie einen Roman zu schreiben
Er nennt ihn immer noch Clark. Das ist ja auch der Name, unter dem Walter Kirn seinen Freund kennengelernt hat: Clark Rockefeller. Wohnhaft in Boston. Verheiratet, Vater einer Tochter. Mitglied einer amerikanischen Familie, die in einem Land, das keine Aristokratie besitzt, ungefähr das ist, was in Europa mal die Bourbonen oder Hohenzollern waren: das Superestablishment. Der allerkleinste
Mehr anzeigen
Kreis. Wo die Nennung des Namens reicht, damit sich alle Türen öffnen, und dahinter geht es nur nach oben.
Aber der Mann, den der amerikanische Schriftsteller Walter Kirn bis heute Clark nennt, hieß niemals so. Und auch nicht Chip Smith. Oder Christopher Crowe. Oder Christopher Chichester der Dreizehnte. Er hieß genauso wenig Chris Kenneth Gerhart oder Christopher Gerharts Reiter. Der Mann, der sich all diese Namen gegeben hat und schließlich als Clark Rockefeller berühmt wurde, heißt eigentlich Christian Karl Gerhartsreiter, geboren im oberbayerischen Siegsdorf, vor dreiundfünfzig Jahren. Heute sitzt er im Gefängnis von Los Angeles ein, lebenslänglich, weil er den Sohn seiner einstigen Vermieterin ermordet haben soll. Die ihn als Chris Chichester kannte, Filmstudent an der Universität von Southern California, damals, in den achtziger Jahren.
Walter Kirn nennt ihn aber immer noch Clark. Zum einen, erklärt er, weil er ihn nun mal unter diesem Namen und in dieser Ausformung kennengelernt hat - und dann, weil er bezweifelt, dass von einem "Christian" aus Oberbayern noch irgendetwas übrig sei.
Kirn hat die Geschichte seines Freundes jetzt aufgeschrieben, in einem spektakulären Buch, das "Blut will reden" heißt und morgen auf Deutsch erscheint. Und das zu den Unwahrscheinlichkeiten, die offenbar unweigerlich zu so einer Hochstaplerkarriere gehören, eine weitere hinzufügt: dass dieser Hochstapler sich nämlich auch noch anfreundete mit einem jungen Autor aus Montana, der dann selbst berühmt wurde, spätestens, als einer seiner Romane mit George Clooney in der Hauptrolle verfilmt wurde - "Up in the Air", 2009 mehrfach für den Oscar nominiert.
Die Geschichte des Christian Gerhartsreiter ist schon in anderen Büchern rekonstruiert (und sogar verfilmt) worden, von Reportern, die den Weg des jungen Bayern nachzeichneten: wie er 1978 als Austauschschüler seinen Heimatort Bergen Richtung Connecticut verließ und sich dann in immer neuen Formen nach oben schwindelte. Wie er als Filmstudent in Los Angeles behauptete, er produziere die Neuauflage der Fernsehkrimiserie "Alfred Hitchcock presents". Und dass er der Bruder des Popjournalisten und Regisseurs Cameron Crowe sei.
Und wie er dann im exklusiven Greenwich in Connecticut auftauchte, wo die Börsentypen von Manhattan leben, und bald von diesen Typen Jobs an der Wall Street bekam, wo Christopher Crowe ganze Abteilungen leitet, ohne einen Abschluss, aber mit beeindruckendem Monogramm auf seinem Burberrymantel. Als er bei Nikko Securities rausfliegt, weil er gar nicht Crowe heißt, erzählt er seiner damaligen Freundin, er heiße in Wirklichkeit Mountbatten und sei ein britischer Adliger, der inkognito leben müsse. Und als dann eines Tages im Jahr 1988 ein Polizist vor ihrer Tür steht, erklärt er, der Mann sei ein Gangster, der ihm was antun wolle, deswegen müssten sie jetzt gleich untertauchen und eine neue Identität annehmen. Und so besorgt seine Freundin ihm eine Kreditkarte unter dem Namen Clark Rockefeller.
Und als Clark Rockefeller lernt er bei einem Spieleabend Sandra Boss kennen, eine reiche Harvard-Absolventin. Sie heiraten 1995, bekommen eine Tochter und leben in New York, dann in Boston. Als Sandy sich von ihm scheiden lässt, entführt er seine Tochter. Das Fernsehen zeigt sein Fahndungsfoto. Und da fliegt alles auf. Verbindungen werden gezogen, von Rockefeller über Crowe zu Chichester. Er wird verhaftet. Und wegen Kindesentführung verurteilt. Und während das Verfahren noch läuft, finden die Ermittler eines ungelösten Mordfalls im kalifornischen San Marino endlich diesen Mann, den sie schon so lange befragen wollten. Den Mieter des Opfers, den sie als Chris Chichester suchen, der aber schließlich als Christian Gerhartsreiter im April 2013 wegen Mordes an John Sohus zu 27 Jahren Haft verurteilt wird. Auch wenn der Staatsanwalt kein Motiv präsentieren kann.
Diese Geschichte ist also schon in anderen Büchern nacherzählt worden - aber das von Walter Kirn lässt sie doch hinter sich. Weil in "Blut will reden" zwei Elemente zusammenkommen: die Nähe, die Kirn zu Gerhartsreiter hatte, und sein Gespür für das Fiktionale an der Existenz dieses Mannes, der seinen steifen Akzent von der Figur einer Fernsehserie abkupferte und seinen amerikanischen Traum an den "großen Gatsby" anlehnte. "Er lebte nicht vom Schreiben - er schrieb, indem er lebte", behauptet Kirn in seinem Buch, und man könnte das jetzt für eine fahrlässige, nur interessante Verharmlosung eines Kriminellen halten, wären Kirns Indizien nicht so stichhaltig und sein Plädoyer nicht so großartig geschrieben.
Es ist der Sommer 1998. Kirn, der an seinem zweiten Buch arbeitet, lebt mit seiner jungen Frau auf einer Farm in Montana. Bekannte der beiden haben einen Gordon Setter bei sich aufgenommen, der überfahren worden war, nun in einem Hunderollstuhl sitzt, aber von einem gewissen Clark Rockefeller adoptiert werden möchte. Der behauptet zwar, ein Flugzeug zu besitzen, mit dem man den gelähmten Setter nach New York bringen könnte, nur sei leider seine Frau damit in China unterwegs. Also bietet sich Walter an, den Hund zu fahren, quer durch Amerika, teils aus schlechtem Gewissen, weil er einen Pflegehund seiner Frau überfahren hatte, teils, weil er eine Geschichte wittert: Da wartet ein Rockefeller auf ihn in New York.
Die Freundschaft von Walter und Clark fängt also schon mal unwahrscheinlich an, und so geht es immer weiter. Als Kirn den Hund nach einer komplizierten Reise - für die er am Ende von Clark 500 Dollar bekommt, nicht mal die Hälfte seiner Ausgaben - Clark übergibt, gehen die beiden abends mit ihren Frauen essen, im Sky Club des MetLife-Hochhauses. Wer bezahlt, ist unklar, auch später wird Clark nie ein Portemonnaie bei sich haben. Vor dem Fenster sieht man das massive Rockefeller Center. "Was sagen Sie, wollen wir uns einen Spaß machen?", fragt Clark in die Runde. "Zufällig hab ich ihn dabei." Er greift in sein Jackett. "Den Schlüssel." - "Sie haben einen Generalschlüssel?", fragt Kirn entgeistert zurück. Dann bestellen sie Dessert.
Die Szene ist symptomatisch für alles, was folgt zwischen Walter und Clark, und auch für die Art, wie der Hochstapler seine anderen Opfer täuschte: Er köderte sie mit dem Zutritt zur Exklusivität, er hielt sie in Schach mit der Furcht, sich durch Unglauben zu blamieren. "Ich war kein Opfer", schreibt Kirn deswegen in seinem Buch. "Ich war Mittäter."
Jahre später, als Clark in Cornish lebt, jener neuenglischen Stadt, in die sich der Schriftsteller J. D. Salinger zurückgezogen hatte, zeigt Clark seinem Freund einen Bienenstock in seinem Garten. Aber so sehr Kirn auch in den Baum starrt, so laut Clark auch vom Honig schwärmt, den er geerntet hat: Da ist nichts. "Cool", sagt Walter trotzdem und steigt wieder von der Leiter.
"Man musste Gutgläubigkeit beisteuern", schreibt Kirn, "sie vom eigenen, persönlichen Konto auf ein gemeinsames mit ihm überweisen. Er zeigt einem einen hohlen Baum; die Bienen ergänzt man selbst. Er steckt einem die Telefonnummer des Präsidenten zu" - das hatte Clark am selben Abend getan, weil Walter über Steuerprobleme geklagt hatte - "die Gesichter der Secret-Service-Agenten, die wenige Tage später vor der Haustür stehen, malte man sich ganz alleine aus. Man bekam einen Umschlag mit einem Scheck von ihm; den Betrag trug man selbst ein."
Das ist der Kern seiner Argumentation: das menschliche Grundbedürfnis, das eigene Leben auszumalen, an eine Geschichte zu glauben, in der man selbst eine große Rolle spielt. Das Fiktionale, das er im Wesen des Hochstaplers erkennt, zeigt sich also nicht nur daran, dass Gerhartsreiter aus Fernsehserien und Fitzgeralds "großem Gatsby" abkupferte; dass er im eigentlich subversiv-ironischen "Preppy Handbook" wie in einem Lexikon nachschlug, wie man sich als Mitglied des amerikanischen Ostküstengeldadels passend anzieht; dass er den brutalen Mord, den er an dem Sohn seiner Vermieterin beging, dessen Frau bis heute verschwunden bleibt, an Hitchcocks "Cocktail für eine Leiche" orientierte: Nein, es geht auch um das enorme Bedürfnis nach Erzählung und Ausschmückung, das uns zu Menschen macht. Und das Gerhartsreiter ausnutzte. "Eitelkeit, Eitelkeit, Eitelkeit" sei der Schlüssel zu seinem Erfolg gewesen, hat Clark seinem Freund erklärt, als der ihn im Gefängnis besuchte. Nicht seine eigene - die der Menschen, die Clark täuschte.
"Er muss", sagt Walter Kirn im Gespräch, "jeden um sich herum für einen Trottel gehalten haben. Und das hat sein Überlegenheitsgefühl nur befeuert. Je länger er mit seinen Geschichten durchkam, desto dämlicher muss ihm seine Umwelt erschienen sein." Und warum hat Kirn ihn nicht durchschaut? Wo er doch selbst, als hochbegabtes Kind aus kleinen Verhältnissen, in genau die Kreise geriet, die Gerhartsreiter imitierte, und in Princeton und Oxford unter lauter hochwohlgeborenen Nullen in Button-down-Hemden studierte? "Sie haben mich schlecht behandelt", erzählt Kirn, "und mich nie als ihresgleichen gesehen. Und jetzt kommt da Jahre später ein Mensch daher, der noch privilegierter ist als die, die mich gequält haben, und will mein Freund werden!" ("You have no idea how easy you were to fool", hat Clark seinem alten Freund nach Erscheinen des Buchs auf Twitter aus dem Gefängnis geschrieben, unter einem Pseudonym, von dem er sicher sein konnte, dass Walter es entziffert.)
Kirn unterschlägt seine eigene Anfälligkeit aber nicht in seinem Buch, im Gegenteil, er braucht sie geradezu für sein Porträt Gerhartsreiters. Den er für einen Psychopathen hält. Für ein "Monster". Aber wenn der monströse Clark nie reich wurde mit seinen Rollen - seine Kunstsammlung stellt sich inzwischen als gefälscht heraus wie alles in seinem "Leben" - was trieb ihn dann an? "Clark hat der ganze Prozess Spaß gemacht", antwortet Kirn. "Ich glaube, er hat jedes Mal in sich hineingelacht, wenn er jemanden hereingelegt hat, und sich im Stillen selbst applaudiert bei jeder neuen Geschichte, die einfach zu absurd war, um sie zu glauben. Er war elektrisiert von seinen eigenen Eskapaden und Schachzügen wie ein echter Großmeister." Wie Professor Moriarty, der Gegenspieler von Sherlock Holmes. Wie ein Bond-Bösewicht mit Kätzchen auf dem Schoß. "Gatsby the Ripper", haben Kirn und ein anderer Reporter, der auch beim Mordprozess in Los Angeles dabei war, ihn getauft.
Eine sehr amerikanische Geschichte erzählt Walter Kirn in seinem Buch - über eine kriminelle Karriere, die von der Unsicherheit einer Gesellschaft zehrte, die sich angesichts ihrer eigenen kurzen Abstammungstafel leicht täuschen ließ von Rang und Status und klangvollen Namen aus der alten Welt. Eine schreckliche Mordgeschichte ist es auch. Aber nicht nur. "Blut will reden" ist auf paradoxe Weise auch eine Feier: der Beweglichkeit des menschlichen Geistes, sich Geschichten auszudenken oder sie anzupassen an die Gegenwart. Eine Feier der Unberechenbarkeit, die alle Algorithmen unterläuft. Digitalkonzerne wollen unser Verhalten kalkulieren und zähmen - aber Aufstieg und Fall Christian Gerhartsreiters zeigen, zu was der menschliche Geist imstande ist. Verschwörungstheorien, wechselnde Namen, absurde Erklärungen, reiner Schwachsinn - jahrelang kam er damit durch.
Gerhartsreiter ernährte sich von den Geschichten und Leidenschaften anderer Leute, ohne eigene zu haben. Er imitierte Gefühle, aber zu perfekt. "Ich habe, als die Figuren von ihm abgefallen waren, deren Leben er erzählte, keinen Hinweis auf ein erzählerisches Eigenleben gefunden", sagt Walter Kirn. "Er wirkte wie ein zusammengefallenes, geistesabwesendes, jämmerliches Etwas ohne seine Kostüme." Selbst den Spitznamen seiner Tochter, Snooks, hatte er geklaut. Walter Kirn bezweifelt, dass er sie je geliebt hat. Den Hund, mit dem ihre Freundschaft begann, hat Clark offensichtlich auch umgebracht, als er ihn nicht mehr brauchte.
TOBIAS RÜTHER
Walter Kirn: "Blut will reden". Übersetzt von Conny Lösch. Verlag C. H. Beck, 288 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Aber der Mann, den der amerikanische Schriftsteller Walter Kirn bis heute Clark nennt, hieß niemals so. Und auch nicht Chip Smith. Oder Christopher Crowe. Oder Christopher Chichester der Dreizehnte. Er hieß genauso wenig Chris Kenneth Gerhart oder Christopher Gerharts Reiter. Der Mann, der sich all diese Namen gegeben hat und schließlich als Clark Rockefeller berühmt wurde, heißt eigentlich Christian Karl Gerhartsreiter, geboren im oberbayerischen Siegsdorf, vor dreiundfünfzig Jahren. Heute sitzt er im Gefängnis von Los Angeles ein, lebenslänglich, weil er den Sohn seiner einstigen Vermieterin ermordet haben soll. Die ihn als Chris Chichester kannte, Filmstudent an der Universität von Southern California, damals, in den achtziger Jahren.
Walter Kirn nennt ihn aber immer noch Clark. Zum einen, erklärt er, weil er ihn nun mal unter diesem Namen und in dieser Ausformung kennengelernt hat - und dann, weil er bezweifelt, dass von einem "Christian" aus Oberbayern noch irgendetwas übrig sei.
Kirn hat die Geschichte seines Freundes jetzt aufgeschrieben, in einem spektakulären Buch, das "Blut will reden" heißt und morgen auf Deutsch erscheint. Und das zu den Unwahrscheinlichkeiten, die offenbar unweigerlich zu so einer Hochstaplerkarriere gehören, eine weitere hinzufügt: dass dieser Hochstapler sich nämlich auch noch anfreundete mit einem jungen Autor aus Montana, der dann selbst berühmt wurde, spätestens, als einer seiner Romane mit George Clooney in der Hauptrolle verfilmt wurde - "Up in the Air", 2009 mehrfach für den Oscar nominiert.
Die Geschichte des Christian Gerhartsreiter ist schon in anderen Büchern rekonstruiert (und sogar verfilmt) worden, von Reportern, die den Weg des jungen Bayern nachzeichneten: wie er 1978 als Austauschschüler seinen Heimatort Bergen Richtung Connecticut verließ und sich dann in immer neuen Formen nach oben schwindelte. Wie er als Filmstudent in Los Angeles behauptete, er produziere die Neuauflage der Fernsehkrimiserie "Alfred Hitchcock presents". Und dass er der Bruder des Popjournalisten und Regisseurs Cameron Crowe sei.
Und wie er dann im exklusiven Greenwich in Connecticut auftauchte, wo die Börsentypen von Manhattan leben, und bald von diesen Typen Jobs an der Wall Street bekam, wo Christopher Crowe ganze Abteilungen leitet, ohne einen Abschluss, aber mit beeindruckendem Monogramm auf seinem Burberrymantel. Als er bei Nikko Securities rausfliegt, weil er gar nicht Crowe heißt, erzählt er seiner damaligen Freundin, er heiße in Wirklichkeit Mountbatten und sei ein britischer Adliger, der inkognito leben müsse. Und als dann eines Tages im Jahr 1988 ein Polizist vor ihrer Tür steht, erklärt er, der Mann sei ein Gangster, der ihm was antun wolle, deswegen müssten sie jetzt gleich untertauchen und eine neue Identität annehmen. Und so besorgt seine Freundin ihm eine Kreditkarte unter dem Namen Clark Rockefeller.
Und als Clark Rockefeller lernt er bei einem Spieleabend Sandra Boss kennen, eine reiche Harvard-Absolventin. Sie heiraten 1995, bekommen eine Tochter und leben in New York, dann in Boston. Als Sandy sich von ihm scheiden lässt, entführt er seine Tochter. Das Fernsehen zeigt sein Fahndungsfoto. Und da fliegt alles auf. Verbindungen werden gezogen, von Rockefeller über Crowe zu Chichester. Er wird verhaftet. Und wegen Kindesentführung verurteilt. Und während das Verfahren noch läuft, finden die Ermittler eines ungelösten Mordfalls im kalifornischen San Marino endlich diesen Mann, den sie schon so lange befragen wollten. Den Mieter des Opfers, den sie als Chris Chichester suchen, der aber schließlich als Christian Gerhartsreiter im April 2013 wegen Mordes an John Sohus zu 27 Jahren Haft verurteilt wird. Auch wenn der Staatsanwalt kein Motiv präsentieren kann.
Diese Geschichte ist also schon in anderen Büchern nacherzählt worden - aber das von Walter Kirn lässt sie doch hinter sich. Weil in "Blut will reden" zwei Elemente zusammenkommen: die Nähe, die Kirn zu Gerhartsreiter hatte, und sein Gespür für das Fiktionale an der Existenz dieses Mannes, der seinen steifen Akzent von der Figur einer Fernsehserie abkupferte und seinen amerikanischen Traum an den "großen Gatsby" anlehnte. "Er lebte nicht vom Schreiben - er schrieb, indem er lebte", behauptet Kirn in seinem Buch, und man könnte das jetzt für eine fahrlässige, nur interessante Verharmlosung eines Kriminellen halten, wären Kirns Indizien nicht so stichhaltig und sein Plädoyer nicht so großartig geschrieben.
Es ist der Sommer 1998. Kirn, der an seinem zweiten Buch arbeitet, lebt mit seiner jungen Frau auf einer Farm in Montana. Bekannte der beiden haben einen Gordon Setter bei sich aufgenommen, der überfahren worden war, nun in einem Hunderollstuhl sitzt, aber von einem gewissen Clark Rockefeller adoptiert werden möchte. Der behauptet zwar, ein Flugzeug zu besitzen, mit dem man den gelähmten Setter nach New York bringen könnte, nur sei leider seine Frau damit in China unterwegs. Also bietet sich Walter an, den Hund zu fahren, quer durch Amerika, teils aus schlechtem Gewissen, weil er einen Pflegehund seiner Frau überfahren hatte, teils, weil er eine Geschichte wittert: Da wartet ein Rockefeller auf ihn in New York.
Die Freundschaft von Walter und Clark fängt also schon mal unwahrscheinlich an, und so geht es immer weiter. Als Kirn den Hund nach einer komplizierten Reise - für die er am Ende von Clark 500 Dollar bekommt, nicht mal die Hälfte seiner Ausgaben - Clark übergibt, gehen die beiden abends mit ihren Frauen essen, im Sky Club des MetLife-Hochhauses. Wer bezahlt, ist unklar, auch später wird Clark nie ein Portemonnaie bei sich haben. Vor dem Fenster sieht man das massive Rockefeller Center. "Was sagen Sie, wollen wir uns einen Spaß machen?", fragt Clark in die Runde. "Zufällig hab ich ihn dabei." Er greift in sein Jackett. "Den Schlüssel." - "Sie haben einen Generalschlüssel?", fragt Kirn entgeistert zurück. Dann bestellen sie Dessert.
Die Szene ist symptomatisch für alles, was folgt zwischen Walter und Clark, und auch für die Art, wie der Hochstapler seine anderen Opfer täuschte: Er köderte sie mit dem Zutritt zur Exklusivität, er hielt sie in Schach mit der Furcht, sich durch Unglauben zu blamieren. "Ich war kein Opfer", schreibt Kirn deswegen in seinem Buch. "Ich war Mittäter."
Jahre später, als Clark in Cornish lebt, jener neuenglischen Stadt, in die sich der Schriftsteller J. D. Salinger zurückgezogen hatte, zeigt Clark seinem Freund einen Bienenstock in seinem Garten. Aber so sehr Kirn auch in den Baum starrt, so laut Clark auch vom Honig schwärmt, den er geerntet hat: Da ist nichts. "Cool", sagt Walter trotzdem und steigt wieder von der Leiter.
"Man musste Gutgläubigkeit beisteuern", schreibt Kirn, "sie vom eigenen, persönlichen Konto auf ein gemeinsames mit ihm überweisen. Er zeigt einem einen hohlen Baum; die Bienen ergänzt man selbst. Er steckt einem die Telefonnummer des Präsidenten zu" - das hatte Clark am selben Abend getan, weil Walter über Steuerprobleme geklagt hatte - "die Gesichter der Secret-Service-Agenten, die wenige Tage später vor der Haustür stehen, malte man sich ganz alleine aus. Man bekam einen Umschlag mit einem Scheck von ihm; den Betrag trug man selbst ein."
Das ist der Kern seiner Argumentation: das menschliche Grundbedürfnis, das eigene Leben auszumalen, an eine Geschichte zu glauben, in der man selbst eine große Rolle spielt. Das Fiktionale, das er im Wesen des Hochstaplers erkennt, zeigt sich also nicht nur daran, dass Gerhartsreiter aus Fernsehserien und Fitzgeralds "großem Gatsby" abkupferte; dass er im eigentlich subversiv-ironischen "Preppy Handbook" wie in einem Lexikon nachschlug, wie man sich als Mitglied des amerikanischen Ostküstengeldadels passend anzieht; dass er den brutalen Mord, den er an dem Sohn seiner Vermieterin beging, dessen Frau bis heute verschwunden bleibt, an Hitchcocks "Cocktail für eine Leiche" orientierte: Nein, es geht auch um das enorme Bedürfnis nach Erzählung und Ausschmückung, das uns zu Menschen macht. Und das Gerhartsreiter ausnutzte. "Eitelkeit, Eitelkeit, Eitelkeit" sei der Schlüssel zu seinem Erfolg gewesen, hat Clark seinem Freund erklärt, als der ihn im Gefängnis besuchte. Nicht seine eigene - die der Menschen, die Clark täuschte.
"Er muss", sagt Walter Kirn im Gespräch, "jeden um sich herum für einen Trottel gehalten haben. Und das hat sein Überlegenheitsgefühl nur befeuert. Je länger er mit seinen Geschichten durchkam, desto dämlicher muss ihm seine Umwelt erschienen sein." Und warum hat Kirn ihn nicht durchschaut? Wo er doch selbst, als hochbegabtes Kind aus kleinen Verhältnissen, in genau die Kreise geriet, die Gerhartsreiter imitierte, und in Princeton und Oxford unter lauter hochwohlgeborenen Nullen in Button-down-Hemden studierte? "Sie haben mich schlecht behandelt", erzählt Kirn, "und mich nie als ihresgleichen gesehen. Und jetzt kommt da Jahre später ein Mensch daher, der noch privilegierter ist als die, die mich gequält haben, und will mein Freund werden!" ("You have no idea how easy you were to fool", hat Clark seinem alten Freund nach Erscheinen des Buchs auf Twitter aus dem Gefängnis geschrieben, unter einem Pseudonym, von dem er sicher sein konnte, dass Walter es entziffert.)
Kirn unterschlägt seine eigene Anfälligkeit aber nicht in seinem Buch, im Gegenteil, er braucht sie geradezu für sein Porträt Gerhartsreiters. Den er für einen Psychopathen hält. Für ein "Monster". Aber wenn der monströse Clark nie reich wurde mit seinen Rollen - seine Kunstsammlung stellt sich inzwischen als gefälscht heraus wie alles in seinem "Leben" - was trieb ihn dann an? "Clark hat der ganze Prozess Spaß gemacht", antwortet Kirn. "Ich glaube, er hat jedes Mal in sich hineingelacht, wenn er jemanden hereingelegt hat, und sich im Stillen selbst applaudiert bei jeder neuen Geschichte, die einfach zu absurd war, um sie zu glauben. Er war elektrisiert von seinen eigenen Eskapaden und Schachzügen wie ein echter Großmeister." Wie Professor Moriarty, der Gegenspieler von Sherlock Holmes. Wie ein Bond-Bösewicht mit Kätzchen auf dem Schoß. "Gatsby the Ripper", haben Kirn und ein anderer Reporter, der auch beim Mordprozess in Los Angeles dabei war, ihn getauft.
Eine sehr amerikanische Geschichte erzählt Walter Kirn in seinem Buch - über eine kriminelle Karriere, die von der Unsicherheit einer Gesellschaft zehrte, die sich angesichts ihrer eigenen kurzen Abstammungstafel leicht täuschen ließ von Rang und Status und klangvollen Namen aus der alten Welt. Eine schreckliche Mordgeschichte ist es auch. Aber nicht nur. "Blut will reden" ist auf paradoxe Weise auch eine Feier: der Beweglichkeit des menschlichen Geistes, sich Geschichten auszudenken oder sie anzupassen an die Gegenwart. Eine Feier der Unberechenbarkeit, die alle Algorithmen unterläuft. Digitalkonzerne wollen unser Verhalten kalkulieren und zähmen - aber Aufstieg und Fall Christian Gerhartsreiters zeigen, zu was der menschliche Geist imstande ist. Verschwörungstheorien, wechselnde Namen, absurde Erklärungen, reiner Schwachsinn - jahrelang kam er damit durch.
Gerhartsreiter ernährte sich von den Geschichten und Leidenschaften anderer Leute, ohne eigene zu haben. Er imitierte Gefühle, aber zu perfekt. "Ich habe, als die Figuren von ihm abgefallen waren, deren Leben er erzählte, keinen Hinweis auf ein erzählerisches Eigenleben gefunden", sagt Walter Kirn. "Er wirkte wie ein zusammengefallenes, geistesabwesendes, jämmerliches Etwas ohne seine Kostüme." Selbst den Spitznamen seiner Tochter, Snooks, hatte er geklaut. Walter Kirn bezweifelt, dass er sie je geliebt hat. Den Hund, mit dem ihre Freundschaft begann, hat Clark offensichtlich auch umgebracht, als er ihn nicht mehr brauchte.
TOBIAS RÜTHER
Walter Kirn: "Blut will reden". Übersetzt von Conny Lösch. Verlag C. H. Beck, 288 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für