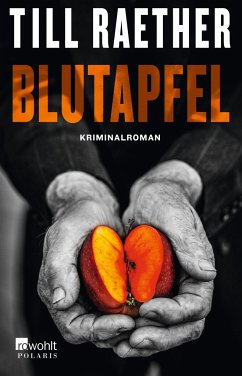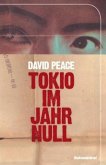Es ist Abend, dunkel. Im Elbtunnel herrscht wie immer Stau. Plötzlich ein Schuss. Der Fahrer eines weißen Geländewagens sackt über dem Lenkrad zusammen. Der Täter entkommt unerkannt. Die Tat eines Amokläufers? Der Beginn eines Bandeskrieges? Alle Spuren führen ins Nichts. Und dann interessiert sich mit einem Mal ein amerikanischer Geheimdienst für den Fall.
Hauptkommissar Adam Danowski gilt trotz seines jüngsten Ermittlungserfolges als unberechenbar. Auch diesmal geht er eigene Wege. Die führen in eine Neubausiedlung inmitten weiter Moorwiesen am Rande der Stadt, an verlassene Orte und düstere Geheimgänge.
Der zweite Fall für Hauptkommissar Adam Danowski.
Hauptkommissar Adam Danowski gilt trotz seines jüngsten Ermittlungserfolges als unberechenbar. Auch diesmal geht er eigene Wege. Die führen in eine Neubausiedlung inmitten weiter Moorwiesen am Rande der Stadt, an verlassene Orte und düstere Geheimgänge.
Der zweite Fall für Hauptkommissar Adam Danowski.

Krimis in Kürze: Maardam, New York und Hamburg
Wer ein Buch von Håkan Nesser aufschlägt, der weiß, dass nichts so bleiben wird, wie es anfangs erscheint. Da müsste diesmal gar nicht ein zweiter Name auf dem Buchumschlag stehen, Paula Polanski, das Pseudonym einer deutschen Publizistin, die Nesser auf einer Lesereise ihre Geschichte erzählte. Der Schwede war so gefesselt, dass er den Roman "Strafe" (btb, 288 S., geb., 19,99 [Euro]) gemeinsam mit ihr schrieb. Aber vielleicht ist das alles auch nur eine Erfindung, eine weitere erzählerische Pirouette.
In jedem Fall bewegt man sich sofort auf vertrautem Terrain, wenn man die vage niederländisch klingenden Ortsnamen liest, die zu jenem fiktiven Nesser-Land mitten in Europa gehören, wo auch schon Kommissar van Veteren ermittelte. Maardam zum Beispiel, wo der von seinem boxverrückten Vater so getaufte Max Schmeling lebt, ein Schriftsteller, den gerade seine dritte Frau verlassen hat. Er erhält einen merkwürdigen Brief von einem Tibor Schittkowski, der ihm als Jugendlicher zweimal das Leben gerettet hat. Nun soll Max dem moribunden Tibor einen Gefallen tun und dessen Tochter, die vom Vater nichts wissen will, zu einem letzten Gespräch überreden. Widerwillig lässt sich der Schriftsteller darauf ein und liest auch Tibors Lebensgeschichte, durch die eine zweite Erzählebene in den Roman eingezogen wird. Aus dieser Konstellation ergibt sich nur ein mäßig straffer Spannungsbogen. Das ändert sich erst spät, als plötzlich alles, was bis dahin geschehen ist, in einer neuen Perspektive erscheint, weil zu den beiden Erzählstimmen eine dritte kommt - mehr sollte man nicht verraten. Kein Geheimnis ist allerdings, dass "Strafe" sich ein bisschen zu sehr in seiner Selbstbezüglichkeit gefällt.
"Bonbons aus Blei", das war einer dieser aufgekratzten Titel, mit denen man in den sechziger und siebziger Jahre Bücher und Filme zu verkaufen versuchte. Diese Bonbons waren nun nicht nur vom kaum übersetzbaren Originaltitel "The Brass Go-Between", sondern auch vom Inhalt des Romans ziemlich weit entfernt, weil damals alles, was nicht auf acht Druckbögen oder 128 Seiten passte, durch Kürzungen passend gemachte wurde. Insofern ist "Der Messingdeal" (Alexander Verlag, 272 S., br., 14,90 [Euro]) die erste vollständige deutsche Ausgabe, und der Alexander Verlag hat in seiner gar nicht genug zu lobenden Ross-Thomas-Edition auch gleich das Pseudonym Oliver Bleeck einkassiert, unter dem Thomas diesen Roman sowie vier weitere mit dem Helden Philip St. Ives publizierte. Thomas' Verleger habe ihm, so geht die Anekdote, ein Pseudonym nahegelegt, weil er zu schnell schreibe.
Obwohl vor fünfundvierzig Jahren erschienen, kommt einem das Buch taufrisch vor. St. Ives, der arbeitslose New Yorker Journalist und leidenschaftliche Pokerspieler, der sich beruflich als professioneller Mittelsmann, als "Go-Between", neu orientiert hat, wird beauftragt, das Lösegeld für einen wertvollen afrikanischen Messingschild zu überbringen, den Diebe aus einem Museum in Washington gestohlen haben. Das komplizierte Geflecht politischer und ökonomischer Interessen, in das St. Ives gerät, ist mit dieser unnachahmlichen Präzision und Klugheit entworfen, wie das nur der 1995 verstorbene Thomas konnte, der einmal gesagt hat, Ironie sei bloß ein anderes Wort für Realismus. Der Ton ist gewohnt schnoddrig, ohne dass es so gedrechselt klänge wie oft bei Chandler, die Dialoge sind wundervoll pointiert, und St. Ives ist ein so angenehm unheldischer, zugleich aber so geistesgegenwärtiger Protagonist, dass man sich schon jetzt auf die nächsten Begegnungen mit ihm freut.
Erfreulich ist auch, was man von dem Journalisten Till Raether in dessen zweitem Roman erzählt bekommt. Sein Protagonist, der Hamburger Kommissar Adam Danowski, macht eine gute Figur, weil er nicht um jeden Preis originell sein muss und auch nicht wie eine Schaufensterpuppe mit exotischen Eigenschaften und Eigenheiten ausstaffiert wird, deren Kombination selten Sinn ergibt. Er ist ein normaler Familienvater, ermittelt lieber vom Schreibtisch aus und fällt nur dadurch auf, dass er öfter überfordert ist. "Hypersensibel" heißt das im Psychologenjargon - im Alltag bedeutet es nichts weiter, als dass er gelegentlich die vielen Eindrücke nicht filtern kann, denen er ausgesetzt ist.
Raether schreibt, wenn man sich in der deutschen Krimiprosa umschaut, überdurchschnittlich gut und gönnt nicht allein seinem Ermittler Kontur und Individualität. Und er hat ein gutes Auge für die Schauplätze in weniger aparten Hamburger Reihenhaus-Vororten. Der Plot von "Blutapfel" (Rowohlt, 480 S., br., 14,99 [Euro]) führt in den Elbtunnel, wo ein Mann mitten im Feierabendstau erschossen wird, und er macht einen bekannt mit der Topographie verlassener Orte. Das Opfer gehörte zu jenen Nerds, die solche Orte heimlich erkunden und sich im Deep Web darüber austauschen. Und jenseits der üblichen Trias von Mord - Ermittlung - Aufklärung handelt der Roman davon, dass es auch in der Entwicklung einer Stadt bisweilen so etwas gibt wie ein Unbewusstes und die Wiederkehr des Verdrängten.
PETER KÖRTE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Raether schreibt überdurchschnittlich gut und gönnt nicht allein seinem Ermittler Kontur und Individualität. Peter Körte FAZ.NET 20150622