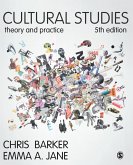Patchwork, Homo-Ehe, In-vitro-Fertilisation - was die einen als Untergang des Abendlandes bezeichnen, ist für andere eine Öffnung unserer Konzepte von Liebe, Beziehung und Familie. Christina von Braun, eine der renommiertesten Kulturwissenschaftlerinnen des Landes, blickt weit in die Geschichte zurück, um zu erklären, wie sich unsere Vorstellungen von Verwandtschaft entwickelten. Ihr neues Grundlagenwerk wird unseren Blick auf die Gegenwart verändern. "Blut ist ein ganz besonderer Saft", sagt Mephisto zu Faust, den er den Pakt mit seinem Blut unterschreiben lässt. Für die Kultur des Westens sind "Blutsbande" auch die Basis von Verwandtschaft. Das gilt nicht für alle Kulturen. Christina von Braun zeigt in ihrem neuen Standardwerk, auf welchen Vorstellungen die Idee der Blutsverwandtschaft beruht und wie sich diese Vorstellungen im Zeitalter von Genetik und Reproduktionsmedizin verändern. Einerseits verfestigt sich die Idee einer langen Kette von Blutsverwandten. Auf der anderen Seite treten aber auch soziale und kulturelle Definitionen von Verwandtschaft in den Vordergrund: Vertrauen in und Verantwortung für einander ersetzen die Blutsbande. Christina von Brauns Kulturgeschichte der Verwandtschaft ist so materialreich wie erhellend.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Das Wort "Familienbande" habe manchmal den Beigeschmack von Wahrheit, bemerkte Karl Kraus: Christina von Braun sondiert Konzepte von Verwandtschaft und umgeht dabei das Recht.
Ganz eindeutig ist die martialische Rede von "Blut" und "Blutsbande" nicht, wenn Christina von Braun ihre großangelegte Studie zur Geschichte des abendländischen Konzepts der Verwandtschaft an diesen Worten festmacht. Tatsächlich stellt die Kulturwissenschaftlerin Blut, Sinnlichkeit, den Leib (und die gesprochene Sprache) auf der einen Seite der Welt der Schriftzeichen, der Namen, des Geldes und des "Geistigen" auf der anderen Seite gegenüber. Wobei die Schriftzeichen dann ihrerseits in der physischen Wirklichkeit Rückhalt suchen: Sie rufen Bezüge aufs Blut herauf. So seien in der Geschichte des Westens Verwandtschaftslinien stets mit "roter Tinte" gezeichnet, zwar im Grunde kulturell konstruiert, dennoch aber wesenhaft aufgeladen.
Blut ist also ein Stoff, der die Idee der unabänderlichen Blutsverwandtschaft zitiert. Dabei wirkt sich der Geschlechterunterschied tiefgreifend aus: Während Mutterschaft über Jahrtausende zweifelsfrei feststeht, denn Geburten haben zumeist Augenzeugen, bleibt Vaterschaft eine abstrakte Beziehung. "Pater semper incertus est", lautet eine berühmte römische Rechtsformel: Der Vater ist stets ungewiss. Umso mehr beginnt hier nach von Braun das Einsatzgebiet "roter Tinte".
Die in Europa entstandenen Verwandtschaftssysteme kultivieren Vaterschaft auf unterschiedliche Weise symbolisch. Dabei werten Ehe, Elternschaft, Erbe die Blutsbande auf: "Sie verleihen der Vaterlinie den Anschein ebenjener nachweisbaren Leiblichkeit, die sie eigentlich entbehrt." Die Machtverteilung, die dabei entsteht, begünstigt den Mann. Sie ist durchgehend patriarchal.
Im Buch wird vor diesem Hintergrund über sieben Kapitel hinweg eine Kulturgeschichte zweier für den Westen maßgeblicher, religiös geprägter Verwandtschaftssysteme nachgezeichnet: die "griechisch-römische" und später christliche Patrilinearität (als über den Vater sich definierende Erblinie) sowie die jüdische Matrilinearität (also Vererbung von Zugehörigkeit und Gütern über die Mutter). Mit enormer Detailkenntnis zeichnet von Braun nach, wie das christliche Verwandtschaftsmodell auch über die Aufklärungszeit hinweg Figuren einer "geistigen" Zeugung und Vaterschaft variiert. Die Frau wechselt gemäß diesem Schema in die Familie des Mannes, dort bleibt sie die mütterliche Hohlform, in die hinein Nachwuchs gezeugt wird.
Im jüdischen Verwandtschaftsmodell hingegen vererbt sich Familienmitgliedschaft und Geld über die Mutter. Hier fällt der Frau die Rolle zu, die Familie zusammenzuhalten, weswegen sie im Zweifel in passender Weise "endogam", das heißt mit Verwandten, verheiratet wird. Dass nicht etwa Frauenmacht, sondern die versprengte Existenz in der Diaspora die jüdische Matrilinearität entstehen ließ, ist eine der nüchternen Thesen der Autorin.
Christlich wie jüdisch werden aber auch die Linien des Geld- und Güterverkehrs analog zur physischen Verwandtschaft modelliert. Vom Vergleich des unehelichen Kindes mit gefälschtem Geld über den Blut- und Kapitalkreislauf bis hin zur Idee, Geld lasse sich "züchten", versammelt die Autorin dafür anschaulich Belege.
Von Braun thematisiert die "Blutsbande" aber auch aktualisierend. Denn ein zweiter Fokus des Buches liegt auf der Entstehung und den Folgen von Biologie und moderner Reproduktionsmedizin: Der Naturalismus des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts steigert zwar, er unterminiert aber auch - so von Braun - die Vorherrschaft der Väter. Schuld sei die Wissenschaft, nämlich paradoxerweise eine immer präzisere Biologie. Vaterschaft wie auch epigenetische, also nicht von den elterlichen Genen stammende Prägungen des kindlichen Erbguts seien inzwischen derart sicher feststellbar, dass von der "geistigen" Linie oder auch "reiner" Vererbung nicht mehr viel bleibe.
Biotechniken verwandeln das Vaterbild zur profanen Rolle (im Grenzfall: des bloßen Samenspenders). Überhaupt habe die heutige Reproduktionsmedizin dramatische Folgen für die gelebte Praxis von Verwandtschaft und die Machtverteilung zwischen Männern und Frauen, auch für die Konzepte "Sexualität" und "Geschlecht". Von Braun entfaltet das durchaus vergnügt: Die Mutterschaft vervielfältigt sich (Eispenderin, Leihmutter, soziale Mutter und so fort), und mit den inzwischen biotechnisch realisierbaren Varianten von Transgender-Elternschaften brechen Denkmuster einer "natürlichen" Verwandtschaft - wo man sie nicht fundamentalistisch zur Kampfvokabel erhebt - schlicht weg.
Stehen also "verflüssigte" Männlichkeit, Verwandtschaft mit allen oder keinem bevor? Von Braun bejaht das, fordert ein Umdenken der Psychoanalyse, nimmt aber auch im Hinblick auf das Entstehen möglicher neuer Klassenkämpfe kein Blatt vor den Mund. Da ist zum einen der biotechnische Markt: Heute liegt die Macht zur Verwandtschaftsherstellung "im Labor, das sich alle Gestalten der Zeugungs- und Gebärfähigkeit angeeignet hat". Diejenigen, die sich dem Paradigma der "freien Wahl" von Geschlecht und Verwandtschaftsformen ausgeliefert haben, exponieren sich aber auch politisch. Denn ähnlich dem diskriminierenden Muster des "transnationalen Juden" würden heute transformierbare Identitäten von interessierter Seite "zu Gefahrenherden erklärt".
Von Brauns Kulturgeschichte ist unbedingt lesenswert. An Großdiagnosen wie die, der Westen habe an die Blutslinie "geglaubt", muss man allerdings Fragen richten. In der pauschalisierenden Rede vom "Westen" liegt eine echte Schwäche des Buchs. Aktuelle wie historische Beispiele kommen mal aus diesem, mal aus jenem europäischen Land, mal aus Israel, mal aus den Vereinigten Staaten. Unterschiedlichste Sozial- und Wirtschaftsgeschichten wie auch Symbolwelten mit deutlich differenten Gewichtungen von Religion, Säkularität und "Staat" - man vergleiche nur Deutschland und Frankreich in Sachen Vaterschaft oder auch die komplexen Genealogien von Vormundschaft oder Adoption - werden zugunsten eines großen Bogens miteinander vermengt.
Noch irritierender ist aber: Das Recht - von der Verfassungsgeschichte bis zum Familien- und Erbrecht - fehlt im Buch völlig, einschließlich Gesetzgebung, Gerichten und prozeduraler Pragmatik. Recht firmiert bei von Braun schlicht als "Schrift" beziehungsweise "Verschriftung". Die Option einer durch willentliche Handlung gestifteten Verbindung geht damit unter im Bild der roten Tinte, die sich, um als Natur zu gelten, ins "Unbewusste" einschreibt. Ähnlich unterkomplex bleibt die Metapher einer "geistigen Vaterschaft" als Urphänomen staatlicher Machtausübung. Dabei scheint ja doch gerade der Rechtsakt, die vertragliche, sei es mündliche, sei es schriftliche Setzung des Verwandtseins - und zwar schon in der römisch rechtlichen Tradition -, in Europa stets eine "sichere" Form der Verwandtschaft herstellen zu können. Klassisch benötigen so die Adoption, aber auch die Eheschließung selbst gerade nicht "rote Tinte", sondern werden im Wortsinn gemacht, nämlich handlungsförmig vollzogen.
Am Fehlen jeglicher Rechtsgeschichte, in der Recht nicht nur abstrakte Regel ist, sondern auch ein Repertoire potentiell egalitär nutzbarer, wirklichkeitsstiftender Formen, liegt es denn wohl auch, dass von Braun in ihrer Erzählung das Phänomen der modernen Frauenbefreiung nur unter Schwierigkeiten lokalisieren kann. Was den Wandel der Frauenrolle angeht, sind es nur die Biologie samt deren Verwissenschaftlichung von Inter- und Homosexualität und die Genetik, auf die sie sich berufen kann. Obwohl sie festhält, dass die "Emanzipation der Frau nicht das Resultat der geschlechtslosen Gesellschaft, sondern vielmehr Werkzeug auf dem Weg dorthin" sei, bleibt ihr als Erklärung dafür nur eine qua Biologisierung egalitäre Anthropologie.
Hier wäre dem Narrativ von den ab 1800 verblassenden "Blutsbanden" eine Geschichte juridischer, schon ihrer Form nach geschlechtsneutraler Gleichheitsfiguren - Personengesellschaft, Kollegium, Bürgerschaft - mitsamt der Forderung nach Übernahme aller möglichen Rollen durch alle zur Seite zu stellen gewesen. Zur etwas schlichten Zweiteilung von "sinnlich" und "geistig" käme so eine dritte Dimension. Die Engführung auf den einen besonderen Stoff Blut wäre dann freilich nicht mehr so überzeugend.
PETRA GEHRING
Christina von Braun:
"Blutsbande". Verwandtschaft als Kulturgeschichte.
Aufbau Verlag, Berlin 2018. 537 S., Abb., geb., 30,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FAS-Rezension
Rezensent Cord Riechelmann folgt Christina von Braun fasziniert durch ihre Kulturgeschichte der Verwandtschaft. Laut Kritiker schlägt Braun einen Bogen von frühen, vermeintlich archaischen Arten der Wahlverwandtschaft über das lange Zeit in der westlichen Welt dominante Bild der Blutsverwandtschaft hin zu den heutigen Formen familiärer Mobilität. Riechelmann lernt von ihr, dass die Tradition, Verwandtschaft als patrilineare Blutsbande zu bestimmen, derzeit durch den Siegeszug der Patchworkfamilie, die homosexuelle Elternschaft sowie die Möglichkeiten, die die zeitgenössische Reproduktionsmedizin eröffnet, an Boden verliert. Dass Braun Professorin für Kulturtheorie mit Schwerpunkt Geschlecht und Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin ist, spürt der Kritiker: Man könne trotz des hohen Abstraktionsgrades immer gut folgen, freut sich der Rezensent. Besonders vergnügt hat er Brauns Forderung an die Psychoanalyse gelesen, ein begriffliches Instrumentarium zu entwickeln, das über das im Modell der Blutsverwandtschaft verhaftete Dreieck Vater, Mutter, Kind hinausgehe.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
» Der Leser kann hier viel lernen. (...) Blutsbande entstehen und vergehen nicht, sie liegen vor. « Süddeutsche Zeitung 20180319