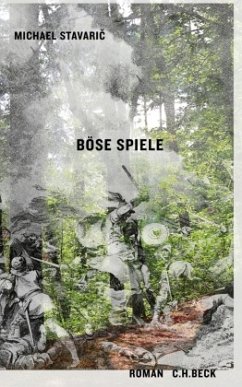Ein Mann, der Ich-Erzähler, liebt eine Frau, die mit einem anderen Mann zusammenlebt und mit ihm ein Kind hat, was nichts daran ändert, dass sie sich immer wieder treffen und nach einander verzehren. Aber da gibt es auch noch die andere Frau, die den Ich-Erzähler vergöttert und alles für ihn tun würde, aber auch alles von ihm verlangt. Die Erste fordert, ihren Mann Robert zu töten, damit es endlich zu irgendeiner Entscheidung kommt, die andere droht mit einem Clan-Krieg, wenn er ihre Liebe verrät. Alle spielen gemeinsam das Spiel von Liebe und Begehren, Lüge und Verrat, Hingabe und Entzug, mit allen Tricks und Kniffen, leidenschaftlich, abgründig, bisweilen komisch. Ein archaisches, ein unausweichliches, ein blutiges Spiel.
In seinem vierten Roman "Böse Spiele" entwickelt Michael Stavaric ein ebenso kunstvolles wie packendes Arrangement, eine gleichzeitig durchaus realistische und doch geradezu bühnenartige Szenenfolge, die einen vollkommen in den Bann zieht. Der ewige Geschlechterkrieg wird mit originellen und wuchtigen Bildern bedacht, betörend, intelligent und mit großer emotionaler Kraft zieht einen Stavarics Roman in den Abgrund der Liebe.
Denn in der heutigen Welt regelt kein Sittengesetz und kein gesellschaftlicher Zwang in Wahrheit mehr das Verhältnis der Geschlechter. Ihren Trieben, ihrer mit allen Wassern gewaschenen Intelligenz und der Maschinerie des Begehrens ausgesetzt, spielen sie unausgesetzt ihre "bösen Spiele". Darauf reagiert dieser kluge und zugleich ergreifende Roman.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
In seinem vierten Roman "Böse Spiele" entwickelt Michael Stavaric ein ebenso kunstvolles wie packendes Arrangement, eine gleichzeitig durchaus realistische und doch geradezu bühnenartige Szenenfolge, die einen vollkommen in den Bann zieht. Der ewige Geschlechterkrieg wird mit originellen und wuchtigen Bildern bedacht, betörend, intelligent und mit großer emotionaler Kraft zieht einen Stavarics Roman in den Abgrund der Liebe.
Denn in der heutigen Welt regelt kein Sittengesetz und kein gesellschaftlicher Zwang in Wahrheit mehr das Verhältnis der Geschlechter. Ihren Trieben, ihrer mit allen Wassern gewaschenen Intelligenz und der Maschinerie des Begehrens ausgesetzt, spielen sie unausgesetzt ihre "bösen Spiele". Darauf reagiert dieser kluge und zugleich ergreifende Roman.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Michael Stavaric bringt den Leser auf die Palme
Ein Mann zwischen zwei Frauen: Die eine will er haben, kann er aber nicht, die andere kann er haben, will er aber nicht. Kopflos gerät er in eine Gemengelage, die, man vermutet es vom ersten Satz an, ihren Preis fordern wird: "Wenn ich bei der Wahrheit geblieben wäre . . ." Statt dabei zu bleiben, verheddert sich der Ich-Erzähler des neuen Romans von Michael Stavaric weniger in der moralisch abgründigen Dreiecksbeziehung als vielmehr in den stilistisch leider oft misslungenen Sprachspielen und den mitunter mühsamen Verwirrspielen im Plot.
Der Klappentext lobt die "bühnenartige Szenenfolge" des mit "originellen und wuchtigen Bildern" bedachten Geschlechterkriegs. Die Eignung als Bühnenstück, sollte man meinen, ist für einen Roman noch kein Kriterium, auch wenn immer mehr Epik dramatisiert wird. Schlimmer aber sind die Bilder, die eben nicht originell und wuchtig, sondern gewollt und überladen wirken.
Metaphorisch für den Helden steht offenbar das Leitmotiv des Palmdiebs, eines scheuen Krebstiers, das nachts mit seinen starken Scheren Kokosnüsse aufbricht und in manchen Regionen nicht zuletzt aufgrund seiner angeblich aphrodisierenden Wirkung verzehrt wird. Der Palmdieb als Frauenaufbrecher? Das wäre noch zu ertragen, gäbe es da nicht diese Plastikpalme, die ihre Farbe beständig wechselt und unter der der Erzähler wie unter Wiederholungszwang äußert, die von ihm begehrte Frau trage ihr Herz links, "wo es hingehört", und er "trage es viel zu weit oben, zu nahe am Kopf".
Dieser offenbar kopflastige, hauptamtlich unentschlossene Schwerenöter schwankt also zwischen zwei namenlosen Frauen, zwischen der verheirateten jungen Mutter, die ihren Mann, Robert, aber nicht verlassen will, und "der anderen", der Lebensbejahenden, die er sofort haben könnte - eine nicht uninteressante ménage à trois oder sogar quatre. Aber in diesem anonymen Theater ist der sprunghaften Handlung schwer zu folgen. Und warum ausgerechnet der betrogene Ehemann einzig beim Namen (Robert) genannt wird, bleibt bis zuletzt unklar. Klar wird lediglich, dass dieses amouröse Versteckspiel nicht lange durchgehalten werden kann. Den Schlachtplan entwerfen, unabhängig voneinander, die beiden Frauen. Es kommt zum Krieg der Geschlechter, bei dem gemetzelt und gemordet wird, mittendrin im Geschehen der zum Töten aufgestachelte Erzähler. Dass er in diesem Kampf nicht gewinnen kann, dämmert ihm - und dem Leser - nach seitenlangen, surreal anmutenden Kriegsszenen, als er, über das Schlachtfeld taumelnd, immer nur nach seinem Widersacher Robert sucht: "Ob sich Robert gar in mir verbarg?"
Also alles nur Kopfkino? "Böse Spiele", so merkt man schließlich, treibt hier nur einer, nämlich der Autor mit seinen Figuren und seinen Lesern. Zur Konturlosigkeit des Personals mag es passen, dass nahezu alles in indirekter Rede steht, die denn auch eine gewisse Sogwirkung entfaltet. Das aber hat man, in Verbindung mit einem überzeugenden Plot und mit psychologischer Tiefenschärfe erfassten Figuren, anderswo schon besser gelesen, etwa bei Andreas Maier. Stavarics Spiele sind dagegen zum Verzweifeln überambitioniert.
FRIEDERIKE REENTS
Michael Stavaric: "Böse Spiele". Roman. C. H. Beck Verlag, München 2009. 155 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Ein anstrengendes Buch hat Friederike Reents da lesen müssen. Mühsam findet Reents nicht nur die Bemühtheit Michael Stavarics um Verwirrung im Plot und Originalität im Bild, sondern ebenso die Handlung selbst, eine "menage a trois oder sogar quatre", die sich zum Geschlechterkrieg ausweitet, ohne dass es die Rezensentin vom Stuhl haut vor Überraschung. Ein Schwerenöter mag der wenig konturierte männliche Held des szenischen Romans sein, doch das "Böse Spiel" treibt für Reents der Autor - und zwar mit seinen Lesern. Da liest sie lieber Andreas Maier, der nicht nur die indirekte Rede als Stilmittel beherrscht, sondern auch die tiefenscharfe Plot- und Personenführung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH