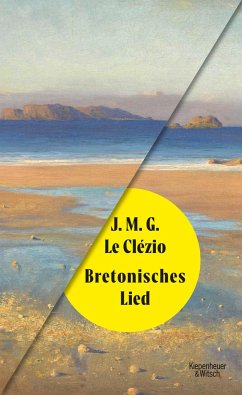Ein Lied der Erinnerung an eine Kindheit zwischen Meer und Krieg.
Der französische Nobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clézio erinnert sich in »Bretonisches Lied« an seine Kinder- und Jugendzeit. An die Urlaube mit der Familie in der Bretagne und in »Das Kind und der Krieg« an seine frühe Kindheit im besetzten Süden Frankreichs. Zwei eindrückliche autobiografische Erzählungen aus einem anderen Jahrhundert, die in Frankreich die Bestsellerlisten gestürmt haben.
Nostalgisch, aber nie sentimental, so erinnert sich J.M.G. Le Clézio an die Bretagne seiner Kindheit und Jugend. Von 1948 bis 1954 hat er hier mit seiner Familie die Sommerferien verbracht. In einem von berückender Schönheit, aber auch von großer Armut geprägten Landstrich. In poetischen Bildern beschreibt Le Clézio diesen Kindheitsort, die Feste, die Natur, die Sprache, aber auch die Veränderungen, denen die Bretagne immer wieder unterworfen und deren Zeuge er zum Teil war. »Es ist das Land, das mir die meisten Emotionen und Erinnerungen gebracht hat«, sagt der Nobelpreisträger über die Bretagne, die es so, wie er sie erlebt hat, nicht mehr gibt.
Doch Le Clézio begibt sich noch weiter auf seiner Reise in die eigene Vergangenheit. In »Das Kind und der Krieg« erzählt er von der Zeit zwischen 1940 und 1945, die er als kleines Kind erst in Nizza und später, als die Deutschen auch den Süden Frankreichs besetzt hatten, in einem Versteck im Hinterland erlebte. Hier vermischen sich die Eindrücke: Erlebtes, Geträumtes, Erzähltes. Alles wird miteinander verwoben zu einem berührenden, eindringlichen Porträt einer Kriegskindheit, deren Essenz leider auch heute noch gültig ist.
Der französische Nobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clézio erinnert sich in »Bretonisches Lied« an seine Kinder- und Jugendzeit. An die Urlaube mit der Familie in der Bretagne und in »Das Kind und der Krieg« an seine frühe Kindheit im besetzten Süden Frankreichs. Zwei eindrückliche autobiografische Erzählungen aus einem anderen Jahrhundert, die in Frankreich die Bestsellerlisten gestürmt haben.
Nostalgisch, aber nie sentimental, so erinnert sich J.M.G. Le Clézio an die Bretagne seiner Kindheit und Jugend. Von 1948 bis 1954 hat er hier mit seiner Familie die Sommerferien verbracht. In einem von berückender Schönheit, aber auch von großer Armut geprägten Landstrich. In poetischen Bildern beschreibt Le Clézio diesen Kindheitsort, die Feste, die Natur, die Sprache, aber auch die Veränderungen, denen die Bretagne immer wieder unterworfen und deren Zeuge er zum Teil war. »Es ist das Land, das mir die meisten Emotionen und Erinnerungen gebracht hat«, sagt der Nobelpreisträger über die Bretagne, die es so, wie er sie erlebt hat, nicht mehr gibt.
Doch Le Clézio begibt sich noch weiter auf seiner Reise in die eigene Vergangenheit. In »Das Kind und der Krieg« erzählt er von der Zeit zwischen 1940 und 1945, die er als kleines Kind erst in Nizza und später, als die Deutschen auch den Süden Frankreichs besetzt hatten, in einem Versteck im Hinterland erlebte. Hier vermischen sich die Eindrücke: Erlebtes, Geträumtes, Erzähltes. Alles wird miteinander verwoben zu einem berührenden, eindringlichen Porträt einer Kriegskindheit, deren Essenz leider auch heute noch gültig ist.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Zwei autobiografische Erzählungen, die bis in die Kindheit des Autors zurückgehen, hat Rezensent Niklas Bender in diesem Band gelesen: Einmal geht es um Sommerferien im bretonischen Sainte-Marine und dann um das Kriegsjahr 1943/44 in dem Gebirgsweiler Roquebillière. Beide Texte sind von Melancholie geprägt, so Bender. Aber Le Clézio gebe der Nostalgie keinen Raum. Vor allem die zweite Erzählung, die den Schrecken des Krieges aus der Perspektive eines Kindes festhält, hilft Bender, die exotischen Romane des Autors besser zu verstehen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Nie hat der Literaturnobelpreisträger J. M. G. Le Clézio so offen die Ursprünge seines Schreibens benannt
Die zwei autobiographischen Erzählungen, die J. M. G. Le Clézio unter dem Titel "Bretonisches Lied" vereint, sind ein typisches Alterswerk: Der 1940 geborene Romancier wendet sich seiner Kindheit zu, beschreibt die weit zurückliegenden und alles Spätere prägenden Erfahrungen. Bestenfalls gibt ein solches Spätwerk nicht nur Schriftstelleranekdoten preis, sondern enthält auch einen Schlüssel zum Werk. "Bretonisches Lied" macht dieses Angebot, indem bewusst oder unbewusst determinierende Erfahrungen beschrieben und ihre literarische Relevanz angedeutet werden.
Die zwei Texte sind von ganz unterschiedlicher Ton- und Machart. Der erste, wie der Band insgesamt "Bretonisches Lied" betitelt, beschwört im Küstenort Sainte-Marine (Finistère) verbrachte Kindheitssommer herauf; der Text ist nostalgisch gehalten, auch wenn er ebendas kritisch reflektiert. "Das Kind und der Krieg" hingegen widmet sich Mangel und Leid der Weltkriegsjahre 1943/44, die Le Clézio in Nizza und im Gebirgsweiler Roquebillière (Alpes-Maritimes) erlebt hat. Er legt eine bisher eher erahnte Perspektive auf jene Texte Le Clézios offen und fest, die sich mitunter in exotischem Wohlgefühl zu gefallen scheinen.
Sainte-Marine war in den Fünfzigerjahren ein Fischerdorf, an der Mündung des Flusses Odet gelegen. Bénodet am gegenüberliegenden Ufer hatte sich schon in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts zum mondänen Seebad entwickelt; Sainte-Marine blieb trotz der einen oder anderen Villa abseits. Erst 1972 änderte die Eröffnung des Pont de Cornouaille das endgültig: Die Brücke schloss das Dorf an die Präfektur Quimper und das nationale Straßennetz an. Diese Veränderungen reflektiert Le Clézio, für ihn ist die Brücke "das weithin sichtbare Zeichen des Wandels".
Ihn interessiert das frühere Sainte-Marine, wo er jedes Jahr "drei ideale Ferienmonate voller Freiheit und Abenteuer" verleben durfte, zusammen mit Bretonisch sprechenden Fischer- und Bauernlümmeln. Der Odet kam ihm "groß wie der Amazonasstrom vor, mit geheimnisvollen, im Nebel liegenden Ufern, strudelndem schwarzem Wasser und der Mündung ins offene Meer vor den Glénan-Inseln". Le Clézio erzählt von Angelabenteuern, den Mädchen Le Dour, Gottesdiensten, Fahrradtouren, Festen auf dem Schloss Le Cosquer und besonders der Ernte, der kollektiven Arbeit mit einer gigantischen Dreschmaschine, denn "wir konnten uns nicht diesem Fieber entziehen, dem Triumph des ländlichen Lebens, und wir empfanden etwas, das wir, wie mir scheint, in keinem Geschichts- oder Erdkundeunterricht hätten lernen können, etwas, das uns mit unserer weit zurückliegenden Vergangenheit verband (da unsere Familie, ehe sie nach Mauritius auswanderte, ganz der bäuerlichen Welt angehört hatte), und sogar darüber hinaus mit der Vergangenheit der Menschheit."
Schließlich stellt der Text eine Wurzelforschung dar: Die Familie Le Clézio stammt, so die Vermutung des Vaters, aus dem Weiler Le Cleuziou; ein bäuerlicher Ahn namens Alexis François verließ in den Revolutionswirren die Gegend und später das Land, um nach Mauritius auszuwandern. Die Kindheitserinnerung enthält eine mehr oder weniger phantastische Herkunftserzählung, aus der eine reale Zuneigung zu diesem ebenso eigensinnigen wie weltoffenen westlichen Ende Frankreichs entstanden ist.
Le Clézios Blick in den Rückspiegel sieht vor allem das, was verloren gegangen ist. Die Veränderung der Landschaft rückt in den Fokus, ebenso der Verlust der bretonischen Sprache. Der Autor kritisiert die französische Sprachpolitik, will aber nicht das Wirken eines bösen Zentralismus als Alleinschuldigen sehen: "Die Bretonen haben den Anreiz der Moderne mit der Scham verwechselt, die sie angesichts ihrer Herkunft empfanden, und das Erbe ihrer Vorväter mit der Angst gleichgesetzt, die Ewiggestrigen zu bleiben. Zugleich haben sie sich davor gefürchtet, wieder in die unsägliche Armut zurückzufallen, in der die Landbevölkerung teilweise seit Jahrhunderten überlebt hat und in der sie der Staat aus Furcht vor einer Identitätskrise gehalten hat." Die Argumentation ist gewunden und nicht ganz widerspruchsfrei, will es ob der komplexen Lage wohl nicht sein.
Ebenso relativiert Le Clézio die Veränderung der Landschaft, betont, dass die Flurbereinigung teils rückgängig gemacht worden sei. Er bekämpft die eigene Nostalgie - und damit den "Deklinismus" eines Richard Millet, mit dem er sich 2012 eine heftige Polemik geliefert hat: "Nostalgie ist kein erstrebenswertes Gefühl. Sie ist eine Schwäche, eine Verkrampfung, die Verbitterung hervorruft. Dieses Unvermögen hindert einen daran, zu sehen, was wirklich existiert, und wirft einen auf die Vergangenheit zurück, wo doch die Gegenwart die einzige Wahrheit darstellt." "Bretonisches Lied" schwelgt nicht nur in einer Kindheitsbretagne, sondern klärt auch Le Clézios Standpunkt, historisch, erinnerungspolitisch, literarisch.
Die zweite kürzere Erzählung über die Kriegsjahre bringt eine Erfahrung zur ausführlichen Darstellung, die den Autor oft umgetrieben hat, meist am Anfang von oder in Prologen zu Texten (etwa "Fliehender Stern" oder "Ourania"). In seiner Rede zum Literaturnobelpreis 2008 hatte Le Clézio festgehalten: "Wenn ich die Umstände näher betrachte, die mich dazu veranlasst haben zu schreiben - ich tue das nicht aus Eitelkeit, sondern weil ich um Genauigkeit bemüht bin -, dann muss ich feststellen, dass für mich der Krieg den Ausgangspunkt bildet." Und zwar, so präzisiert er, nicht der heroische Krieg, sondern der traumatisierende, den Kinder erleiden. Dieser Krieg meint Bombenangriffe, wie jener, der ihn im Badezimmer überrascht und ihm einen Schrei des Entsetzens entreißt: "Er bildet ein Ganzes mit meinem Körper. Mein Körper schreit, nicht meine Kehle." Meist jedoch meint er schlicht Hunger: "Kein Magenknurren, sondern eine Leere mitten im Leib, die ganze Zeit, in jedem Augenblick, eine Leere, die nichts füllen, nichts sättigen kann." Hinzu kommt ein Mangel, den der Kleine nicht verstehen kann: die Abwesenheit des ihm unbekannten Vaters, der die Familie erst nach dem Krieg wiedersieht. Le Clézio fragt sich beständig, welche der Prägungen bewusst, welche untergründig war.
Die literarische Pointe ist, dass nicht nur das bedrückende Frühwerk, das Camus nahezustehen scheint, im Schatten des Krieges steht. Gerade die exotischen Texte, vornweg jene über Afrika, sind vor dieser Folie zu verstehen: "Als wir in Afrika ankamen, waren mein Bruder und ich zwei bleiche, ungebildete Jungen, erfüllt von Wut und Ungehorsam." Und: "Afrika sollte uns zivilisieren." Die Herkunft dieser Perspektive auf Europa und Übersee ist es, die "Das Kind und der Krieg" deutlicher als frühere Einlassungen offenlegt und reflektiert. Einerseits nimmt sie manchen Romanen im Nachhinein Exuberanz und Pathos; andererseits verleiht sie ihnen eine bescheidenere, aber eindringlichere Farbigkeit.
NIKLAS BENDER
J. M. G. Le Clézio: "Bretonisches Lied". Zwei Erzählungen.
Aus dem Französischen von Uli Wittmann. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022. 190 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Die beiden Erzählungen sind wunderbare Lebenserinnerungen, beeindrucken in ihrer Offenheit, eindrücklich und auch überraschend emotional.« Martin Wasser Die Märkische Bücherschau 20220705