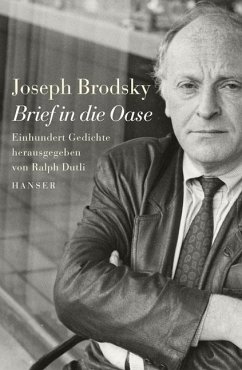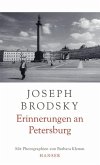Die umfangreichste Auswahl von Gedichten des russischen Nobelpreisträgers in deutscher Sprache. Joseph Brodsky war ein Dichter vielfältiger Masken und Metamorphosen, ein russischer Odysseus und vom Tod besessener Ironiker, ein Liebeselegiker, Exilant und Erforscher der Zeit, ein eingefleischter Skeptiker und energischer Verteidiger von Wert und Würde der Poesie. Mit diesem vorbildlich übersetzten Durchgang durch sein Werk erschließt sich erstmals der phänomenale Facettenreichtum des unvergessenen Lyrikers.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ruhige Monumentalität: Eine Auswahl aus dem lyrischen Werk von Joseph Brodsky / Von Hans Ulrich Gumbrecht
Am schönsten sind Joseph Brodskys Gedichte und ihrer selbst am sichersten, wenn sie Momente der Liebe beschwören, Orte und Dinge. Bei der Lektüre der neuen, Brodskys Lebenswerk in deutschen Übersetzungen umspannenden Anthologie "Brief in die Oase" beginnt man zu ahnen, wie es der 1940 geborene russische Lyriker, der 1987 mit dem Nobelpreis geehrt wurde, wagen konnte, sich dem Druck der eigenen Forderung auszusetzen, daß im Schaffen von Gedichten die höchste Bestimmung des Menschseins zu erreichen sei.
Natürlich ist unser erster, ein literarisches Urteil erst vorbereitender Eindruck über Brodskys Texte in doppelter Hinsicht prekär. Zum einen, weil Lyrikübersetzungen ja das verlieren müssen, was Gedichte vor allem ausmacht, nämlich den zu besonderem Ton geformten Klang einer bestimmten Sprache. Doch die Texte des von Ralph Dutli betreuten Bandes belegen, daß es nun einen Ton für diesen Dichter im Deutschen gibt, der es mit den Tönen der großen deutschen Dichter aufnehmen kann. Zum zweiten wirkt eine solch spontane Reaktion auf Gedichte prekär, weil sie zeigt, wie auch das überlegteste Urteil von individuellen Primäreindrücken abhängt. Dies freilich, wissen wir seit Kants "Kritik der Urteilskraft", gilt für ästhetisches Urteilen schlechthin, weil hier an die Stelle objektiver Kriterien und Grundlagen der Wertung eine Besonderheit des subjektiven Geschmacks tritt, die darin liegt, allgemeine Bestimmung zu "erheischen".
Deshalb eben kann man sich nur schwer einen Leser vorstellen, der nicht berührt wäre vom Auftakt des Liebesgedichts "Prophezeihung", das Brodsky 1965 in der Verbannung eines sowjetischen Arbeitslagers schrieb: "Wir werden, du und ich, am Ufer leben, / durch einen aufgehäuften Damm getrennt / vom Kontinent, den kleinen Kreis umhegen / den eine simple Lampe uns erhellt." Der Rhythmus dieses Satzes füllt gelassen die Form der Verse, während Assonanzen und Binnenreime den Wörtern einen Klang von Freude geben. Es ist die ruhige Freude einer Hoffnung auf Glück, und dieses Glück der Zukunft soll das Glück des einfachen Lebens sein: "In unserem Holland, grade umgekehrt / pflanzen wir beide ein Gemüsebeet / und werden vor der Türe Austern braten / und nähren uns von Sonnenkraken."
Die Zukunft dieses Glücks mag ein Kind sein, und so wird dann in der Kinderstimme die Zukunft der Elternsprache klingen: "Und wenn uns einmal auch ein Kind gelingt / soll es Andrej oder dann Anna heißen. / Damit, ans faltige Gesichtchen angelehnt / nicht mehr vergessen geht das russische Alphabet, / der Anfangslaut vom Ausatmen gedehnt & prächtig / wird so in Zukunft noch bekräftigt."
Eher als die seit zweihundert Jahren in der Literatur übliche Begegnung und Vereinigung von ekstatischen Seelen, die durch ihre Körper einander Gefühle "ausdrücken", erscheint Liebe in den Gedichten Brodskys als die Gestalt konturierter Gegenstände. In "Sechs Jahre später" hat sich die "Prophezeihung" in eine etwas fahrige Gewohnheit verwandelt: "So fremd war beiden alles Neue daß / an den Umarmungen im Schlaf schon fast / die Psychoanalyse sich abhanden / kam." Und als die Liebenden "längst nicht mehr zusammen leben", tritt an die Stelle der Geliebten ein Traum: "du seist schwanger, und meine Hände, die freudig nach dem runden Leib sich streckten." 1995, im Jahr vor seinem Tod und in die Vereinigten Staaten ausgewandert, schrieb Joseph Brodsky in englischer Sprache einen "Love Song", wo sich noch einmal Szenen liebender Begegnung zu Formen von erotischer Substanz konkretisieren: "Bin ich ein Sergeant ich schwörs du wärst ganz gerne / mein Rekrut und oh boy! Würdest lieben den Drill."
Brodskys Gedichte haben keine Resonanz für die dumpfe Lautheit von Klagen oder die schrillen Töne der Polemik. Wenn er, der Sohn einer jüdischen Familie, über die Stadt München schreibt , dann geht ihre nationalsozialistische Geschichte in die Form des lyrischen Gegenstands ein, wie ein Widerhaken vielleicht: "In dem Städtchen, von dem einstmals der Tod über sämtliche Karten / sich verbreitete, glänzt jetzt das Straßenpflaster wie ein Karpfen; / der Kastanienbaum, läßt erneut seine Stinkkerzen schwellen, / und der eherne Löwe hungert nach feurigen Phrasen.""Lebendig begraben" im Arbeitslager, fühlt er, protestlos, "fast schon keinen Schmerz mehr". Er ist "fast taub, O Gott, fast blind", und der Körper wird von der brutalen Natur zu einem Teil ihrer selbst verschlissen, der nicht mehr spricht, sondern nur noch - onomatopoetisch - Geräusche absondert: "So klatsch und gluckse, kau die Brücke, angefault. / Mag um den Friedhof her das Wassermaul / die Farbe aus den Kreuzen saugen."
Wie sich Liebespaare von der Welt abschließen, wenn sie eins werden, schottet sich das individuelle Leben gegen sowjetischen Alltag ab in klaustrophiler Einheit mit den Gegenständen des Zimmers: "Sei kein Idiot! Sei das, was die andern nie waren, nie im Leben. / Geh nicht aus dem Zimmer! Gib dich einzig den Möbeln / hin, verschmelz mit den Tapeten." Mit den Dingen verschmelzen, das ist Flucht aus einem Alltag, der sich "bloß dank Schrauben und Bolzen wie reizend" erhält. Aber die Fusion mit "der hermetischen Dichte der Dinge" ist auch Erlösung. So sehr, daß die Einheit der Liebe sich auflöst, "wenn einer nicht versteht, / sich selbst anstelle der gesamten Welt / zu setzen". Denn sich anstelle der gesamten Welt zu setzen, Gegenstand in der materiellen Welt zu sein, enthält das Versprechen, daß man der Duplizität und Ungewißheit der menschlichen Existenz entgehen kann.
In Brodskys Welt besteht die menschliche Möglichkeit einer Einheit mit der Substanz der Dinge: "Dinge sind besser. In ihnen / gibt's weder Gut noch Böse / äußerlich. Und eindringend - / auch inwendiges Wesen." Gerade die Sehnsucht nach der Auflösung der Identität im Verschmelzen mit gestaltloser Substanz wird zum lyrischen Gegenstand und zur Hoffnung.
Existentiell gesehen, sind Kinder jene Wirklichkeit, durch die individuelles Dasein über die Liebe des Paars eingeht in die Substanz der Welt. Ob solche Substanz lebendig ist oder unbelebte Materie, sagt Christus seiner Mutter am Ende des Gedichts "Nature morte", macht keinen Unterschied: "Tot oder lebendig sein, / Weib, da ist kein Unterschied. / Sohn oder Gott: ich bin dein." Und noch viel weniger, könnte man hinzufügen, macht es für Lyrik von solcher Qualität einen Unterschied, ob die von ihr als Substanz gegenwärtig gemachte Liebe der heute dominierenden Mode von leichtfüßig "individuellen Lebensentwürfen" entspricht. In der Tradition der europäischen Lyrik, die Brodsky lebenslang mit kenntnisreicher Leidenschaft bewohnte, ist solche Sehnsucht nach dem Einssein mit Substanz keinesfalls exzentrisch, und deshalb sind langfristig gesehen seine gelegentlichen Referenzen auf die christliche Mythologie eher eine Zufälligkeit der Textoberfläche. Denn es geht bei Brodsky um Substanz und Erlösung schlechthin, nicht um eine spezifisch christliche Fassung dieser Dimension. Ein anderer großer Dichter des zwanzigsten Jahrhunderts, in dessen Texten das Verlangen nach dem Einswerden mit der materiellen Substanz des Alltags - einseitiger als bei Brodsky - zu einer Sehnsucht nach dem Tod wurde, ist Federico García Lorca. In seiner "Klage auf den Tod des Stierkämpfers Ignacio Sánchez" etwa wird der "steingewordene Leichnam" des Freundes als Apotheose kosmischer Schönheit besungen.
Doch schon die Gegenwart eines jeden Gedichtes selbst, das ist der Kern der Tradition, in die sich Brodsky einschreibt, nimmt als Einheit aus der Substanz des Klangs und der Form von Wörtern und Sätzen das Einswerden des Daseins mit der Substanz der Welt vorweg. Gedichte sind Gegenstände. Und an jedem Neuanfang dieser Tradition, in den Liedern der Sappho an ihre Geliebten und in den Hymnen des Pindar auf olympische Sieger, in den Strophen der Troubadours an ferne Damen und in Villons "Testament", in Baudelaires Gedicht "An eine Passantin" und in Apollinaires "Lundi Rue Christine" ereignet sich zugleich mit der Metamorphose des Textes zum Gegenstand das Heraufbeschwören von abwesenden Körpern und Dingen. Jeder Neuanfang der lyrischen Tradition verleibt sich auch noch einmal die Substanz der konkreten Dinge ein. Der Raum aber, in dem der Klang des Gedichts Abwesendes gegenwärtig macht, ist genau der Raum, den die Töne der Lyrik erfüllen, solange sie "Lyrik" ist, weil sie Klang hat. Es ist andererseits der Raum, den sie verspielt, wenn sie sich zur "Gedankenlyrik" verdünnt.
Schließlich ist es der Raum, den starke Dichter wie Brodsky immer wieder zurückerobert haben. Die "Große Elegie an John Donne", ein frühes Gedicht auf einen seiner Helden aus der lyrischen Tradition, setzt ein mit einer Beschreibung der Welt, die den Schlaf des Dichters umgibt. Sie wird aufgerufen als eine Anhäufung einzeln benannter Dinge: "Nacht überall: in Ecken, Augen, Rock, / im Schreibtischfach, in Rechnungen, Papieren, / in Predigt, Kohlenzange, Kohle, Holz, / im schwelenden Kamin, in allen Dingen."
Über die fast vier Jahrzehnte, in denen sein Werk entstanden ist, blieb der Ton von Brodskys Gedichten konzentriert und gelassen. Seine Gelassenheit schloß eine Agilität ein, die er oft den umgangssprachlich fallengelassenen Adverbien abgewann: "Dieses Leben in der Epoche der Vollendungen macht's / dem Gemüt leider schwer", heißt es in einem Gedicht aus den späten sechziger Jahren über das Leben in der Sowjetunion, und das Wort "leider" durchsetzt mit fast ironischem Mitleid eine Beschreibung, die sich sonst bloß lähmend über den Leser gelegt hätte. Im "Wiegenlied von Cape Cod", dem sechs Jahre später entstandenen Gesang auf die Ostküste der Vereinigten Staaten, wird das andere Imperium dann nicht etwa als rettendes Exil gepriesen, sondern kommt mit demselben Ton von Gelassenheit in den Blick: "Teilnahmslos schwarz / der Turm samt Kreuz, wie die auf dem Tisch vergessene Flasche. / Aus dem Streifenwagen der im Ödland glänzend dasteht / klirren die Tasten von Ray Charles." Auch Cape Cod, der östlichste Teil des nordamerikanischen Festlands, erscheint als eine Welt der Dinge, in die man sich versenken kann. Nicht anders als das Arbeitslager und nicht anders als das Zimmer in Leningrad ist die schwüle Ferienlandschaft ein Ort, um "sich ans Ding zu gewöhnen". Die "Behaglichkeit des / Paradieses" kommt nur für einen Augenblick zur Sprache. Sie läßt, schreibt Brodsky, "schweigen die Uhren".
Denn die historische Zeit und die existentielle Zeit bewegen sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam in diesen Gedichten, die oft auf ein genaues Datum oder auf einen Gedenktag festgeschrieben sind. Wie die Landschaft und die Gebäude von Cape Cod in den Gemälden von Edward Hopper, die ruhige Monumentalität ausstrahlen, weil sie Momente des Übergangs in den Tageszeiten stillegen, macht der gelassene Ton von Joseph Brodskys Gedichten die Stimmung dieses Raums zu einem ruhenden Gegenstand. Einer seiner Freunde sagte, es sei ihm gewesen, als ob er "ein Organ verlöre", als der Dichter am 28. Januar 1996 starb.
Joseph Brodsky: "Brief in die Oase". Hundert Gedichte. Übertragen von Ralph Dutli, Felix Ingold, Alexander Kaempfe, Heinrich Ost, Sylvia List, Raoul Schrott, Birgit Veit. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Ralph Dutli. Hanser Verlag, München 2006. 304 S., geb., 23,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Dass es nun im Deutschen "einen Ton für diesen Dichter" gibt - dieser Satz von Hans Ulrich Gumbrecht dürfte den Übersetzern vorliegender Lyrik-Auswahl aus dem Werk Joseph Brodskys angenehm in den Ohren klingen. Gumbrecht selbst indessen klingen die Ohren vom konzentrierten wie gelassenen Ton dieser Lyrik, die ihn nicht weniger als die Möglichkeit des "Einsseins mit Substanz" hat schauen lassen. Historische und existentielle Zeit spielt laut Gumbrecht dabei kaum eine Rolle, und die Schauplätze der Gedichte - Cape Cod, ein sowjetisches Arbeitslager, ein Zimmer in Leningrad - sieht er zurückgenommen hinter dem Raum, "in dem der Klang des Gedichts Abwesendes gegenwärtig macht". Für Brodsky war die höchste Bestimmung des Menschseins im Schaffen von Gedichten zu erreichen - eine Überlegung, für die der Rezensent nach dieser Lektüre mehr Verständnis hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Am schönsten sind Joseph Brodskys Gedichte und ihrer selbst am sichersten, wenn sie Momente der Liebe beschwören, Orte und Dinge. Bei der Lektüre der neuen, Brodskys Lebenswerk in deutschen Übersetzungen umspannenden Anthologie "Brief in die Oase" beginnt man zu ahnen, wie es der 1940 geborene russische Lyriker, der 1987 mit dem Nobelpreis geehrt wurde, wagen konnte, sich dem Druck der eigenen Forderung auszusetzen, daß im Schaffen von Gedichten die höchste Bestimmung des Menschseins zu erreichen sei. ... die Texte des von Ralph Dutli betreuten Bandes belegen, daß es nun einen Ton für diesen Dichter im Deutschen gibt, der es mit den Tönen der großen deutschen Dichter aufnehmen kann." Hans Ulrich Gumbrecht, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.03.06 "Die umfangreiche Gedichtauswahl - nun zum zehnten Todestag des Dichters erschienen -, ist eine tolle Sache und war schon lange fällig. ...Wer also will, kann zugreifen und den intellektuellen und sinnlichen Abenteuern eines der größten Lyriker des 20. Jahrhunderts folgen." Olga Martynova, Die Zeit, 12.04.06 "Es handelt sich um ein famoses Buch, sogar für jene, die von Dichtung ohnehin abhängig sind. Denn es vergrößert den bisherigen Radius um Josef Brodsky. Und für alle anderen könnte es die bestmögliche Hausfibel zum Vermögen der Lyrik des 20. Jahrhunderts sein." Hauke Hückstädt, Frankfurter Rundschau, 22.03.06 "Wer Brodskys Lyrik in Dutlis kongenialer Übertragung liest, taucht in eine poetische Sprachwelt ein, die den Sinn nicht auf den Begriff reduziert, sondern eine eigene Lautwahrheit begründet." Ulrich M. Schmid, Neue Zürcher Zeitung, 15./16.04.06 "Brodskys Gedichte sind reinste Herzschläge, die vom Leben zeugen, indem sie den Tod nachahmen." Anastasia Telaak, Jüdische Allgemeine, 16.03.06