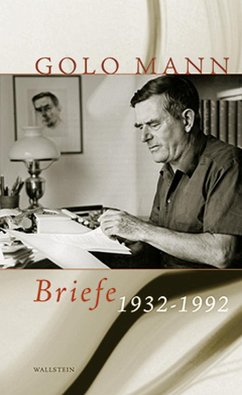Golo Mann korrespondierte in den Jahren zwischen 1932 und 1992 mit Freunden und Gegnern, Künstlern, Publizisten und Politikern - unter ihnen Karl Jaspers, Benjamin Britten, Willy Brandt, Ernst Jünger, Marion Gräfin Dönhoff, Joachim Fest, Klaus und Heinrich Mann -, aber auch unbekannten Zeitgenossen, die sich ratsuchend an ihn wandten.Die in diesem Band ungekürzt wiedergegebenen und erstmals gedruckten 172 Briefe handeln von Geschichte, Literatur und Politik, zeigen das gespannte Verhältnis des Emigranten zur alten Heimat, sprechen von Liebe und Tod, Einsamkeit und immer wieder vom Vater und der Sehnsucht danach, Schriftsteller zu sein. Von sich selbst und seiner Homosexualität allerdings dürfe er nicht dichten, vertraute Golo Mann einem Freund an, »weil mein Vater dies Pferd ziemlich müde geritten hat«.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Bekenntnisse eines Unzeitgemäßen: Golo Manns Briefe
Der Freundin Marion Gräfin Dönhoff schrieb Golo Mann, er passe nicht recht in das Jahrhundert, hätte früher leben sollen, etwa als "Hauslehrer oder Bibliothekar" bei einem ihrer Vorfahren - "gerne hätte ich mich mit dem Platz am untersten Ende des Tisches begnügt, geborener Untertan, der ich bin."
Dieser Briefband, umsichtig kommentiert und herausgegeben von Kathrin Lüssi und Tilmann Lahme, präsentiert einen großen Briefschreiber. Und er entfaltet ein breites, persönlich lebendiges Panorama der wahrlich nicht ereignisarmen sechzig Jahre, die diese aus Tausenden ausgewählten 172 Briefe umfassen. Schließlich verändert er auch das Bild von Golo Mann, das Jeroen Koch und, erheblich intensiver, Urs Bitterli gezeichnet haben. So darf man auch auf die im Klappentext angekündigte Biographie Tilmann Lahmes gespannt sein.
Golo Manns Name ist keineswegs verblaßt. Nur geht es ihm, in den Worten Schillers, ein wenig wie seinem Helden Wallenstein: "Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, Schwankt sein Charakterbild" - dies nun nicht geradezu "in der Geschichte", aber in der Erinnerung. Die einen sehen in ihm vor allem den gewissermaßen Linken, den gedanklichen Vorbereiter der Ostpolitik Brandts und Bahrs (da war in der Tat sonst eigentlich nur Rudolf Augstein). Andere, die Altachtundsechziger und andere Linke, erinnern sich nur noch und mit erheblichem Groll an den, der nach anfänglicher Sympathie dezidiert gegen die rebellierenden Studenten auftrat ("Hört auf, Lenin zu spielen!") und sich dann gar für Franz Josef Strauß einsetzte.
Große und bis heute anhaltende Wirkung, stärker als jedes andere Buch dieser Art, hatte seine "Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts", die 1958 erschien. Sie war sein Durchbruch, denn bis dahin war er fast unbekannt. In demselben Jahr kehrte er auch definitiv aus Amerika zurück; da war er schon fast fünfzig. Auch die von ihm mitherausgegebene "Propyläen Weltgeschichte" (1960 bis 1965), dann vor allem sein "Wallenstein" (1971) und die "Erinnerungen und Gedanken" (1986) waren bedeutende Erfolge.
Golo Mann war auch ein großer literarischer, historischer und politischer Essayist und wurde rasch ein vielgefragter, sich dabei allerdings verzettelnder Redner. Am Ende war er beinahe etwas wie der "Praeceptor Germaniae". Als ihn jedoch ein Interview-Partner im Fernsehen so nannte, verwahrte er sich entrüstet: "Ich verbitte mir diese Bezeichnung!"
Was zeichnet diese Briefe aus? Da ist zunächst der bestrickende, etwas altertümliche Stil, in dem Golo Mann aber ganz unmittelbar als er selber hervortritt, denn er stilisiert sich nicht. Ernsthaft, vornehm, offen, oft sehr direkt, hart zuweilen, ganz unabhängig, ganz frei in seinem Urteil, unideologisch - er war gegen die neuen Linken, aber die alten Rechten mochte er noch weniger. Dann ist er bemerkenswert uneitel und unpompös. Obwohl er schon wußte, wer er war, durchschaute er sich, auch gerade in seinen Schwächen, zu denen übrigens auch etwas Nachtragendes gehörte, etwas, das durchaus in Richtung Alberich ging. Er vergaß ungern.
Und vor allem ist da die schöne Mischung aus Melancholie und Humor, bei der man oft nicht weiß, welche beider Komponenten stärker ist. Wenn er etwa 1955 in dem Dankesbrief für das Kondolenzschreiben seines Lehrers Karl Jaspers zum Tod des Vaters schreibt: "Seinen Goethe läßt er einmal seine Schwester sein ,Weibliches Neben-Ich' nennen; ich war etwas wie sein Unter-Ich, und eine Basis für ein vertrauliches, entspanntes Verhältnis konnte das, bei seiner gewaltigen und meiner um so vieles geringeren Persönlichkeit, nicht abgeben. Nun er nicht mehr ist, liegt das natürlich anders."
Das ist gewiß melancholisch, und man kann wohl über das "Unter-Ich" etwas erschrecken, aber Humor, der ja immer mit Realismus zu schaffen hat, liegt darin doch auch. Und dann wird er gleich wegen einer seltsamen Taktlosigkeit von Jaspers beinahe aggressiv: "Die ,Betrachtungen eines Unpolitischen' hätten Sie kaum zu erwähnen brauchen. Es irrt der Mensch, solang er strebt, und die Bedeutendsten am bedeutendsten. Ihr Max Weber ist, glaube ich, einmal Mitglied des Alldeutschen Verbandes gewesen. Bei uns hier hat seit dreißig Jahren niemand an die Gültigkeit - wohl aber an das tiefe historische Interesse - der ,Betrachtungen' geglaubt." Bei uns hier - das ist nun die Familie, "diese verfluchte Familie", wie er in einem anderen Brief, an den Rezensenten, sehr viel später, 1977, schreibt. Da ging es um den Tod des Bruders Michael: "Sehr begabter Mensch, generös, mutig, Draufgänger, also sehr anders als andere." Ein "Draufgänger" war Golo Mann wirklich nicht. Aber auch in diesem Satz sind Melancholie und Humor schwer entwirrbar beieinander.
Die Adressaten sind sehr verschieden. Da sind öffentliche Personen: Adenauer, Brandt, Bahr, Hans-Jochen Vogel, dem er zwar Vorhaltungen macht (wegen des Linksrucks seiner Partei), für den er jedoch unter den Politikern besondere Hochachtung hatte. Stoiber, damals Generalsekretär der CSU, muß sich einiges anhören zu seiner Verlautbarung, der Nationalsozialismus sei im wesentlichen Sozialismus gewesen: "Hitler einen Marxisten zu nennen, ist nun wirklich die äußerste Narretei!"
Sehr aufschlußreich, prophetisch beinahe der lange Brief zur Ostpolitik an den vormaligen Minister Theodor Oberländer; dann Joachim Fest, den er schätzte, aber mit gewissem Widerstand, und der ihn seinerseits in seinen "Begegnungen" doch wohl verzeichnet hat (Golo Mann, dies zeigen gerade diese Briefe, war keineswegs immer so angespannt und grimmig, wie Fest ihn erfuhr); dann Ernst Jünger, den er persönlich mochte und mehrmals besuchte, oder Verleger Ernst Klett, der sie zusammenbrachte, oder der Jugendfreund Pierre Bertaux.
Leider gingen viele, vor allem frühe Briefe verloren, schon in der Emigration, aber auch noch nach seinem Tod - besonders jene an die Familie: an den Vater, die Mutter (da ist nur ein versprengter Brief von 1932 des Heidelberger Studenten), an Klaus, mit dem er sich immer gut verstand und über den er auch bewegend geschrieben hat (nur zwei Briefe sind erhalten). Um so wichtiger die Briefe an Onkel Heinrich und an die frühe Freundin Lise Bauer, Mitschülerin in Salem, die ihn mochte. Dann an Erich von Kahler, Joseph Breitbach, an den Schweizer Journalisten und, sagen wir, Lebemann Manuel Gasser, später an die geliebte Freundin Margaret von Hessen ("Peg"), deren Schloß Wolfsgarten bei Darmstadt ihm zu einem emotionalen Zentrum wurde, oder an den Franzosen Adolphe Dahringer, einen Freund aus den alten Tagen in St.-Cloud, 1933, später Germanist in Nantes, der ihm dort zu seiner Freude einen Ehrendoktor verschaffte, was übrigens keine deutsche Fakultät getan hat; Dahringer verstarb im vergangenen Sommer.
Wie immer man diese Briefe liest, durcheinander oder, besser, nacheinander von Anfang an - es ist, so oder so, eine wunderbare, informierende und bewegende Lektüre. Der schönste Brief ist ohne Zweifel der vom August 1989 an Julio del Val Caturla, den er "Polo" oder "Polito" nannte ("Bruder Polito"), ein Freund aus der Salemer Zeit und übrigens für Thomas Mann die ,Vorlage' seines "Jungen Joseph".
Da geht es um den Tod. Im Postskriptum (Golo Mann liebte Postskripta, zuweilen gibt es deren drei), schreibt er: "Wer sich sein reifes Leben lang Mühe gab, wer Freude für sich und Andere suchte, wer mit angeborenen Schwächen so weit wie möglich zurechtkam, wer seine Talente nicht brach liegen ließ, wer an Treue glaubte und sie übte, wer half, wo er helfen konnte und helfen Sinn hatte, wer einmal dies glaubte und einmal das, weil er eben ein Mensch und kein Engel war - was sollte der vom Tode fürchten?"
HANS-MARTIN GAUGER
Golo Mann: "Briefe 1932 - 1992". Veröffentlichungen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt. Hrsg. von Tilmann Lahme und Kathrin Lüssi. Wallstein Verlag, Göttingen 2006. 535 S., 32 Abb., geb., 32,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Uneingeschränktes Glück hat der Band dem Rezensenten beschert. Ein Füllhorn menschlicher Schönheit und Geisteskraft erkennt Gustav Seibt in diesem Vermächtnis "eines der letzten großen Briefeschreiber". Die Sorgfalt der Kommentierung macht den Band für ihn zur "tragenden Säule" im Lebenswerk Golo Manns. Die aus einer Riesenmenge ausgewählten Briefe selber muten dem Rezensenten wie ein Naturwunder an: Ungeschliffen, geprägt von Wahrhaftigkeit und Ungebundenheit. Moralische Kritik an öffentlichen Figuren wie Joachim Fest oder Edmund Stoiber gesteht Seibt dem Autor darum gerne zu. Sichtlich beeindruckt stellt er die Vitalität und Unvoreingenommenheit Manns auch bei der positiven Beurteilung von Zeitgenossen wie Joseph Breitenbach fest (dessen Bücher er sich am liebsten gleich bestellen möchte) und staunt über die "vollkommene Uneitelkeit" des Autors beim Blick auf die eigene, familiär "vorbelastete" Identität. Laut Rezensent berichtigt der Band das "aseptische" Bild Golo Manns, das Urs Bitterlis Biografie entwirft: Der Briefeschreiber Golo Mann erscheint ihm als lustvoll selbstironischer Mensch.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH