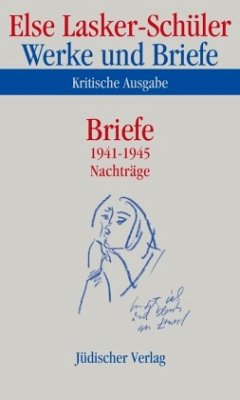In insgesamt sechs Bänden werden in der Kritischen Ausgabe zum ersten Mal sämtliche überlieferten Briefe Else Lasker-Schülers vollständig und mit Anmerkungen versehen veröffentlicht. Sie dokumentieren den Lebensweg der jüdischen Dichterin vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis in ihre Zürcher und Jerusalemer Exiljahre und geben neuen Einblick in ihr Leben und Werk.
Der vorliegende sechste Band enthält über 680 Briefe aus den Jahren 1941 bis 1945, die zum großen Teil erstmals publiziert werden. Adressaten sind u. a. Samuel Josef Agnon, Schalom Ben-Chorin, Martin Buber, Friedrich Sally und Sina Grosshut, Werner Kraft, Ernst Simon, Kurt Wilhelm.
In Jerusalem, dem Zufluchtsort ihrer letzten Lebensjahre, in dem sie nicht heimisch wird, schreibt Else Lasker-Schüler Anfang der vierziger Jahre das Schauspiel IchundIch, hier erscheint im Sommer 1943 ihr Gedichtband Mein blaues Klavier, hier gründet sie den Vortragszirkel "Der Kraal". Else Lasker-Schülers Briefe legen Zeugnis ab von der Bedrängnis jener Zeit, aber auch von ihrem Bemühen, dieser bis zuletzt standzuhalten.Die Nachträge versammeln zusätzlich 200 Briefe aus früheren Jahren, die erst seit kurzem für eine Veröffentlichung zur Verfügung stehen.
Der vorliegende sechste Band enthält über 680 Briefe aus den Jahren 1941 bis 1945, die zum großen Teil erstmals publiziert werden. Adressaten sind u. a. Samuel Josef Agnon, Schalom Ben-Chorin, Martin Buber, Friedrich Sally und Sina Grosshut, Werner Kraft, Ernst Simon, Kurt Wilhelm.
In Jerusalem, dem Zufluchtsort ihrer letzten Lebensjahre, in dem sie nicht heimisch wird, schreibt Else Lasker-Schüler Anfang der vierziger Jahre das Schauspiel IchundIch, hier erscheint im Sommer 1943 ihr Gedichtband Mein blaues Klavier, hier gründet sie den Vortragszirkel "Der Kraal". Else Lasker-Schülers Briefe legen Zeugnis ab von der Bedrängnis jener Zeit, aber auch von ihrem Bemühen, dieser bis zuletzt standzuhalten.Die Nachträge versammeln zusätzlich 200 Briefe aus früheren Jahren, die erst seit kurzem für eine Veröffentlichung zur Verfügung stehen.

Die Flucht, das Sterben und die Einsamkeit des blauen Jaguars in Palästina: Else Lasker-Schülers letzte Briefe
Schon in jungen Jahren ist der Schrecken des Verlustes der Heimat, die totale Entwurzelung eine verstörende Erfahrung. Um wie vieles schmerzender, bitterer aber wird sie, wenn man alt ist, krank und um alles betteln muss, wenn man überall nur geduldet ist und jeder Zeit verscheucht werden kann. So erging es Else Lasker-Schüler, die, nachdem sie von einer Gruppe junger Nazis in Berlin tätlich angegriffen worden war, im April 1933 in die Schweiz floh, da war sie 64 Jahre alt.
"Es ist der Tag in Nebel völlig eingehüllt, / Entseelt begegnen alle Welten sich", heißt es in ihrem Emigrationsgedicht "Die Verscheuchte". "Wo weilt der Odem, der aus meinem Leben wich? - / Ich streife heimatlos . . . ein Bündel Wegerich." Jetzt, sechs Jahre später, hat es sie weitergeweht, nach Jerusalem, vor die nächste nur einen Spalt geöffnete Tür. Während ihres dritten Aufenthaltes dort bricht der Krieg aus, der zum Weltkrieg wird, und so wird die auf einige Monate geplante Fahrt zu einer Reise ohne Rückkehr. Denn die Schweizer Behörden sind entschlossen, die "Petentin" von ihrem Land "fernzuhalten", lassen die aus Deutschland ausgebürgerte Dichterin nicht mehr einreisen - aus "vorsorglich armenpolizeilichen Gründen". Dabei findet Else Lasker-Schüler doch immer wieder Fürsprecher und Unterstützer, müsste nicht von der Allgemeinheit alimentiert werden, brauchte nur eine Aufenthaltserlaubnis und das Recht, ihrer Arbeit nachgehen zu dürfen. Doch das ist der Schweiz schon zu viel.
Nachts an fremden Wänden
Also Palästina, Jerusalem. Noch einmal sechs Jahre, die Dichterin ist nun siebzig, eine alte Frau, die alles verloren hat, Familie, Freunde, das "Romanische Café", ihre Heimat, ihren Sprachraum - aber, man mag es kaum glauben, nicht ihr Herz, nicht ihre Dichtung. Beides schlägt, untrennbar, in allem, was sie sagt und tut, und natürlich auch in ihren Briefen, die oft nur kurze Mitteilungen, ein paar schnell auf einen Umschlag geschriebene Wörter sind, mit ein paar Buntstiftsternen und dem Jussuf-Kopf versehen, ihrem Alter Ego, dem aus der "Nacht" der "tiefsten Not" geborenen Prinzen, dem Träumedeuter und Vertrauten des Pharao, dem Erniedrigten, Verkauften, Verratenen, der erhoben wird - eine Dichtergestalt - ein Prophet. Und in all ihren Zeilen ist Leben, Liebe und rührend traurige Wahrheit. Und auch Humor, denn trotz des Grauens der Einsamkeit, des Alters in der Fremde verbittert sie nicht, wenn sich auch ihr Humor zu Galgenhumor verdunkelt: "Liege nachts an fremden Wänden, / Lebe schlecht von fremden Spenden / Und am Tage renne ich umher, / Und vom Dankesagen ungefähr / meine Zunge von Minute zu Minute ordinär".
689 Briefe, Postkarten und Telegramme aus den Jahren 1941 bis 1945 versammelt der letzte Band der 2003 begonnenen sechsbändigen Briefausgabe, die nun abgeschlossen vorliegt, und an der Zahl der Briefempfänger und der ihnen zugedachten Briefe lässt sich ablesen, wie einsam Else Lasker-Schüler am Ende ihres Lebens ist - zwei Drittel der Botschaften verteilen sich auf nur sieben Adressaten. Nahezu alle sind in Jerusalem geschrieben, denn auch reisen kann sie nicht mehr, aus finanziellen Gründen ebenso wie aus gesundheitlichen. Sie wohnt, von ihrer Vermieterin tyrannisiert und um immer höhere Mieten erpresst, in einem Zimmer im Westen Jerusalems, im Stadtviertel Rehavia, wo seit 1933 hauptsächlich Einwanderer aus Deutschland und Mitteleuropa leben, unter anderen auch ihre Bekannten und Förderer Martin Buber, Werner Kraft, Georg Landauer.
Ein paar Menschen hat sie also noch, und sie schart sie um sich. Viele der Briefe kreisen um die von ihr geleitete Vortragsvereinigung "Der Kraal", die sie 1941 in ihrem frisch bezogenen Zimmer ins Leben ruft: "alle sagten gestern, wundervoll ist mein großes Zimmer und doch kann ich gar nicht begreifen, daß ich nach all der Zeit überhaupt einen Raum haben darf und flattere darin herum". Mit dem "Kraal", ein Wort, das im Afrikaans eine kreisförmig angelegte Siedlung bezeichnet, verwirklicht sie ihre zuerst 1932 entworfene Idee eines Kreises befreundeter Künstler, in dem sie wirken kann und der ihr gegen die Einsamkeit und Herzenstraurigkeit, von der sie vor allem an den Abenden überfallen wird, hilft, eine Geistesdichtergegenwelt: "Wir müssen ein ganzes Indianerdorf ausmachen schließlich. (. . .) wir wollen doch nur - Zusammenhang von lieben Menschen herstellen".
Wie allein man werden kann
Sie steckt all ihre Kraft in diese Zusammenkünfte, die ihr wieder rege Beschäftigung geben und ihre Einsamkeit etwas dämpfen; für die schließlich 27 Abende schreibt sie je siebzig Einladungen, die sie selbst austrägt, um das Porto zu sparen. Es sind Lesungen, Musikabende, Gespräche zu Landesgeschichte und Religion, und auch ganz Praktisch-Pragmatisches findet sich, etwa ein Abend zum Thema "Du und der Luftschutz", denn auch in Palästina wird ja gekämpft.
Aber so sehr sie die Abende herbeisehnt, ihre heilsame Wirkung dauert nur kurz. "Sind alle wieder gegangen, ist man wieder allein auf der Welt, oft nur noch wie ein stiller trüber Schatten. (. . .) Wie allein man doch werden kann und sich selbst entkommt", heißt es schon nach dem ersten Treffen in einem Brief. Die Einsamkeit ist das Gespenst, das nicht mehr von ihr lässt. Zwar gelingt es ihr, neue Bekannte und Freunde zu gewinnen, aber "ich lernte sie alle zu spät kennen; ich bin verloren und nicht mehr zu erreichen und erreiche Niemand mehr", schreibt sie an einen von den Spätgetroffenen und -zugewandten, Fritz Weisskopf, Textilfabrikant in Haifa, der sie auch finanziell unterstützt. "Mein Leben fiel ins Schloß."
Es fehlen die Vertrauten, die sie von früher kennen, von kleinauf oder wenigstens dann aus Berlin, dem "Romanischen Café", die mit ihr dieselben Erinnerungen teilen, die wissen, dass sie nicht diese alte Frau ist, das "Ekel", eine kleine gebeugte Gestalt, die schlecht sieht und sich nur noch mühsam fortbewegt, sondern Prinz Jussuf und blauer Jaguar, eine Dichterin, mit Leib und Leben und Seele, und, ja, ein Kind, das die Masern hat, nascht, in der Ecke stehen muss und getröstet werden will, wie sie immer Kind war und nie etwas anderes werden kann, ein Kind, das weint, wenn es traurig ist, und lacht, wenn es ihm gut geht und die Menschen freundlich zu ihm sind und ihm Spielsachen und Bonbons schenken. Sie hält nichts zurück, sie ist nicht vorsichtig, berechnend, sie ist unvernünftig, egozentrisch, launenhaft, in Märchen und Träume versponnen. Und tief beseelt von dem Wunsch, dass die Welt, indem sie sie in ihrer Dichtung besänftigt, besingt, schmückt, zum Leuchten bringt, sich verwandeln möge, denn in der Welt, wie sie ist, kann man ja nicht leben: "Ich sterbe am Leben und atme im Bild wieder auf."
Aber sie hat noch ihre Dichtung, fliegt auf, schwere- und alterslos, denn Dichten ist "zaubern können!!. Mit Gedanken nichts zu tun, das Wort wird plötzlich eine Königin" - und da sie fleißig ist, "Ich arbeitete an meiner Maschine 6-8 Stunden täglich - also ich faullenzte nicht", wird der letzte Gedichtband, "Mein blaues Klavier", fertig und erscheint, nach langem Warten - ",Zum Donnerwetter, er hat Manuscript œ Jahr' wann kommt das Buch?" -, endlich im Sommer 1943. Trotz positiver Aufnahme und Besprechungen wird von den 330 Exemplaren jedoch nicht einmal die Hälfte verkauft.
Kalte Wand. Kein Trost
Aber da ist noch ein zweites, ein ungeheures Werk, ihr zweites Palästinabuch mit dem Titel "Die Heilige Stadt", eine Zusammenstellung von Gedichten, Prosa, dramatischen Texten und Zeichnungen, in deren Mittelpunkt das Schauspiel "IchundIch" steht. Ein Spiegelkabinett ist dieses Schauspiel, in dem sich jedes Ding und jede Figur in zwei spaltet, wie auch das dichtende, imaginierende Ich, auf dessen Herzensbühne sich die Vorgänge und Begegnungen zwischen realen und fingierten Gestalten abspielen, dissoziiert, eine ungeheuer kühne, die Bühne sprengende Konzeptkunst entwirft Lasker-Schüler da, in der das Spiel sich potenziert, so dass das Bild eines spielenden Theaters entsteht, das die Räume und Zeiten vereint.
Reale Orte, Räume gehen ein in die Dichtung, so der Garten des sie behandelnden Augenarztes und der schwarz-weiß geflieste Boden ihres Zimmers, "ein steinern Schachbrett, daraus eine Stimme ertönt: ,Schach dem König.' Und dann hab ich verloren." Aber sie will nicht verlieren, will, dass aus "Ich und Ich" wieder "IchundIch" wird, will die Heilung der schizoiden Person, deren Selbstdiagnose lautet: "Mir brach die Welt in Splitter". "Ich weiß nicht daß meine Hände so verschiedene Dinge tragen, in der rechten Hand halte ich Sonnenblumen in der linken eine Peitsche . . ." - und ebenso ist's in der zerrissenen Welt, und sie sehnt sich, dass nach dem Streit, dem Kampf, dem Krieg endlich Versöhnung kommt.
Nur das Schauspiel wurde fertig. Sie las daraus, aber ob einer der Zuhörer verstand, was er da hörte? "Ich schlafe in der Nacht an fremden Wänden / Und wache in der Frühe auf an fremder Wand." Diese Zeilen, die sie an Ernst Simon schickte, den dreißig Jahre Jüngeren, in den sie sich verliebte, als sie seine Gedichte las, und dem sie die meisten der in diesem letzten Band gesammelten Briefe schrieb, diese Zeilen zeigen ein Herz, das sich wund reibt an einer kalten fremden Wand. Eines Landes. Eines Menschen. Der ihr antwortet: "Bei Ihnen aber ist Herz und Haut eines - das macht Sie so groß und Ihr Leben, heute, so schwer." Da ist sie, die kalte Wand. Und keine Wärme. Kein Trost.
Werner Kraft, der Bewunderer, der schon früh den Kontakt zu der Dichterin gesucht hatte, sich immer wieder für ihr Werk einsetzt, der ihr schreibt und sie in ihrem Zimmer besucht, "weil ich ihre Lage so spüre, daß mir die Haut schaudert", notiert im Tagebuch: "So kann es allen gehen, so kann es auch mir gehen. Es gibt keine Hilfe, aber wenn ich Gift hätte und sie wollte es haben, ich glaube, ich würde es ihr geben. Noch ein paar herrliche Gedichte, gewiß. Aber der Preis, den sie dafür zahlt, ist zu hoch".
Noch ein paar Gedichte, ja. Eins davon heißt: "Ich weiß" - und geht weiter: "daß ich bald sterben muß". Am Abend des 16. Januar erleidet sie einen schweren Herzanfall und wird in das Hadassa-Krankenhaus auf dem Mount Scopus eingeliefert, wo sie am 22. Januar 1945 stirbt. "Sie hat entsetzlich gelitten", schreibt Werner Kraft an Freunde. "Das Herz wollte nicht nachgeben."
Das Herz, immer wieder das Herz. Es ist das Organ, über das sie aufnahm, mit dem sie sah und hörte und aß und trank. Es war ihr Organ. Es hielt alles andere am Leben. Es liebte, es schmerzte, es dichtete. Es alterte nicht.
BETTINA HARTZ
Else Lasker-Schüler: "Briefe 1941-1945". Bearbeitet von Karl Jürgen Skrodzki und Andreas B. Kilcher. Jüdischer Verlag 2010, 912 Seiten, 124 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Bewegt, beeindruckt und fasziniert hat Manfred Koch diesen Briefband gelesen, der seinen Informationen zufolge Korrespondenzen aus den letzten, im Exil verbrachten Lebensjahren dieser bedeutenden deutschen Dichterin enthält. Die Adressaten seien in der Hauptzahl Freunde, die ihr halfen, sich über Wasser zuhalten, die Briefe "Schmerzlitaneien" einer Exilierten, die dauernd bedrückende Bilder gebären, wie der Kritiker schreibt. Immer wieder aber kann er auch Else Lasker-Schülers nie versiegende Lust am Fabulieren und an Wortspielen entdecken, was ihm immer wieder zu Lektüreglückserlebnissen führt. Am schönsten findet er die Korrespondenz zwischen Else Lasker-Schüler und dem Kulturphilosophen Ernst Simon, der ihre letzte Liebe gewesen sei. Nicht nur, dass ihn das ungeheure Taktgefühl bewegt, mit welchem der dreißig Jahre jüngere Mann die Gefühle der Dichterin zugleich würdigte und in ihre Schranken gewiesen habe. Auch staunt er, dass die deutsche Literatur dieser "Amour fou einer blutjungen Greisin" Glanzstücke ihrer Liebespoesie verdankt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH