Marcel Proust war ein äußerst produktiver Briefschreiber. Für den Dichter, der häufig ans Bett gefesselt war, trat der Brief oft an die Stelle des persönlichen Gesprächs. In seinen Korrespondenzen erleben wir den Autor von den verschiedensten Seiten: als Schriftsteller, der mit seinem Verleger bis buchstäblich zum letzten Atemzug um jede Zeile seines Werkes kämpft. Als mutigen Literaten, der im Skandalprozess um den jüdischen Hauptmann Dreyfus früh das Wort ergreift und sich für den zu Unrecht Verurteilten einsetzt. Als Muttersohn und als Werbenden in homoerotischen Freundschaften. Immer wieder brilliert Proust auch als witziger Erzähler mit Blick fürs skurrile Detail. Wie er sich verzweifelt gegen Handwerkerlärm aus der Nachbarwohnung zur Wehr setzt oder auf groteske Finanztransaktionen einlässt, gehört zu den amüsantesten Aspekten dieser Korrespondenz.
Diese erste umfassende deutsche Briefausgabe mit ihren annähernd 600 Briefen an Freunde, an die Mutter, an Schriftstellerkollegen, Gesellschaftsmenschen, Kritiker und Verleger dokumentiert aus Prousts unzensiert-privater Sicht seine ganze Entwicklung von den frühen literarischen Fingerübungen bis hin zur Vollendung der Recherche. Einleitung, ausführliche Stellenkommentare, Zeittafel, Kurzporträts aller Briefempfänger und Register erschließen die Briefe und damit das faszinierende Panorama einer ganzen Epoche.
Diese erste umfassende deutsche Briefausgabe mit ihren annähernd 600 Briefen an Freunde, an die Mutter, an Schriftstellerkollegen, Gesellschaftsmenschen, Kritiker und Verleger dokumentiert aus Prousts unzensiert-privater Sicht seine ganze Entwicklung von den frühen literarischen Fingerübungen bis hin zur Vollendung der Recherche. Einleitung, ausführliche Stellenkommentare, Zeittafel, Kurzporträts aller Briefempfänger und Register erschließen die Briefe und damit das faszinierende Panorama einer ganzen Epoche.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Immerhin 572 der schätzungsweise 90000 Briefe Marcel Prousts liegen nun in einer vorbildlich editierten und kommentierten Ausgabe durch Jürgen Ritte auf Deutsch vor, schwärmt Andreas Isenschmidt. Der Rezensent taucht fasziniert in die Lebenswelt des Autors, der die letzten siebzehn Lebensjahre krankheitsbedingt überwiegend im Bett verbrachte und in den Nachtstunden Briefe an seine Freunde verfasste. Die Briefe erscheinen Isenschmidt wie "gesellige Monologe", in denen Proust seinen Korrespondenten Schmeicheleien und Liebesbekundungen ebenso wie Kritik und Streitigkeiten "bis an die Grenze der Peinlichkeit" schrieb, über seinen Gesundheitszustand informierte und insbesondere in den an Salonkonversationen erinnernden Briefen an Genieve Straus mit seinem "funkelnden" Witz und "sprühendem" Geist überzeugte. Darüber hinaus staunt der Kritiker, wie früh Proust bereits mit dem virtuosen Spiel der Stilimitationen und -parodien begann. Während der Autor seine Homosexualität in den Briefen kaum thematisiert, erhält der Rezensent einige Einblicke in den Entstehungsprozess der "Recherche". In jedem Fall kann Isenschmidt diese Edition nachdrücklich empfehlen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Verwoben und verliebt ins eigene Werk: Die bislang umfangreichste deutschsprachige Auswahl der Briefe von Marcel Proust erweist sich als ein Buchwunderwerk.
Es ging ihm nicht gut in seinen letzten Jahren, obwohl er erst um die fünfzig war. Doch auf den Fotos der frühen zwanziger Jahre sehen wir einen fröhlichen Marcel Proust. Er hielt auf Etikette, und Fotografie bedeutete für ihn Verheißung von Ewigkeit, also das, was er auch literarisch anstrebte. Dementsprechend waren Porträtaufnahmen nicht der Ort für die Dokumentation von Leiden - wie es auch die Bücher nicht waren, in denen Proust das eigene Leben zur Folie einer Fiktion machte, die alles umstürzte, was man unter Literatur verstand. Darin tritt er selbst als Ich-Erzähler auf, aber nicht im Sinne einer Autobiographie, denn der Marcel der Bücher wird zwar alt, ist aber nicht krank. Hätte sich doch auch da bewahrheitet, was Proust im Oktober 1914 seinem Lebensfreund Reynaldo Hahn mitteilte: "Seit langem bietet mir das Leben nur noch Ereignisse, die ich schon beschrieben habe." Gesundheit jedoch war ihm nicht vergönnt.
Gegenüber Korrespondenzpartnern beklagte Proust immer wieder Erschöpfung, Müdigkeit, Krankheit, und viele seiner Briefe brachen plötzlich mit dieser Floskel ab - zum Selbstschutz, denn er brauchte die verbleibende Kraft ja zur Vollendung seines Lebenswerks, des Romanzyklus "À la recherche du temps perdu" (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit). Andere Schreiben, vor allem an ihm unbekannte Menschen, begannen gleich mit dieser Klage: "Monsieur, ein wahres Wunder hat bewirkt, dass ich Ihnen antworten kann. Seitdem ich krank bin, stapeln sich Tausende von ungeöffneten Briefen. Welcher Zufall dem Ihren ein anderes Schicksal beschieden und mir für eine kurze Zeit Kraft zum Antworten gegeben hat, ich weiß es nicht." Wir aber wissen es, denn der Adressat dieses Briefs vom 10. oder 11. Dezember 1920 (Proust datierte seine Schreiben fast nie; man muss den Zeitpunkt ihrer Abfassung also aus dem Inhalt oder, bei den seltenen Fällen, in denen sich der Umschlag erhalten hat, aus den Poststempeln folgern) hieß Harry Swann. "Swann" wie einer der wichtigsten Protagonisten in der "Recherche".
Diese Namensgleichheit wird den Schriftsteller elektrisiert haben, der sich seinem Romanprojekt mit Haut und Haaren buchstäblich verschrieben hatte. Er arbeitete daran, wann immer es ging, obwohl er schon 1913, als der erste Band erschien, das übrige Werk für abgeschlossen hielt. Aber statt damals drei projektierten Teilen sollten es sieben werden, und Proust starb am 18. November 1922 über den ununterbrochen weiterbearbeiteten und ergänzten Druckfahnen. Die letzten drei Bände erschienen erst postum.
Mit den gegenüber Monsieur Swann erwähnten "Tausenden ungeöffneter Briefe" mag Proust nicht einmal drastisch übertrieben haben. Er hat selbst Tausende geschrieben - die bis 1993 von Philipp Kolb erstellte französische Ausgabe seiner Korrespondenz umfasst 24 Bände und mehr Seiten als sein sonstiges Gesamtwerk; zudem tauchen immer wieder bislang noch unbekannte Schreiben auf. Die schon an Kolbs Ausgabe beteiligte Françoise Leriche hat 2004 eine leserfreundliche Auswahl von immerhin auch noch 627 Briefen getroffen, die vor allem in Fragen der Datierung und Kommentierung Maßstabe setzte. Auf der Grundlage dieses Buchs erscheint nun als Doppelband die bislang umfassendste deutsche Ausgabe von Prousts Korrespondenz, wenn man auch vermuten muss, dass diese auf fast 1500 Seiten versammelten 572 Schreiben keine fünf Prozent dessen darstellen, was dieser rastlos schreibende Mensch an Briefen verfasst hat.
Den ältesten uns bekannten schrieb er 1878 mit sieben Jahren an den Großvater, als spätesten hatte Leriche eine Notiz Prousts vom 31. Oktober 1922 an Gaston Gallimard, den Verleger der "Recherche", in ihre Briefauswahl aufgenommen. Die von dem Romanisten Jürgen Ritte betreute deutsche Ausgabe setzt nun einen anderen Schlusspunkt: mit einem Brief an Gallimards Verlagsmitarbeiter Jacques Rivière, der sich als Leiter der Zeitschrift "Nouvelle Revue Française" immer wieder für die "Recherche" eingesetzt hatte. Leriche hat dieses Schreiben gar nicht aufgenommen, Kolb sortierte es vor dem Schreiben an Gallimard ein. Ritte aber verweist in seinen Anmerkungen darauf, dass Proust selbst hier einmal eine Datierung vornahm: "nov.bre 1922", also November. Dabei kam dem Herausgeber zugute, dass das Original des Briefs in der "Bibliotheca Proustiana" des Kölner Sammlers und Proust-Afficionados Reiner Speck liegt.
Speck ist der Spiritus Rector hinter dieser deutschen Ausgabe, die dank jahrelanger Arbeit und phantastischer Ausstattung (Leineneinbände, Schuber mit im Inneren eingeklebtem Proust-Porträt, gegenüber Leriches Buch nochmals verbesserte Kommentierung) unbezahlbar genannt werden kann und dennoch nur vergleichsweise wenig Geld kostet. Möglich wurde das dadurch, dass Speck die Finanzierung übernahm und auch für ein rundes Zehntel der ausgewählten Briefe die Originale zur Verfügung stellen konnte, so dass etliche bei Kolb und Leriche noch unvollständige Lesarten korrigiert und sogar sieben Briefe ergänzt werden konnten, die in beiden französischen Ausgaben noch fehlten. Dass nur etwa die Hälfte der Autographen aus Specks Sammlung in den beiden Bänden auch als sein Besitz ausgewiesen wird, darf man wohl eher als Bescheidenheit denn als Versäumnis der Kompilatoren bewerten. Wie haben sie sonst gearbeitet? Extrem sorgfältig, auch wenn es zwei chronologische Brüche gibt. Ein angeblich im September 1921 verfasster Brief wird hinter mehreren aus dem November jenes Jahres stammenden Schreiben eingeordnet. Aber diese Reihenfolge findet sich schon bei Kolb und Leriche, es mag also einfach in der deutschen Ausgabe ein Druckfehler vorliegen (September statt Dezember). Doch für das Jahr 1922 weicht Ritte von der in den französische Ausgaben etablierten Abfolge ab und plaziert ohne jede Begründung zwischen zwei Briefen aus dem September einen von Ende August. Wie das der Aufmerksamkeit aller Beteiligten entgehen konnte, ist rätselhaft. Ebenso wie das Fehlen jenes unschätzbar wichtigen Fräuleins Rallet, einer Sekretärin aus Gallimards Verlag, im Register. Sie hatte die Idee zu den später berühmt gewordenen aus Fahnen und handschriftlichen Ergänzungen montierten placards, die Proust in einem Brief als "holde Meisterwerke" preist. Die Meisterin selbst aber wird von der Proust-Forschung weiter totgeschwiegen; nicht einmal ihr Vorname ist bekannt.
Aber nicht philologische Makellosigkeit soll primärer Maßstab zur Bewertung dieses Buchwunders sei, sondern inhaltliche. Die Übersetzungen - alle neu angefertigt, selbst in Fällen bereits vorhandener aus früheren deutschen Briefbänden - sind von großer Eleganz und Akkuratesse. Das bislang verbreitete Klischee von Prousts Briefen als Salon-Plaudereien, denen die analytische Schärfe der Romane fehlte, erweist sich als unhaltbar. Hier werden vielmehr alle Stilregister gezogen, vom Charmeur bis zum Zyniker, teilweise in denselben Schreiben. Keines ist zugleich witziger und trauriger als jener Verzweiflungsbrief, den Proust im Mai 1919 anlässlich des Erscheinens von "Im Schatten junger Mädchenblüte", des zweiten Teils der "Recherche", an Gallimard richtete, weil ihm das Buch in zu kleiner Schriftgröße und zu fehlerreich gedruckt war. Im Jahr danach wiederholte sich diese Enttäuschung, als die Fahnen zu "Guermantes" kamen. Proust klagte abermals beredt und bewegt Gallimard sein Leid und bat, ihm angesichts dieses Desasters ein halbes Jahr zur Korrektur einzuräumen, was er mit Verweis auf die Saumseligkeit des Lektorats scheinresigniert wieder zurücknahm: "Doch dann habe ich mir gedacht, dass letztlich sowieso keiner achtgibt. Monsieur (der reizende Dada, der die Fahnen nochmals durchgesehen hat und dessen Name mir im Augenblick entfallen ist) hat geglaubt zu lesen, Jacques Rivière hat geglaubt zu lesen . . . Bauen wir auf die Blindheit der anderen." Der "reizende Dada" war übrigens niemand anderer als André Breton. Die Vorstellung, dass er das Manuskript dadaistisch lektoriert hätte, dürfte sogar Proust zum Lachen gebracht haben.
Ansonsten war es ihm bitterernst mit der "Recherche", und darüber gibt diese Briefauswahl so deutlich Auskunft wie nur möglich. Bei diesem Buch ging es Proust um Leben und Tod, nämlich im Hinblick auf literarisches Nachleben oder Vergessen, und deshalb nahm er keinerlei Rücksicht auf die eigene Gesundheit. Was man über die Komposition und Verfertigung der "Recherche" aus seinen Briefen lernt, übertrifft jede spätere Interpretation durch andere. Allein eine solche Bemerkung ist die ganze Lektüre dieser beiden Briefbände wert: "Es kommt nur so viel Kontingentes darin vor, wie erforderlich ist, um den Anteil des Kontingenten im Leben auszudrücken. Und folglich ist es im Buch nicht mehr kontingent." Geschrieben wurde das 1912, also noch vor Erscheinen des ersten Bandes. Und noch früher, 1908, als die Arbeit am Zyklus begonnen hatte, listete Proust in einem Brief auf, was er gerade in Arbeit habe: "eine Studie über den Adel, einen Pariser Roman, einen Essay über Saint-Beuve und Flaubert, einen Essay über die Frauen, einen Essay über Päderastie (nicht leicht zu veröffentlichen), eine Studie über Kirchenfenster, eine Studie über Grabsteine, eine Studie über den Roman." Die "Recherche" wurde all das dann zugleich - und noch mehr. Nun kann man verfolgen, wie diese größte Literatur entstand.
ANDREAS PLATTHAUS
Marcel Proust: "Briefe 1879-1922". Hrsg. von Jürgen Ritte. Aus dem Französischen von Jürgen Ritte, Achim Russer und Bernd Schwibs. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. 2 Bde. im Schuber, zus. 1479 S., geb., 78,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Eine prächtige Auswahlausgabe ...« Stefan Zweifel Neue Zürcher Zeitung 20170213

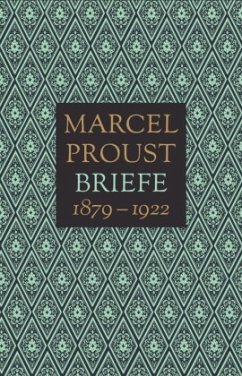
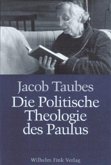






sv_optimiert.jpg)