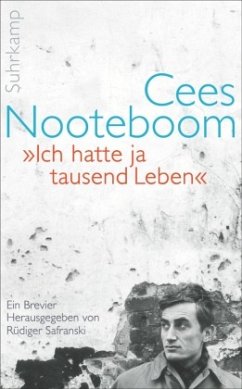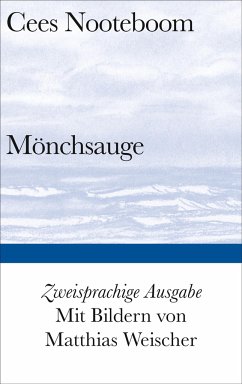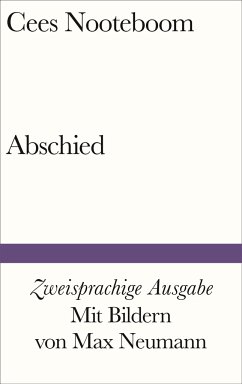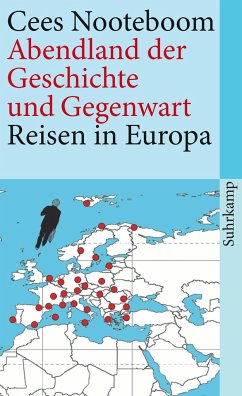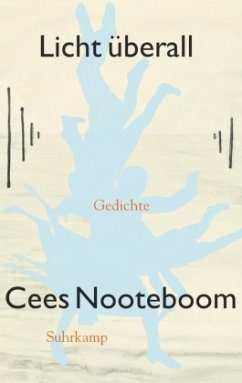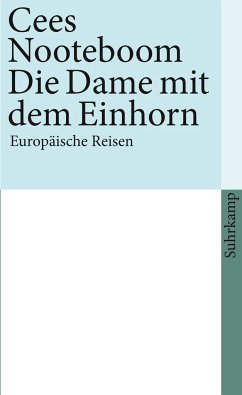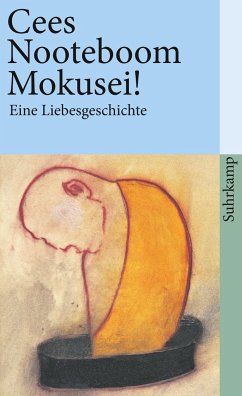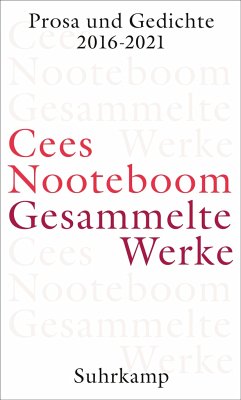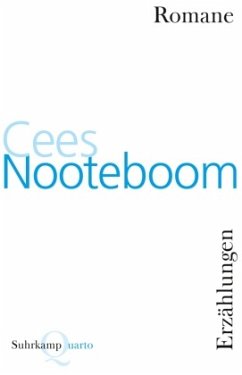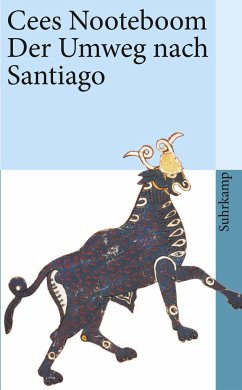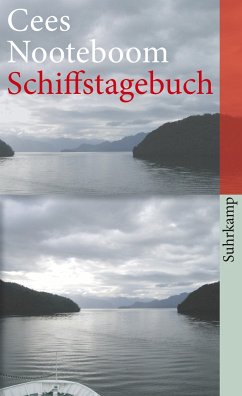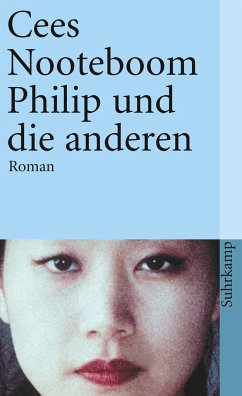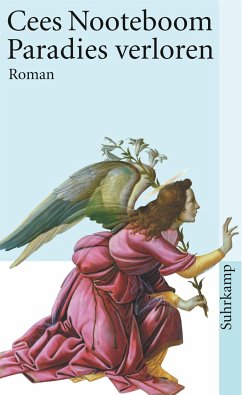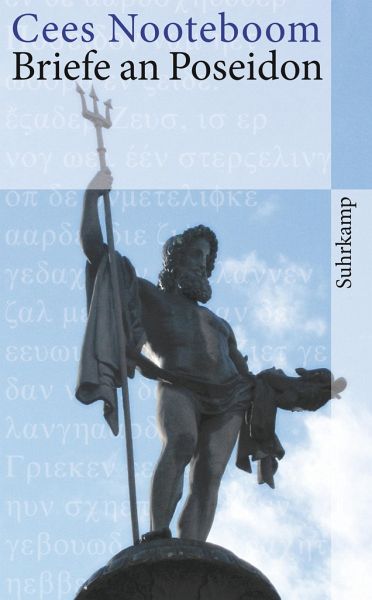
Briefe an Poseidon

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Meisterhaft beherrscht Cees Nooteboom die Kunst, hinter den kleinen Dingen die großen Weltfragen aufblitzen zu lassen. So führt etwa eine zufällige Strandbegegnung zur Frage, ob ein kleiner Junge der Spiegel sein kann, in dem das eigene Alter verfliegt. Die Pflanzen im mediterranen Garten des Autors wiederum kümmert das wenig, sie führen ihr eigenes Leben. Und die Agave, die vermutlich mit mexikanischem Akzent spricht, verfolgt ohnehin eine nur ihr bekannte Mission.Nootebooms Korrespondenz mit dem Meeresgott bezaubert: Verspielt und tiefernst, lakonisch und poetisch, lässt sie das Erzäh...
Meisterhaft beherrscht Cees Nooteboom die Kunst, hinter den kleinen Dingen die großen Weltfragen aufblitzen zu lassen. So führt etwa eine zufällige Strandbegegnung zur Frage, ob ein kleiner Junge der Spiegel sein kann, in dem das eigene Alter verfliegt. Die Pflanzen im mediterranen Garten des Autors wiederum kümmert das wenig, sie führen ihr eigenes Leben. Und die Agave, die vermutlich mit mexikanischem Akzent spricht, verfolgt ohnehin eine nur ihr bekannte Mission.Nootebooms Korrespondenz mit dem Meeresgott bezaubert: Verspielt und tiefernst, lakonisch und poetisch, lässt sie das Erzählte in einem klaren, warmen Licht erscheinen.