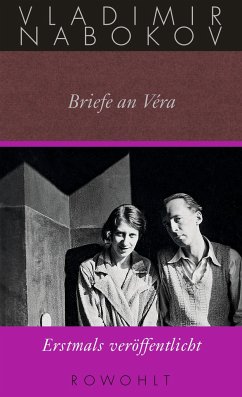Noch niemals auf Deutsch publiziert: Die Briefe des großen russisch-amerikanischen Schriftstellers Vladimir Nabokov an seine Frau - Zeugnisse einer lebenslangen Liebe und intellektuellen Leidenschaft.
Vladimir Nabokovs Passion für seine Frau überdauerte vierundfünfzig Jahre, vom ersten Gedicht, das er 1923 für sie schrieb, als er sie kaum ein paar Stunden kannte, bis zu den späten Momenten ihrer Ehe, als er die letzten Bücher seines Lebens, wie die zwanzig zuvor, mit "Für Véra" zeichnete. Und obwohl sie selten getrennt waren, schrieb Nabokov seiner Frau zahllose Briefe, die hier zum ersten Mal auf Deutsch publiziert werden.
Kaum ein Jahr nachdem sie sich im Berliner Exil kennengelernt hatten, schrieb er: "Wir beide sind etwas ganz Besonderes; solche Wunder, wie wir sie kennen, kennt niemand, und niemand liebt so wie wir." Als er der gebildeten Tochter eines wohlhabenden jüdischen Händlers aus St. Petersburg zum ersten Mal ein Buch widmete, seine Autobiographie Erinnerung, sprich, wandte er sich im letzten Kapitel direkt an ein unspezifiziertes "Du": "Die Jahre gehen vorbei, meine Liebe, und bald wird niemand mehr wissen, was wir wissen." Véra war eine Konstante: seine Muse, Lektorin und aufmerksamste, ideale Leserin - die Freude seines Lebens.
Während wir Véra hier beim Lesen über die Schulter blicken, werden wir Zeugen der Verwandlung einer Leidenschaft, die alles aussprechen muss, in eine, die alles schon ungesagt einschließt. Diese Briefe lassen im Menschen Nabokov das erkennen, was er in der Kunst am meisten schätzte: Neugier, Zartheit, Freundlichkeit, Ekstase.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Vladimir Nabokovs Passion für seine Frau überdauerte vierundfünfzig Jahre, vom ersten Gedicht, das er 1923 für sie schrieb, als er sie kaum ein paar Stunden kannte, bis zu den späten Momenten ihrer Ehe, als er die letzten Bücher seines Lebens, wie die zwanzig zuvor, mit "Für Véra" zeichnete. Und obwohl sie selten getrennt waren, schrieb Nabokov seiner Frau zahllose Briefe, die hier zum ersten Mal auf Deutsch publiziert werden.
Kaum ein Jahr nachdem sie sich im Berliner Exil kennengelernt hatten, schrieb er: "Wir beide sind etwas ganz Besonderes; solche Wunder, wie wir sie kennen, kennt niemand, und niemand liebt so wie wir." Als er der gebildeten Tochter eines wohlhabenden jüdischen Händlers aus St. Petersburg zum ersten Mal ein Buch widmete, seine Autobiographie Erinnerung, sprich, wandte er sich im letzten Kapitel direkt an ein unspezifiziertes "Du": "Die Jahre gehen vorbei, meine Liebe, und bald wird niemand mehr wissen, was wir wissen." Véra war eine Konstante: seine Muse, Lektorin und aufmerksamste, ideale Leserin - die Freude seines Lebens.
Während wir Véra hier beim Lesen über die Schulter blicken, werden wir Zeugen der Verwandlung einer Leidenschaft, die alles aussprechen muss, in eine, die alles schon ungesagt einschließt. Diese Briefe lassen im Menschen Nabokov das erkennen, was er in der Kunst am meisten schätzte: Neugier, Zartheit, Freundlichkeit, Ekstase.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Nicht für spätere Leser verfasst: Vladimir Nabokovs Briefe an Véra, mit der er vierundfünfzig Jahre zusammen war, geben intimste Einblicke.
Im achtzehnten Jahrhundert entwickelte sich der Brief zum vorzüglichen Medium der wechselseitigen Selbstentzifferung von Individuen. Beim jungen Goethe und bei den Romantikern zumal löste sich der Liebesbrief aus konventionellen Floskeln, in der Liebeserklärung zeigte sich ein Ich im Verhältnis zur Welt als ein fühlendes Wesen. Die Philologie des neunzehnten Jahrhunderts betrachtete Briefe als wertvolle Dokumente zur Rekonstruktion des Erlebens eines Schriftstellers und fügte sie daher in die Werkausgaben ein. Allerdings enthalten gerade Briefe von bedeutenden Autoren Elemente der Fiktion, der Selbststilisierung und der Verstellung.
Vladimir Nabokovs Briefe an seine Frau Véra, mit der er vierundfünfzig Jahre zusammen war, erscheinen nun als vierundzwanzigster und wohl letzter Band der von Dieter E. Zimmer besorgten Werkausgabe zum ersten Mal auf Deutsch. Bewunderungswürdig ist die entsagungsvolle Arbeit des Übersetzers Ludger Tolksdorf. Grundlage ist zwar die von Brian Boyd und Olga Voronina herausgegebene englische Ausgabe, jedoch ist Tolksdorf in allen Zweifelsfällen noch einmal auf die Originale zurückgegangen und hat zudem den reichhaltigen Anmerkungsapparat für deutsche Leser gründlich überarbeitet. Weiterhin enthält der Band zahlreiche Fotografien und je im Text neben Faksimiles der Handschriften auch die kleinen Zeichnungen, die Nabokov in die Briefe einfügte. Besonders charakteristisch gelingen ihm neben Schmetterlingen fahrende Züge und Autos, was vielleicht die Mobilität bezeichnet, die nicht nur freiwillig das Leben der Eheleute prägte.
Nabokov hatte Véra Slonim, die Tochter eines jüdischen Händlers aus St. Petersburg, 1923 auf einem Ball der Kolonie russischer Revolutionsflüchtlinge kennengelernt, die sich in Berlin gebildet hatte, um später großenteils nach Paris weiterzuziehen. Nabokov, damals noch alias W. Sirin, hatte sich schnell einen Namen als Dichter gemacht. Die Berichte über seine Lesungen in den Briefen zeigen, dass er in Berlin wie in Paris oder Prag weitgehend in der Emigrantenszene verblieb und auch die Sprachen nicht lernen wollte, um sein Russisch nicht zu verderben. Nur aus England, wo er in Cambridge studiert hatte, berichtet er von anderen Kontakten. Früh schon bereitete er sich darauf vor, auf Englisch zu publizieren.
Diese Passagen der Briefe sind durch die Überzahl an Namensnennungen für den an biographischen Einzelheiten weniger interessierten Leser ziemlich uninteressant. Für die biographische Entwicklung geben die Briefe im Übrigen wenig her. Dazu fehlen entscheidende Phasen und Faktoren. Über die potentielle Bedrohung Véras durch das Naziregime und die Abreise nach Amerika, über die Phase des Welterfolgs durch "Lolita" und die Gründe der Rückkehr nach Europa erfährt der Leser kaum etwas, dafür umso mehr über seinen Charakter, seine Freundlichkeit und Kinderliebe und seine Abneigung gegen Wichtigtuerei. Das ist nicht verwunderlich, denn die Briefe sind ganz offensichtlich nicht im Blick auf spätere Leser geschrieben worden, sondern dafür, Véra für sich einzunehmen.
Bereits in den ersten erhaltenen Briefen betont Nabokov die Einzigartigkeit der Beziehung. Véra erscheint ihm unmittelbar als diejenige, die einzig ihn versteht. "Ja, ich brauche Dich, mein Märchen. Denn Du bist der einzige Mensch, mit dem ich reden kann - über den Schatten einer Wolke, über das Lied eines Gedankens - und darüber, dass heute, als ich zur Arbeit hinausging und einer hochgewachsenen Sonnenblume ins Gesicht sah, diese mich mit all ihren Samen anlächelte."
Bei den Bildern der Einzigkeit sollte es lebenslang bleiben. Seine Frau wurde ihm Muse, Sekretärin und Lektorin, ihr widmete er fast alle seine Bücher. Sie feiert er unentwegt in einer Überfülle von Metaphern und - für den deutschen Leser ungewohnt, gelegentlich enervierend - einer Kaskade von Koseworten und -namen. "Du bist mein Glück, mein Schatz" wird oft in einem einzigen Brief gebetsmühlenartig zehnfach und öfter wiederholt, als müsste das Glück fliehen, wenn es nicht permanent angerufen wird. Freilich erscheinen diese Formeln auch dann, wenn Nabokov wie etwa 1937 in Paris auf amourösen Abwegen wandelt. So dienen sie auch in der Camouflage noch der Stabilisierung der Ehe.
Obwohl die Situation der Emigranten nicht einfach war - immer wieder berichtet Nabokov von seinen Versuchen, das Auskommen der Familie zu sichern -, zeigt er sich in den Briefen fast durchgängig in unverbrüchlicher Heiterkeit. Zeitweise steht das im Gegensatz zu Véras Befinden, die periodisch unter Depressionen leidet. Als sie sich 1926 im Schwarzwald zu einer Kur aufhält, schreibt er ihr jeden Tag einen Brief mit meist der Tierwelt entlehnter veränderter Anrede, um sie zum Lachen zu bringen und ihr Mut zuzusprechen. So ist sie sein Miezelchen, Mäusch, Gänslein, Hü-hündchen, Äffelchen, Puschel, Springmaus, Knäuelchen, Kuschel, Spätzchen, Mückilein, Muschilein, Böckchen, Trautilein und, wie es sich für einen bedeutenden Schmetterlingsforscher gehört, Falterchen. Aber auch: "langer Paradiesvogel mit dem kostbaren Schweif" oder "Miepchen (eine kleine Kreuzung aus Welpe und Miezchen)" und immer alberner so fort. Dazu unterhält er sie mit allerliebsten Zeichnungen und Gedichten sowie mit allerlei Ratespielchen, Labyrinthen und selbstgebastelten Kreuzworträtseln, mit denen sich auch der Leser vergnügen kann.
Die Briefe zeigen exemplarisch das innige Verhältnis von Schreiben und Abwesenheit. Sie werden in der Absicht geschrieben, Véra den Eindruck von Anwesenheit zu vermitteln. Nabokov lässt sie an seiner Lektüre teilhaben und berichtet von Kontakten und Erfolgen. Unermüdlich schildert er ihr seinen Alltag, jeder Spaziergang durch Berlin wird ihr mit allen Straßennamen vergegenwärtigt, jeder Kauf von Briefmarken mit Angabe des Postamts vermerkt. Vor allem aber wird der bekannte Satz "Ich liebe Dich" unzählige Male wiederholt und variiert, um nicht zu sagen breitgewalzt. "Vielleicht habe ich es Dir schon einmal gesagt, aber für alle Fälle sage ich es ein weiteres Mal. Kätzchen, es ist sehr wichtig - bitte pass auf . . . Ich liebe Dich . . . Und es gibt noch etwas anderes, das ich Dir sagen muss - und diese Sache solltest Du Dir bitte ebenfalls aufmerksam anhören und gut merken . . . Ich möchte Dir sagen, dass ich: Dich unendlich liebe." Das rührt den Leser, geht ihm aber irgendwann auch ein wenig auf die Nerven.
Nur 1937, als Nabokov einmal wieder in Paris weilt und dort seine Affäre mit einer russischen Emigrantin hat, ändert sich gelegentlich der Ton. Véra war wohl unzufrieden mit dem, was er für das Auskommen der Familie angeblich erreicht hatte, machte ihm Vorwürfe und zögerte ihre Abreise nach Frankreich hinaus, die er vorbereitet hatte. Ganz unberechtigt war das wohl nicht. Es scheint, dass Nabokov häufig lieber länger als kürzer abwesend war. Er aber zeigt sich "furchtbar verärgert" über einen Brief von ihr (ihre Briefe an Nabokov sind nicht erhalten) und verbittet sich weitere "kindische Vorwürfe". Ihr Plan, nach Prag zu fahren, wo es auch eine russische Emigrantenkolonie gibt, hält er für Unsinn. "Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr mich Dein gedankliches Umherirren durch Mitteleuropa quält." Aber auch diese Briefe enden mit "ich liebe Dich, mein Leben" oder zunehmend auf Englisch: "I kiss you, my love."
In den wenigen Briefen, die er ihr in den vierziger Jahren von seinen Lesereisen in den Vereinigten Staaten nach New York schreibt, ist er wieder ganz der Zuversichtliche und Aufheiternde, die häufig Kränkelnde mit unverminderten Liebesbeteuerungen Tröstende, obwohl die Situation nach wie vor nicht einfach ist. Ihren Existenzängsten begegnet er mit ausführlichen Berichten über seine Erfolge als Dichter, Dozent und Schmetterlingsforscher und fordert sie zu mehr Großzügigkeit auf. In New York soll sie eine größere und teurere Wohnung nehmen, wenn sich die Chance bietet. "Lieber über Zahlungen stöhnen als über mangelnden Komfort."
Im Palace Hotel von Montreux, in dem Nabokov und Véra von 1961 bis 1977 residierten, fehlte es dann nicht am Komfort. Aus dieser Zeit gibt es nur einige Briefe, die Nabokov aus Taormina schrieb. In dem letzten erhaltenen, verfasst 1970, zeigt sich punktlichtartig, wie innig das Schreiben von Briefen mit der Beziehung zu Véra verquickt war und wie sehr die zeitweilige Abwesenheit dazugehörte, vielleicht sogar der Stabilität der Ehe diente. "Jetzt warte ich auf Dich. In gewisser Beziehung tut es mir leid, dass diese Korrespondenz zu Ende geht, ich umarme und liebe Dich." Die Lektüre der Briefe an Véra ist ein gemischtes Vergnügen. Der Leser kann sich am Witz Nabokovs erfreuen, mit dem er Banales unterhaltsam macht, und sich von seiner unbeirrbaren Liebesfähigkeit rühren lassen. Weite Strecken des Bandes aber sind langweilig, weil gar nicht für den Leser bestimmt. Das schmälert selbstverständlich nicht die Verdienste der Edition.
FRIEDMAR APEL
Vladimir Nabokov: "Briefe an Véra". Gesammelte Werke, Band XXIV. Hrsg. von Brian Boyd und Olga Voronina.
Aus dem Englischen von Ludger Tolksdorf. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2017. 1148 S., Abb., geb., 40,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Zunächst einmal würdigt Rezensent Friedmar Apel die Leistung des Übersetzers Ludger Tolksdorf, der nicht nur auf die englische Ausgabe, sondern auch die auf die originalen Briefe Nabokovs an seine Frau Vera zurückgegriffen hat. Überhaupt schätzt der Kritiker diesen vierundzwanzigsten und mutmaßlich letzten Band der großen Nabokov-Werkausgabe von Dieter E. Zimmer, der neben vielen Fotografien und einem vorbildlichen Anmerkungsapparat auch Faksimiles der Zeichnungen enthält, die Nabokov den Briefen beifügte. Die Briefe selbst liest Apel indes mit gemischten Gefühlen: Biografische Details und prägende Phasen im Leben der Eheleute werden meist nur kurz erwähnt, stattdessen bekommt der Leser "Kaskaden von Koseworten" geboten, informiert Apel. Bezeichnungen wie "Äffelchen, Puschel, Mückilein" oder "Böckchen", welche die erschöpfenden Alltagsschilderungen durchziehen, mögen die gelegentlich depressive Vera erheitert haben - dem Kritiker gehen die Liebesschwüre nach einer Weile ziemlich auf die Nerven. Nabokovs Witz, seine Ratespiele und selbst erdachten Kreuzworträtsel haben Apel indes Vergnügen bereitet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Briefe an Véra öffnet die Tür zum Arbeitszimmer und zeigt uns Nabokov nicht in seiner harten Hülle als Genie, sondern als sanften, verletzlichen praktizierenden Schrifststeller. Wieder und wieder sehen wir, was Charles Kinbote, in Fahles Feuer, die Magie eines Verstandes nennt, der die 'Welt wahrnimmt und transzendiert, sie in Besitz nimmt und zerlegt und ihre Teile neu zusammensetzt. Harper's Magazine