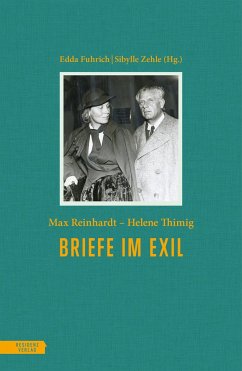Was für ein eindrucksvolles Paar: Max Reinhardt und Helene Thimig, der Wegbereiter des modernen Regietheaters und die gefeierte Schauspielerin. Fast zwei Jahrzehnte war Schloss Leopoldskron, der Wohnsitz des Mitbegründers der Salzburger Festspiele, Treffpunkt der europäischen Geisteselite. Doch die politischen Veränderungen führen 1938 zu einer jähen Zäsur. Reinhardt, zur Emigration gezwungen, versucht vergeblich an frühere Erfolge in den USA anzuknüpfen; seine Frau kämpft in Hollywood um Nebenrollen. Die bisher kaum beachtete Korrespondenz der beiden lässt uns teilhaben am bitteren Leben im Exil - bis ins kleinste verstörende Detail - und erzählt von der Liebe zweier Menschen in schwerer Zeit. Faktenreiche Anmerkungen von den Herausgeberinnen ergänzen den Briefwechsel.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Ziemlich bedrückend ist der Tonfall in den Briefen, die Max Reinhardt und seine Frau Helene Thimig sich zwischen 1937 und 1943 im amerikanischen Exil geschrieben haben, so Rezensentin Katrin Bettina Müller. Er versucht in New York Bühnenprojekte zu realisieren, die oft an diversen Eitelkeiten scheitern, sie hält in Hollywood eine nach ihm benannte Theaterschule aufrecht und tritt manchmal in Filmen auf. Nicht immer wirkt Reinhardt sympathisch in diesen Briefen, lernen wir, er beschwert sich viel; nacheinander sehnsüchtig und eifersüchtig sind sie beide. Die Herausgeberinnen Edda Fuhrich und Sibylle Zehle haben, freut sich Müller, die Briefe um tolles Bildmaterial ergänzt. Die Nazis, die das Ehepaar aus Österreich verjagt hatten, kommen selten zur Sprache, so die Rezensentin, und auch über Reinhardts künstlerisches Schaffen erfährt man wenig. Die Rezension schließt mit der Erwähnung eines Briefes, der doch einen kleinen Einblick in die Ästhetik des Schönheitssuchers Reinhardt erlaubt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Von neuen Häusern träumte er bis zum Schluss: Zum 150. Geburtstag von Max Reinhardt erscheint ein Briefwechsel mit seiner Ehefrau Helene Thimig. Er wirft Licht auf die schweren letzten Jahre eines großen Theatermanns im amerikanischen Exil.
Für die Linken war er der elitäre Kunstaristokrat. Für die Ästheten ein Showman der grellen Effekte. In Wien galt er als preußischer Konvertit. In Berlin als Inbegriff des Österreichers. In Europa hielt man ihn für einen Importeur des amerikanischen Kunstkommerzes. In Amerika hatte er schließlich den Ruf, ein komplizierter europäischer Intellektueller zu sein. Max Reinhardt war nicht leicht zu beherbergen. Seine Heimaten wechselte er so oft wie seine Unterkünfte, bis zum Schluss träumte er von neuen Häusern, machte Umzugspläne und entwarf Einrichtungen. Vielleicht ist das von heute aus gesehen der entscheidende Grundbegriff für Leben und Werk von Max Reinhardt: Das Haus.
Mit Häusern fängt seine Karriere an, in Berlin gründet der Sohn eines verarmten österreichischen Kaufmanns und einer ostjüdischen Miedermacherin erst ein eigenes Off-Theater und kauft sich dann zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts nach und nach ein regelrechtes Theaterreich zusammen, das zwischenzeitlich aus rund einem Dutzend Spielstätten besteht. Als Reinhardt 1918 auch noch einen Zirkus umbauen will, verlässt ihn das Gründerglück für einen Moment. Enttäuscht wendet er Berlin den Rücken zu und kehrt in seine österreichische Heimat zurück. Zwei Jahre später nimmt Reinhardt in Salzburg die Fährte wieder auf, erfindet die bald weltberühmten Festspiele, wird erneut zum gefeierten Intendanten und Regisseur. Sein Begriff vom Theater hat von jeher einen engen Bezug zum Ort, zur physischen Stätte. Reinhardt ist in mancher Hinsicht mehr Architekt als Spielleiter. Die Bühnen, die er bauen lässt, spiegeln seine Sehnsucht nach geschützten Traumräumen wider, all die Häuser, die er gründet und kauft, dienen nur dem einen Zweck: Möglichkeiten zu bieten, um Worte zu wechseln, die in anderer Umgebung niemand glaubt.
Auch für sich selbst sucht Reinhardt immerfort nach neuen zauberhaften Orten. Kurz nach dem Krieg entscheidet er sich gegen ein Grundstück in Sils Maria für ein verlassenes Barockschloss nahe Salzburg: Leopoldskron. Dort residiert er achtzehn Jahre wie in einer belebten Theaterkulisse, empfängt in einem Nachbau der Stiftsbibliothek St. Gallen berühmte Gäste, inszeniert draußen im Garten Shakespeares "Sommernachtstraum", veranstaltet trotz seiner Schüchternheit Diners, Premierenfeiern und Bälle. Wenn zu seinem morgigen 150. Geburtstag im Rahmen eines szenischen Theaterabends Schauspielgrößen wie Valery Tscheplanowa und Michael Maertens das Schloss Leopoldskron bevölkern werden, wird ein Hauch der alten Stimmung zu spüren sein. Aber auch an anderen Tagen lohnt der Besuch dieses Erinnerungsortes, der inzwischen von einer amerikanischen Stiftung unter dem Namen "Salzburg Global Seminar" als Tagungszentrum und Hotel geführt wird.
Leopoldskron ist für Reinhardt von all seinen Häusern das wertvollste. "Ich habe jedes Zimmer, jeden Tisch, jeden Sessel, jedes Licht, jedes Bild gelebt. Ich habe es immer feiertäglich geliebt, nie als etwas Alltägliches. Es waren meine schönsten, reichsten und reifsten Jahre", schreibt er 1935 in einem Brief an seine Frau Helene Thimig. Mit ihr, die 1917 erstmals in einer seiner Inszenierungen auftrat, floh Reinhardt im Oktober 1937 vor den Nationalsozialisten nach Amerika. Ein unausweichlicher Schritt. Schon 1933, im Jahr seiner legendären Salzburger "Faust"-Inszenierung, wird sein Berliner Besitz enteignet. Reinhardt klammert sich an die Hoffnung, in seiner ursprünglichen Heimat in Sicherheit zu sein, knüpft aber zeitgleich schon Kontakte in den USA, organisiert dort erfolgreiche Tourneen und Gastspiele. Bei einem Galadinner im "Waldorf Astoria" ruft New Yorks Bürgermeister LaGuardia ihm 1935 zu: "Europa hat Ihnen nichts mehr zu geben. Amerika alles. Amerika braucht und erwartet Sie."
Darauf vertraut Reinhardt und zieht nach Hollywood. Hier hofft er nach Berlin und Salzburg nun auf einen dritten Frühling, aber die sündhaft teure Verfilmung seines "Sommernachtstraums" wird ein Flop - und Reinhardts Marktwert stürzt rasant. So euphorisch man in Amerika die Stars feiert, so schnell wendet man sich auch von ihnen ab, wenn ihnen der Geruch des Misserfolgs anhaftet. Diese Schmach erfährt Reinhardt in seinen nun folgenden, letzten Lebensjahren mit voller Härte. Bittere Kenntnis davon erhält man durch einen gerade erschienenen Briefwechsel, der den bisher nur wenig bekannten gemeinsamen Lebensabschnitt von Max Reinhardt und Helene Thimig im amerikanischen Exil dokumentiert. Er offenbart das verzweifelte, in vieler Hinsicht tragische Ende eines Jahrhundertkünstlers.
Denn von Reinhardts großen Plänen bleibt bald schon nichts übrig. Aus Mangel an Aufträgen gründet er zusammen mit Thimig in Hollywood eine Schauspielschule, die aber nach kurzer Zeit wegen windiger Geschäftsführung bankrottgeht. Reinhardt bewirbt sich am New Yorker Broadway, inszeniert alles, was man ihm anbietet, doch das Geld reicht hinten und vorne nicht. Die Kunstproduktion wird zum Überlebenskampf. In der schmutzigen Großstadt leidet Reinhardt unter Luftnot, Schlaflosigkeit und Verdauungsproblemen. Seiner in Kalifornien gebliebenen Frau beschreibt er drastisch, wie er sich Lady-Macbeth-haft andauernd den Dreck von den Händen wäscht.
Die Briefe und Telegramme, die die beiden Eheleute vom 1. November 1937 bis unmittelbar vor Reinhardts Tod im Oktober 1943 wechseln, sind mindestens zur Hälfte Hilferufe: Immer fehlt Geld, immer fehlen gute Aussichten. Immer fehlen sie einander. Allerdings bleiben liebevolle Worte die Ausnahme. Stattdessen belegen detaillierte Schilderungen von Gehaltsverhandlungen, Reparaturmaßnahmen und Lektüreenttäuschungen, was Briefe einmal waren: wichtige, vor allem kostengünstige Nachrichten über das Leben an einem anderen Ort. Überraschend ist, wie wenig vom Zeitgeschehen die Rede ist. Die politische Lage in der Heimat kommt nur sehr am Rande vor, etwa wenn Reinhardt im November 1938 entsetzt festhält: "Wehrlose werden zu Tode gemartert. Todesanzeigen werden verboten . . . Die Verladung in gepferchte Eisenbahnwagen und das Lager soll jeder Beschreibung spotten."
Und doch setzen die beiden ihr eigenes Leid nicht ins Verhältnis zu dem, was gerade in Europa geschieht. Ihre größte Not ist, wenn die Haushaltshilfe kündigt. Oder der Umzug in ein kleineres Haus bevorsteht. Alarmiert kabelt Thimig am 28. Juni 1942 von Santa Monica nach New York: "Situation verzweifelt. Versorgungsmarkt. Keine Ressourcen. Alles Zukunft, aber kein Leben. Brauche Hilfe sofort." Und Reinhardt antwortet: "Versuche derzeit verzweifelt, andere Quellen zu finden. Wenn keine Hoffnung mehr, dann bleibt als einzige Möglichkeit Verpfändung." Die Sorge um das Auskommen dominiert, das ist zu verstehen, und doch wirkt die Korrespondenz im Angesicht des gleichzeitigen Grauens in der Heimat mitunter weltfremd. Als Reinhardt nach dem Zusammenbruch der Schauspielschule ohne Einkommen und Angebote dasteht, rät ihm ein Freund, leichte Artikel für Magazine anzubieten, aber Reinhardt lehnt stolz ab: "Ich bin leider kein Plauderer und kann mir nicht einmal das Zähneputzen leicht machen".
Den Hauptteil der sorgsam edierten und zurückhaltend kommentierten Ausgabe nimmt das Jahr 1942 ein, als Reinhardt endgültig nach New York zieht, um noch einmal ein Theater zu gründen. "Ich, persönlich, gebe immer sehr schwer auf", schreibt er mit wiedererwachtem Lebensgeist. Schon schmiedet er Pläne für die Eröffnung, im Spiel ist eine Neuadaption des "Jedermann", versetzt in das Milieu der Afroamerikaner in New Orleans, und schon setzt der alte Theaterhase Pressevorstellungen an. Aber die Sache zerschlägt sich, wie so viele andere. Und Reinhardt wird immer mehr zu jener "zutiefst einsamen Gestalt", als die ihn der alte Freund Carl Zuckmayer einmal beschrieb. In einem Brief aus dem August jenes Jahres heißt es: "Ich bin voll bis an den Rand und habe niemand, zu dem ich sprechen kann."
Helene Thimig, die als Komparsin in drittklassigen Hollywoodfilmen mehr schlecht als recht reüssiert, erweist sich in den Briefen als tatkräftig-sympathische, mitunter auch selbstironische Person: "Es ist doch wirklich ein Roman, unser Kampf in Amerika!?", schreibt sie augenzwinkernd an den bedrückten Ehemann und berichtet von ihren letzten Dreharbeiten. Sie scheint weniger an ihrer Trennung zu leiden als er, der sich immer mehr in Erinnerungen verliert: "Die Alte Welt hat mir alles genommen und die Neue tut vorläufig dasselbe", schreibt Reinhardt am 20 Juli 1943 und listet dann minutiös bis zu den Kaminkacheln auf, was ihm alles einmal gehört hat und nun verloren ist.
Seinen letzten Brief beendet der stellungslose Regisseur Reinhardt mit der Schilderung einer komödiantischen Theaterszene: "Heute musste ich seit langer Zeit herzlich lachen. Nur für mich alleine, nach dem Aufstehen, eine Stunde lang schüttelte es mich." Wenige Wochen später erleidet er einen schweren Schlaganfall, von dem Helene Thimig erst sehr spät erfährt. Die letzten Tage seines Lebens verbringt Reinhardt in Obhut seiner anderen lebenslangen Geliebten Eleonore von Mendelssohn.
Thimig selbst kehrt kurz nach dem Krieg nach Österreich zurück und knüpft an ihr altes Leben an. Stolz verwaltet sie fortan das Erbe ihres Mannes und tritt bis in die Siebzigerjahre als gefeierte Schauspielerin auf. Unter dem Titel "Wie Max Reinhardt lebte" veröffentlicht sie 1973 ihre Erinnerungen. Der nun erschienene Briefband komplementiert das Bild eines legendären Theatermannes, der aus beengten Verhältnissen kam und in beengten Verhältnissen endete - aber was dazwischenlag, das ging entschieden ins Große und Weite. SIMON STRAUSS
Max Reinhardt/Helene Thimig: "Briefe im Exil".
Hrsg. von Edda Fuhrich und Sibylle Zehle.
Residenz Verlag, Salzburg/Wien 2023. 560 S., Abb., geb., 40,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main