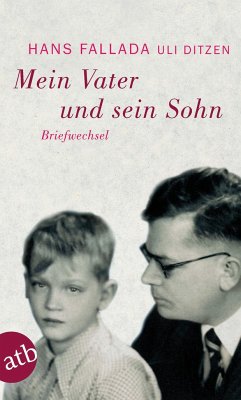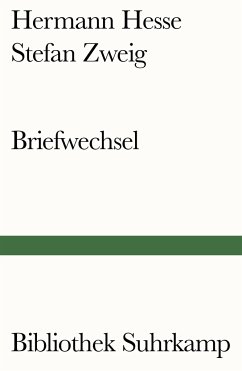Briefwechsel 1943 - 1955
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
14,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nach einer persönlichen Begegnung im amerikanischen Exil setzt der Briefwechsel im Dezember 1945 ein und hält bis zum Tod Thomas Manns 1955 an. Gegenstand des Austauschs sind immer wieder ästhetische, politische und ethische Fragen, die um das Werk der beiden Briefschreiber kreisen.