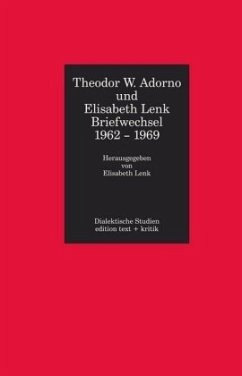Der vorliegende Band der Reihe "Dialektische Studien" enthält 101 Briefe aus Beständen des Adorno-Archivs bzw. der privaten "Sammlung Lenk". Erläuternde Anmerkungen sowie ein Anhang, der diejenigen der im Briefwechsel erwähnten Texte enthält, die nicht mehr zugänglich sind, ergänzen die Sammlung. Eine Vorbemerkung sowie ein Vortrag über "Kritische Theorie und surreale Praxis" ordnen die vergangenen Ereignisse aus der Sicht der Herausgeberin in die heutige Zeit ein.Der Briefwechsel hatte einen unspektakulären Anlass: Er war nötig geworden, weil Elisabeth Lenk, Adornos soeben dem Examen entronnene Schülerin, von Frankfurt weg ging, um in Paris weiter zu studieren und zu promovieren. Wir sehen beide Briefpartner in die Zeitereignisse verstrickt: Elisabeth Lenk, SDSIerin der ersten Stunde, lernt in Paris André Breton und die surrealistische Gruppe, dann die Situationisten kennen und berichtet schließlich, als Lektorin an der Universität Nanterre, aus nächster Nähe von den Mai-Ereignissen. Adorno seinerseits erscheint als jemand, der von allen Seiten angefordert, aber auch angegriffen wird, immer bereit, die Schläge auf elegante Weise zu parieren, nie beleidigt, immer sachlich, aber gegen Ende doch auch sehr gehetzt, verletzt und erschöpft.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Adorno, so schreibt Elisabeth Lenk in der Einleitung zu diesem Briefwechsel, sei für sie, als sie in Frankfurt Anfang der sechziger Jahre studierte, derjenige gewesen, der am entschiedensten die Aufarbeitung der Vergangenheit gefordert habe: "Er störte, und eben dies hatte mich ganz und gar für ihn eingenommen." In einem Gedicht, das sie ihm im Herbst 1964 schickt, heißt es von einer tanzenden Frau: "Hörst du das Klirren nicht hinter der Mauer / Und das böse Flüstern der Bäume / Du störst hier du bist nicht willkommen". Identifizierung stand am Anfang. Zunächst hatte Elisabeth Lenk mit einer Arbeit über die französische Soziologie bei Adorno promovieren wollen, dann drängte sich der Surrealismus vor. Und über die ganzen Jahre des Briefwechsels begleitet uns die Geschichte dieser Dissertation, die dann, nach Adornos Tod, die deutsche Nachblüte des Surrealismus einläuten sollte (Theodor W. Adorno und Elisabeth Lenk: "Briefwechsel 1962-1969". Hrsg. von Elisabeth Lenk. Edition Text und Kritik, München 2001. 227 S., geb., 27,- [Euro]). Hinzu kam die von Adorno geförderte Arbeit an der deutschen Ausgabe von Charles Fouriers "Theorie der vier Bewegungen", einer versponnenen sozialistischen Glücksmathematik des neunzehnten Jahrhunderts. Briefwechsel bedürfen stets der Kommentierung. Personennamen müssen aufgeschlüsselt, Situationen müssen erhellt werden. Das kann man akademisch-korrekt machen, verbindlich, kühl. Man kann es aber auch so halten wie Elisabeth Lenk: subjektiv, oft ungerecht und durchaus nachtragend, ja verstiegen, voll persönlicher Erinnerungen und seltsamer Einzelheiten - und immer lebendig. Kein Klatschbedürfnis aus der Berliner Szene um Peter Szondi, aus dem Pariser Kreis um André Breton bleibt unbefriedigt. Nicht daß es keine bedeutenden Briefe gäbe - den zeitdiagnostisch informativsten, über eine französische Kommune, schreibt sie ihm nach den Mai-Unruhen am 26. Juli 1968. Dazwischen aber ertappt man sich dabei, vor den Briefen gleich die Erläuterungen zu lesen; Adorno hätte wohl von einer "entsublimierten" Lektüre gesprochen. Und das betrifft nicht nur die Frage, wer mit wem zusammen ist oder sich gerade getrennt hat. Gibt es über den jüdischen Religionsphilosophen Jacob Taubes eine bezeichnendere Anekdote als jene, die hier mitgeteilt wird? Taubes, so Elisabeth Lenk, habe "der linken Fakultät in seinem Fachbereich manchen Streit gespielt, so als er einen polnischen Seelenforscher so überschwänglich lobte, daß der Fachbereich diesem eine Gastprofessur anbot. Erst nach der erfolgreichen Papstwahl stellte sich heraus, daß es Woityla gewesen war." Die gemeinsamen Interessen für die Dichter und Denker entfesselter Leidenschaften werden für einen Moment auch praktisch. "Ich habe noch nie, wirklich noch nie eine Frau getroffen, die ich für so genial begabt halte wie Dich, in den Bereichen, die mir die nächsten sind; und bitte, setze das nicht auf das Konto meiner Verliebtheit, zu der es nur noch mehr beiträgt", schreibt er einmal, und kurz später: "Mir fehlen die Worte, Dir zu sagen, wie ich mich freue, mit Dir wegzufahren, wir wollen es zusammen ausdenken." Diesmal bleibt die Anmerkung denkbar knapp: "Diese Traumreise hat nie stattgefunden." Nun kann der Leser ins Grübeln geraten wie bei Goethe und Marianne von Willemer. Bald sind auch seine Briefe wieder beim "Sie" angelangt, von dem sie nie abgegangen war. Schmeichlerisch rühmt sie seine "pouvoir de séduction" - aber es geht nur noch um Gutachten und Prüfungen. Der Kontakt mit Elisabeth Lenk brachte auch in Adorno die surrealistische Komponente wieder zum Vorschein. Als eine gemeinsame Bekannte ermordet wird, spielt er für einen Augenblick Bretons Sehertum nach: "Trotzdem kann ich mich erinnern, daß ich, als ich Aliette einladen wollte und hörte, ihre Adresse sei unbekannt, für den Bruchteil einer Sekunde das Gefühl von Unheil hatte." Nur für einen Moment überläßt sich Adorno der surrealen Erfahrung. Dann zuckt er zurück: "Aber natürlich kann so etwas auch nachträgliche Projektion sein." Wie oft erlebt man das, wenn man Adorno liest: Man spürt, was möglich gewesen wäre und was der rationalen Selbstzensur zum Opfer fiel.
LORENZ JÄGER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit Interesse verfolgt Lorenz Jäger die Entwicklung von der glühenden Identifizierung der Briefpartnerin und Herausgeberin mit dem großen Ted Adorno bis zu dem Moment, da sich die Briefe nurmehr noch um pragmatische Fragen hinsichtlich Gutachten und Prüfungen drehen. Die stark subjektive Färbung der Kommentare allerdings ist schuld, dass Jäger oft lieber gleich die Erläuterungen gelesen hat. So ungerecht und nachtragend, ja verstiegen sich Lenk hier nicht selten gibt, schreibt er, so lebendig lesen sich ihre Ausführungen über die Berliner Szene um Peter Szondi oder den Pariser Kreis um Andre Breton. "Nicht dass es keine bedeutenden Briefe gäbe" - zeitdiagnostisches Informatives über eine französische Kommune z.B., interessanter aber scheint doch wie immer der Klatsch.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH