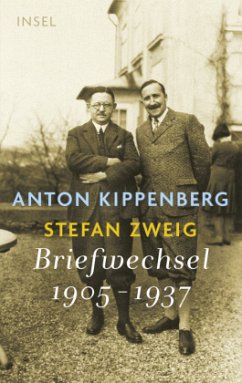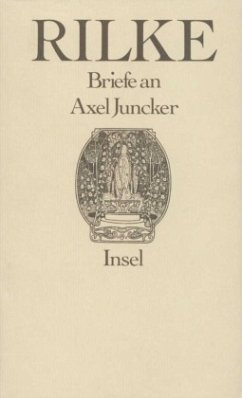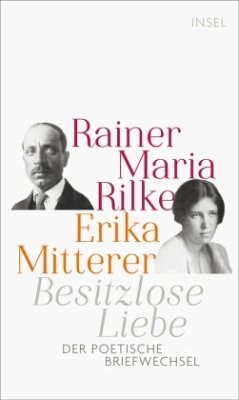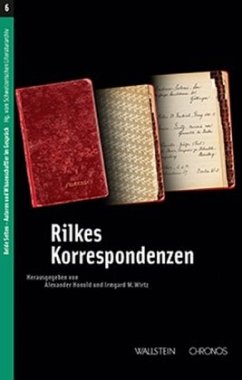Briefwechsel mit Anton Kippenberg 1906-1926, 2 Teile
1906 bis 1926
Herausgegeben: Scharffenberg, Renate; Schnack, Ingeborg
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
98,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der erstmals vollständig und ungekürzt vorliegende Briefwechsel Rainer Maria Rilkes mit seinem Verleger Anton Kippenberg - bisher lagen nur Briefe Rilkes vor - ist innerhalb der langen Reihe der seit den »Gesammelten Briefen« edierten Korrespondenzen Rilkes das aufschlußreichste Dokument seines Schaffens als Autor, Übersetzer und Verlagsberater sowie der Editionsgeschichte seiner Werke. Er ist zugleich das Dokument einer Freundschaft und ein Dokument der Geschichte des Insel Verlages, in dem Rilkes Werke seit über 100 Jahren erscheinen.