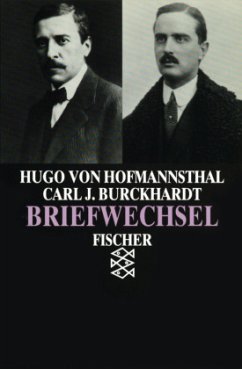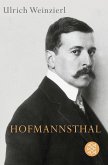Vorwort zur ersten AuflageDer Briefwechsel Hugo von Hofmannsthals mit einem jungen Schweizer der im letzten Sommer des Ersten Weltkriegs als Gesandtschaftsattaché nach Wien gelangte, beginnt im Jahre 1919 und endete mit dem Tode des Dichters im Jahre 1929.Hofmannsthals Briefe legen Zeugnis ab über die letzte Zeit seines Schaffens nach dem Zusammenbruch seines Vaterlandes, der Österreich-Ungarischen Monarchie. Sie lassen die große Einsamkeit erkennen, in der er lebte, die Last auch untrüglicher Voraussicht, die auf ihm lag. Weisheit, Geduld und Güte sprechen aus dem erzieherischen Anteil, den er einem um vieles jüngeren Menschen erweist.Von jenen zwanziger Jahren trennen und Begebenheiten, welche die Welt umfassender verändert haben, als Jahrhunderte frühern geschichtlichen Ablaufs. Die kurze Spanne Zeit zwischen den beiden großen Kriegen gehört völlig der Vergangenheit an. Wer überlebte, ist durch das inzwischen Geschehene ein anderer geworden. Dies ist der Grund, weshalb wir keine Bedenken tragen, auch die Briefe des jüngern Korrespondenten zu veröffentlichen; diesem w3ar es innerhalb einer einmaligen menschlichen Konstellation verliehen worden, manches aussprechen zu dürfen, was er ohne diese eine Begegnung verschwiegen hätte.In der Art, wie der Dichter solche Mitteilung gewähren läßt, sie fast unmerkbar, aber unablässig fördert, wird auch seine sonst so oft verhüllte eigenste Natur gegenwärtig: nie legt er die Maßstäbe seiner eigenen Reife an die Äußerungen des andern, nie greift er zur Korrektur, nie unterbricht er die Aussage durch eine Auseinandersetzung. Seine überlegene Erfahrung löst keine Ungeduld in ihm aus, Wiederhören von längst tiefer und strenger Gedachtem veranlaßt ihn nicht zum Eingreifen; ein aufmerksamer Betrachter, läßt er in größter Freiheit gewähren. Losgelöst schon on dem vordergründigen Willen, der noch darnach strebt zu leiten und zu verändern , wirkt in ihm einzig jenes andere mächtigere Wollen, das durch Einverständnis und Vertrauen Leben und Wachstum fördert. C.J.B.

Hugos Briefe an eine Gräfin Von Ulrich Weinzierl
Mit Recht gilt er als einer der großen Briefschreiber des Jahrhunderts. Jeden wusste er nach seiner Fasson zu nehmen, er ging auf den anderen zu und ein, vermittelte dem Partner, dem Kollegen, dem Freund das Gefühl gesteigerter Anteilnahme und zog ihn in seine geistige Sphäre. Tausende Seiten aus seiner Korrespondenz sind gedruckt nachzulesen. Fast immer, von Ausgabe zu Ausgabe, sollte eine neue Facette des diskreten, schwierigen Menschen Hugo von Hofmannsthal zum Vorschein kommen, was keineswegs in seinem Interesse gelegen war. Am liebsten, so beschied er Ruth Sieber-Rilke im Jahre 1927, würde er zur "Erschwerung des läppischen Biographismus und all dieser Unziemlichkeiten" private Aufzeichnungen und Botschaften beiseite schaffen. Solchen Abschottungswunsch der Nachwelt gegenüber postum zu ignorieren war und ist richtig. Wir verdanken den Dutzenden Publikationen nicht bloß die philologisch unentbehrliche Ergänzung des OEuvres. Eine "ganz andere Dimension seines Wesens ist hier entfaltet", betonte der bedeutende Hofmannsthal-Kenner Richard Alewyn schon 1954, "von der das Werk, wenn überhaupt, nur in Zeichen spricht: Hofmannsthals Person. Es geht eine erleuchtende und reinigende Kraft von ihr aus, die viele nie mehr werden entbehren wollen."
Gewiss gibt es gewichtigere Briefwechsel als diesen, den Renate Moering rühmenswert sorgfältig ediert hat. Im Literaturbezirk ist Christiane Gräfin von Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt, Herrin von Wartenberg längst vergessen. Sie entstammte böhmischem Uradel, zu dessen Ahnen väterlicherseits Wallenstein zählte. Ihr Großvater war jener Graf Waldstein, dem Beethoven seine Klaviersonate op. 53 gewidmet hatte, ihre Mutter eine geborene Prinzessin Schwarzenberg. Christianes Ehemann, Oswald Thun-Salm, war Mitglied des Herrenhauses und Anführer des verfassungstreuen Großgrundbesitzes in Böhmen. Anno 1901 geruhte der Kaiser persönlich, das Prager Palais Thun unterhalb des Hradschin zu besuchen. Nach der Soiree, berichtete die "Neue Freie Presse", habe der Monarch seiner Gastgeberin huldreich gedankt, "er sei über das prachtvolle Fest entzückt".
Jedoch: Die kaiserliche Palast- und Sternkreuzordensdame Christiane Thun-Salm hatte künstlerische Interessen. Sie verfertigte Prosaskizzen und Dramolette, die am Burgtheater aufgeführt wurden, und ein patriotisches Festspiel: "Des Kaisers Traum" erblickte zum sechzigjährigen Regierungsjubiläum Franz Josephs in der Wiener Hofoper das Licht der Bühnenwelt. War das nur höhere Comtessenhandarbeit? Der Philosoph Rudolf Kassner schätzte die einschlägigen Leistungen der "Dame aus der großen Welt" gering ein: "Zuweilen", heißt es in seinem "Buch der Erinnerung" ein bisschen herablassend, "stand in einer der leitenden Zeitungen, wohin sie dank ihrem illustren Namen Eingang gefunden hatte, eine Erzählung, darin Hauslehrer und Kammerjungfrauen Sätze zu sagen hatten, die für komisch galten oder gelten sollten." Gerechter, wiewohl nicht minder hart, fiel das Urteil Carl Jakob Burckhardts aus: "Die vorzüglichste Eigenschaft des Dichterischen, die in Shakespeare so stark vorhandene plastische Sicherheit, war da, sie ist ja auch in den Novellen, in den Stücken; das, was fehlt, ist etwas Sekundäres, nämlich das eigentliche litterarische Können."
Die Frage drängt sich auf: Warum so viel Raum an altösterreichische Genealogie und ein nicht eben überragendes Talent verschwenden? Weil gerade das soziale und ästhetische Gefälle zwischen Hofmannsthal und Christiane Thun Reiz und Charakter des Briefwechsels ausmacht. Zwar mangelte es dem Dichter nicht an Umgang mit Aristokratinnen. Aber die Beziehung zu Ottonie Degenfeld-Schonburg, eine erotische, zart besitzergreifende Seelenfreundschaft, fällt aus dem Rahmen jeglicher Konvention. Auch bei Helene Nostitz-Wallwitz, die er mit "Liebe gnädige Frau" titulierte, schien der Standesunterschied nicht schwer zu wiegen. Christiane Thun-Salm hingegen war um fünfzehn Jahre älter als Hofmannsthal und blieb für ihn die "gnädige Gräfin", auch nachdem sie sich - wegen eines politisch-nationalen Zanks nach dem Untergang Kakaniens - ungnädig von ihm abgewandt hatte. Es brauchte Jahre, bis sie sich von dem formellen "Sehr geehrter Herr!" über die Vermeidung der Anrede zu einem "Lieber Herr von Hofmannsthal!" durchrang. Lakonisch betont die Herausgeberin: "Einladungen in ihr Haus erhielt er bei keinem einzigen gesellschaftlich relevanten Anlass, sondern nur zum ,Frühstück'". Lange warb Hofmannsthal um die Gunst der kunstsinnigen hohen Frau. "Ich werde mich von Herzen freuen, wenn Sie, gnädige Gräfin, mich nicht ganz vergessen", schrieb er ihr am Anfang ihrer Bekanntschaft, die beide irgendwann als Freundschaft zu verstehen oder misszuverstehen begannen. Hofmannsthal wählte dabei die Rolle des untertänigen Verehrers: "Meine Briefe an Sie sind übrigens sehr monoton: ich möchte Ihnen immer wieder sagen, wie froh und dankbar ich Ihnen dafür bin, dass Sie existieren, dass Sie so sind wie Sie sind und dass Sie mir erlauben, an diesem Ihrem Dasein einen kleinen entfernten Antheil zu nehmen." Christiane Thun-Salm empfand sich, "weil ich Schriftstellerin bin", als Außenseiterin ihrer noblen Kaste - die meisten Verwandten seien über sie "scandalisiert", klagte sie. Hofmannsthal, der stets den Eindruck erweckte, sie ernst zu nehmen, wurde ihr Verbündeter in artibus. An Charme und Ausstrahlung dürfte es der "gnädigen Gräfin" nicht gemangelt haben. Sie verkehrte im Bayreuther Kreis um Cosima Wagner, pflegte - worum Hofmannsthal sie beneidete - mit der Duse vertrauten Umgang. Aber mit der modernen Literatur hatte sie - deren wohlanständige Phantasieprodukte der greisen Baronin Ebner-Eschenbach zu keck vorkamen ("Aber Kind, das mußt Du abschwächen! Das geht ja knapp am Inzest vorüber!") - erhebliche Schwierigkeiten. Hauptmanns "Rose Bernd" hielt sie für "schändliches Zeug", und den nicht salonfähigen "Reigen" für eine "furchtbare Gemeinheit". Hofmannsthal zeigte sich über Schnitzlers Verdammung bestürzt und raffte sich zu einer halben Verteidigung auf - er sehe den Autor "in dieser Arbeit nirgends die Bescheidenheit des Künstlers, nirgends den Tact des Künstlers verletzen - nirgends, als vielleicht durch die Thatsache der Veröffentlichung".
Auch bei der Begutachtung seiner eigenen Werke bereitete die Gräfin ihrem Freund nicht nur ungetrübte Freude. Den berühmten Brief des Lord Chandos" deutete sie als Symptom und Ausdruck einer Schaffenskrise des Verfassers: "Die Arbeit ist doch das einzige Mittel dagegen, das einzige Gegengift. Ergreifen Sie's frisch!", ermunterte sie ihn. Dies Patentrezept überging er mit Schweigen. Aber mit der autobiographischen Interpretation stand Christiane Thun-Salm nicht allein: Auch Leopold von Andrian hatte von einem "Selbstbekenntnis" gesprochen.
Verbunden fühlten sich Christiane Thun-Salm und Hugo von Hofmannsthal durch ihre betont österreichische Haltung, durch den Widerwillen gegen preußischen Hochmut. Im Grunde haben wir eine wohltemperierte Konversation auf Papier vor uns. Man erzählte einander von Sorgen und Krankheiten - Christiane Thun-Salm musste ihren Gatten über Jahre hinweg pflegen -, man tauschte Tratsch aus. Einmal freilich fiel Hofmannsthal aus dem Rahmen des Kavalierstons, er verlor die Fassung. Ein leiser moralischer Tadel gab den Anstoß dazu. Die Lektüre von Hofmannsthals fünfaktigem Trauerspiel "Das gerettete Venedig" - mit Verlaub gesagt: kein Meisterwerk des Meisters, eher eines seiner missratenen Dramen - hatte Christiane Thun-Salm peinlich berührt. Das Verhältnis der beiden Hauptfiguren Pierre und Jaffier erschien ihr merkwürdig genug. Sie vermochte gar nicht unverblümt auszusprechen, was sie daran so störte, nannte die Ursache der Irritation nur "einen Zug, der - nach meinem Gefühl - die Sache verdirbt". Hofmannsthal begriff den kryptischen Hinweis sofort. Empört herrschte er die "gnädige Gräfin" an: "Ja, um Gotteswillen! Es ist mir nie im Traum so etwas eingefallen. Aber das klingt ja albern!" Was klingt so albern? Die Vermutung, der "kerngesunde Pierre" könnte zu Jaffier "anders stehen als tief sittlich, tief unerotisch, als Mann zum Mann", und er fuhr fort: "Ich bin wirklich ganz aufgeregt. Ja dann gäbe es ja keine Freundschaft zwischen Männern." Er ließ nicht locker, auch in einer Nachschrift beharrte er auf seiner Entrüstung: "Wie konnten Sie nur auf diesen Gedanken kommen! auf den Gedanken über Pierre und Jaffier. Es wäre mir so namenlos zuwider, dies nur als Schatten einer Möglichkeit zu sehen - ."
Auf die Standpauke folgte eine kleinlaute Antwort. Paul Thun, der jüngste Sohn der in doppelter Hinsicht Angegriffenen, bestätigte im Auftrag seiner an Lungenentzündung daniederliegenden Mutter dankend den Erhalt des Briefes. Die Patientin fügte die Entschuldigung hinzu: "Bitte, geben Sie doch nichts darauf! Ich war schon krank, als ich das Stück las. Gott weiss was ich las. Leben Sie wohl! Ich fühle mich sehr elend." Zur Ehre der Gescholtenen sei festgehalten: Christiane Thun-Salm war eine aufmerksamere, sensiblere Leserin als etwa der von Hofmannsthal ins Treffen geführte Zensor des Burgtheaters. Im "Geretteten Venedig", in der verqueren, hochgradig neurotischen Beziehung von Pierre und Jaffier (ein "allzu hübscher Bursche") findet sich eine erstaunliche Fülle homosexueller Anspielungen und Signale. Beabsichtigt war das keineswegs, und Hofmannsthal war von der Richtigkeit seiner Behauptung überzeugt. Doch das Unbewusste - das venezianische Opus ist "Dem Dichter Stefan George in Bewunderung und Freundschaft" zugeeignet - hatte ihm einen Streich gespielt. Umso entschiedener musste er jeglichen Verdacht von sich weisen. Der Geist Stefan Georges, dessen despotischer, überwältigender Zuneigung sich der poetische Wunderknabe Hofmannsthal einst brüsk entzogen hat, kehrt spukhaft in seinen Texten wieder - in versteckten Zitaten und unheimlichen Konstellationen zwischen Männern. Richard Alewyns Analyse hat nichts von ihrer Triftigkeit eingebüßt: "Die Gestalten der herrisch Fordernden, der unfruchtbar Erstarrenden und der zerstörend Gewaltsamen in Hofmannsthal Werk, sie sind von Georges Geschlecht."
So enthält der unspektakuläre Briefwechsel zwischen Christiane Thun-Salm und Hugo von Hofmannsthal bei näherer Betrachtung viel Anregendes, Erhellendes. Manches davon hat die kundige Herausgeberin in den Fußnoten verborgen. Zum Beispiel einen Satz des Grafen Lanckoronski an die Gräfin Thun-Salm aus dem Jahre 1919: "Über Hofmannsthal sind wir einer Meinung nur stört mich bei ihm seine Überkultur noch mehr als seine Abstammung." Der scharfe Beobachter Arthur Schnitzler diagnostizierte im Diarium als "Lebenskrankheit Hugos" den "Snobismus". Hofmannsthal, ein Snob par excellence, ist - gerade weil er das war - vor antisemitischen Anwandlungen nie gefeit gewesen. Der ordinäre Judenhass des Pöbels durfte ihm egal sein - er traf ihn nicht, da er sich nicht betroffen fühlte. Gelitten hat er unter dem feinen, in der Regel elegant verschwiegenen Antisemitismus des Hochadels. Beide Welten, die so genannte erste Gesellschaft und die zweite, zu der er gehörte, trennte eine hauchdünne, gläserne Wand. Denn bei aller Bewunderung des Künstlers Hofmannsthal konnten Kakaniens große Familien kaum je vergessen, dass im Wappen derer von Hofmannsthal auch die Gesetzestafeln des Alten Bundes prangten.
Renate Moering (Hrsg.): "Briefwechsel Hugo von Hofmannsthal - Christiane Gräfin Thun-Salm. Mit Briefen Hofmannsthals an Paul Graf Thun-Hohenstein". S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1999. 386 S., geb., 78,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Ulrich Weinzierl lobt in einer ausführlichen Rezension des Bandes die sehr sorgfältige Edition der Herausgeberin. Ein großer Gewinn liege unter anderem in den kundigen Anmerkungen, die hier geliefert werden und einen Hintergrund nachzeichnen, der in den Briefen selbst höchstens indirekt durchscheint - etwa den des vornehm verschwiegenen Antisemitismus der hochadligen Kreise, in denen sich der "Snob" Hugo von Hofmannsthal bewegte. Zur Gräfin Thun-Salm, die selbst als Dichterin dilettierte, hatte er eher ein distanziertes, höflich werbendes Verhältnis. Im Grunde, so der Rezensent, handelt es sich bei diesem Briefwechsel des großen Korrespondenten Hofmannsthal um eine "wohltemperierte Konversation auf Papier", die dennoch manches Erhellende bringe.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH