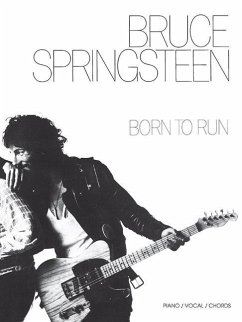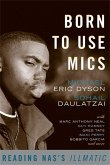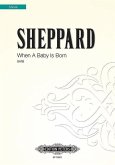Kann man sich diesen Mann auch mit Lesebrille vorstellen? Doch, es geht: Bruce Springsteen stellt in Frankfurt seine Autobiographie vor.
Musiker tun sich dieser Tage schwer in ihrer Rolle als Autoren. Bob Dylan ruft die Nobelpreisjury nicht zurück, und Bruce Springsteen, der mit seiner Autobiographie "Born to Run" (F.A.Z. vom 4. Oktober) seit einigen Wochen die Sachbuchbestsellerlisten in den großen Lesenationen anführt, musste jetzt auf (oder besser: neben) der Buchmesse eine zuvor lange geheim gehaltene Hotel-Bühne vor ausschließlich geladenen Journalisten und ohne Gitarre betreten, was ihn zu Beginn ein wenig fremdeln ließ.
Vielleicht liegt es daran, dass der sterile Kongressraum des Fünf-Sterne-Hauses eine klerikale Note aufweist, jedenfalls erinnert der "gute katholische Junge", als den sich Springsteen in seinem Buch bezeichnet, mit den gemessenen Schritten und dem gesenkten Kopf bei seinem Auftritt an einen Ministranten, der respektvoll in den Altarraum schreitet.
Die Fotografen dürfen aus zwanzig Metern Entfernung jetzt noch ein paar Fotos des Weltstars schießen, dann ist der Photocall vorbei, Springsteen setzt sich kerzengerade hin und schiebt seinen immer markanter werdenden Unterkiefer, der so gut zu seinem verschmitzten Jungenlächeln passt, nach vorne. Mit zunehmenden Jahren sieht er immer irischer aus.
"Yeah, incredible" sei es, wie gut sich sein Buch verkaufe. Sieben Jahre habe er daran geschrieben, begonnen habe alles mit einem Textversuch über seinen großen Auftritt beim Superbowl 2009. Ob er ein paar Szenen aus seinem Buch vorlesen wolle, fragt der Moderator Thomas Steinberg. "Sure", sagt Springsteen artig, setzt, scheinbar kurz mit seinem inneren Rock-'n'-Roll-Gewissen ringend, die Lesebrille auf und liest dann mit sicherer, rauher, nachdrücklicher Stimme einige kurze Passagen. Die eine ist vielleicht die eindrucksvollste des ganzen Buchs: Springsteen steht kurz vor der Geburt seines ersten Kindes, sein Vater Doug besucht ihn nach langer Autofahrt, um ihn um Verzeihung für patriarchalische Verfehlungen in den frühen Jahren zu bitten. Dieser Anfall von väterlicher Sensibilität muss den Musiker damals umgehauen haben, jetzt liest er alles mit warmer Distanz. Die entscheidenden Worte, die er damals an seinen Vater richtete, spricht er so fest und endgültig wie ein Priester: "You did the best you could." Eine Absolution. Springsteen liest "Born to Run" - das wäre ein Hörbuch!
Auf Fragen zu seiner Kunst antwortet er oft mit geschlossenen Augen, meist sehr poetisch, gar philosophisch, und dirigiert dabei seine Worte durch kleine Schwingungen mit der leicht geöffneten linken Hand. Beeindruckend, wie Springsteen die Wechselwirkung zwischen sich und seinem Konzertpublikum darstellt. Es langweile ihn keineswegs, seine größten Hits immer wieder zu spielen. Sehe er etwa ein Kind im Publikum, das mitsinge, höre er seinen eigenen Song auf der Bühne plötzlich vollkommen neu, durch die Ohren dieses Kindes.
Springsteen hat viel zu lachen an diesem Abend, oft tut er es schmutzig über sich selbst oder den Moderator, auch ein Gickeln und Jiepsen ist häufig zu vernehmen, schlagfertig hat er das ganze Gespräch im Griff. Eine Frage zu seinen Depressionen, welche er im Buch sehr ausführlich beschreibt, beantwortet er knapp. Er habe eine sehr gute Phase hinter sich, sagt er und lächelt wieder bubenhaft.
Der Kontroll-Freak, als den er sich im Buch recht ausführlich beschreibt, tritt erst am Ende des Gesprächs hervor: Oh, eine offene Fragerunde sei jetzt angesetzt? Na ja, "okay, go ahead", sagt Springsteen und ruft die zeichengebenden Journalisten in einer Weise auf, die keinen Zweifel darüber zulässt, wer hier der Boss ist. Die beste Frage des Abends: Ob "redemption", Erlösung, in seiner Kunst die zentrale Rolle spiele. Springsteen horcht auf, reckt sich, fühlt sich erkannt, er bestätigt und ergänzt, Erlösung erfahre er aber nicht nur auf der Bühne, sondern zunehmend auch im Zusammensein mit seinen Kindern - "a healing experience", eine heilsame Erfahrung.
Es komme in der Musik nicht darauf an, "great lyrics" zu schreiben, sagt er an diesem Abend, entscheidend sei, dass es die "right lyrics" seien. Das war dann zugleich ein Kommentar zum Literaturnobelpreis. Zum Schluss noch drei Signierminuten, ein einzelnes Selfie, dann "Let's have a drink" und Abgang mit zufriedenem Grinsen.
UWE EBBINGHAUS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main