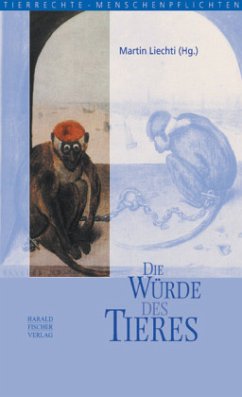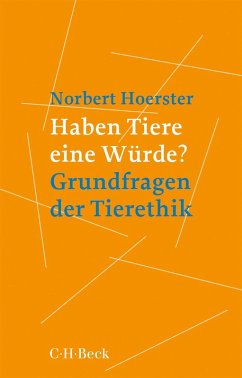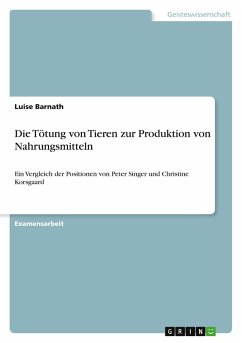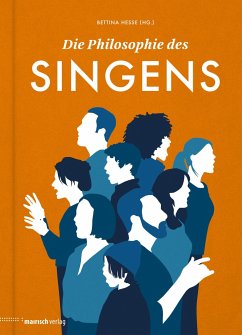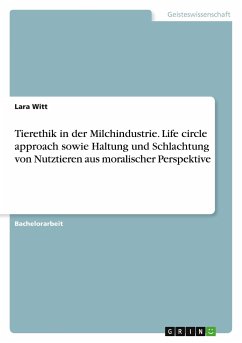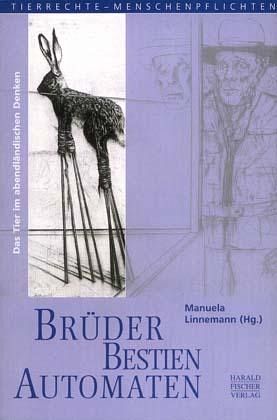
Brüder - Bestien - Automaten
Das Tier im abendländischen Denken
Herausgegeben: Linnemann, Manuela
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
24,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Thema "Tier": Von der Antike bis zur Gegenwart"Brüder", "Bestien", "Automaten" sind nur drei Bezeichnungen aus der Fülle von Namen, die dem Tier im abendländischen Denken gegeben wurden, doch sie stehen exemplarisch für die zentralen Positionen innerhalb der Kontroversen um das Wesen des Tieres.
"Brüder", "Bestien", "Automaten" sind nur drei Bezeichnungen aus der Fülle von Namen, die dem Tier im abendländischen Denken gegeben wurden, doch sie stehen exemplarisch für die zentralen Positionen innerhalb der Kontroversen um das Wesen des Tieres.Die vorliegende Anthologie bietet mit etwas mehr als hundert Textauszügen in chronologischer Folge einen repräsentativen Überblick über die Vorstellungen zum Thema "Tier" von der Antike bis zur Gegenwart. Dabei kommen nicht nur die Klassiker der Geistesgeschichte zu Wort, sondern auch weniger bekannte Autoren. Eine Reihe von Texten wurde eigens für den Sammelband übersetzt und liegt hier erstmals in deutscher Sprache vor.Philosophische, populärwissenschaftliche, literarische, journalistische und auch polemische Texte bieten Einblick in die vielfältigen Facetten des Nachdenkens über Tiere. Die Vertreter der Auffassung einer unüberwindbaren Kluft zwischen Mensch und Tier und eines uneingeschränkten Herrschaftsanspruchs des Menschen überdie Tiere waren in den letzten zweitausend Jahren in der großen Überzahl; Stimmen zu Gunsten der Tiere gab es dennoch immer.Als Vordenker und Vorläufer des Tierschutzgedankens von der Antike bis zur Neuzeit und von den Begründern der modernen Tierschutz- und Tierrechtsbewegung kommen unter anderem zu Wort: Plutarch, Porphyrios, Leonardo da Vinci, Thomas Tryon, Humphry Primatt, Wilhelm Dietler, Lauritz Smith, Hermann Gaggett, Jean Antoine Gleizés, Lewis Gompertz und Henry S. Salt.Die Herausgeberin Manuela Linnemann verfaßte für das Historische Wörterbuch der Philosophie den Artikel "Tierrecht".
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.