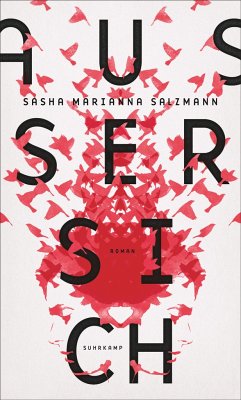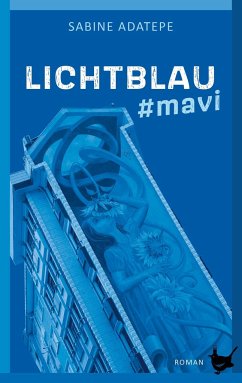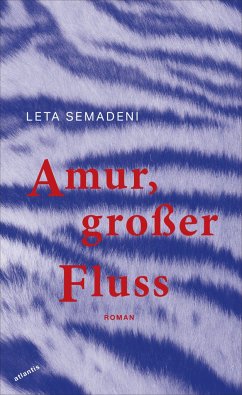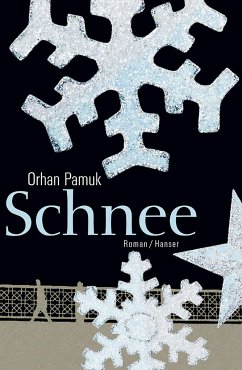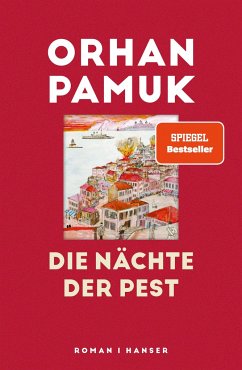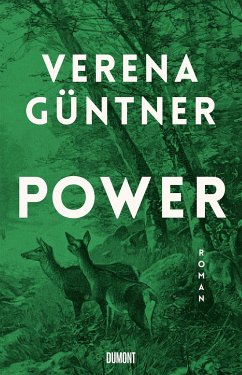Nicht lieferbar
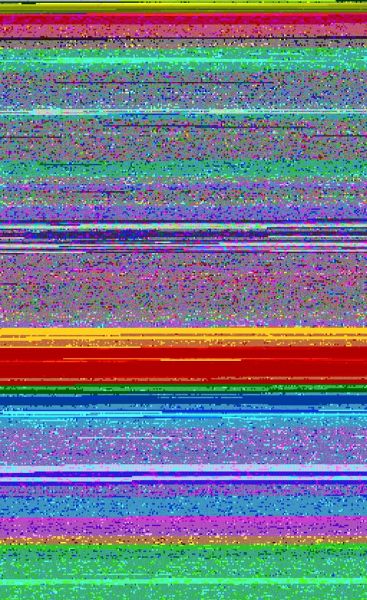
Buch gegen das Verschwinden
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Ein junger Journalist versucht inmitten der Unruhen um den Istanbuler Gezi-Park die Erwartungen seiner Mutter abzuschütteln, die nach dem Mauerfall 1989 das Reisefieber gepackt hat. Ein Wanderer geht während eines Schneesturms in den uralten verwunschenen Wäldern des Engadin verloren. Ein kleines Mädchen wird zum nächsten Venusdurchgang von der Großmutter ans Ende der Welt geflogen. Wohin ihre Spuren führen, ist eines der vielen Rätsel dieser Geschichten. Ulrike Almut Sandig beschreibt mit ihrer farbigen und poetischen Sprache nur scheinbar vergangene Orte. In Wirklichkeit leben sie in...
Ein junger Journalist versucht inmitten der Unruhen um den Istanbuler Gezi-Park die Erwartungen seiner Mutter abzuschütteln, die nach dem Mauerfall 1989 das Reisefieber gepackt hat. Ein Wanderer geht während eines Schneesturms in den uralten verwunschenen Wäldern des Engadin verloren. Ein kleines Mädchen wird zum nächsten Venusdurchgang von der Großmutter ans Ende der Welt geflogen. Wohin ihre Spuren führen, ist eines der vielen Rätsel dieser Geschichten. Ulrike Almut Sandig beschreibt mit ihrer farbigen und poetischen Sprache nur scheinbar vergangene Orte. In Wirklichkeit leben sie in den Biografien der Älteren und den Lebensentwürfen der jungen Generation fort. Beziehungen werden von den Stürmen der Geschichte durchweht und trügerische Gewissheiten geraten ins Wanken. In ihrem neuen Buch bietet Ulrike Almut Sandig den Zauber des Erzählens gegen das Verschwinden ganzer Welten aus dem Bewusstsein auf.