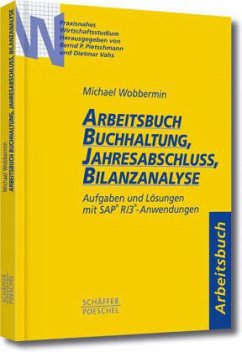Michael Wobbermin
Buchhaltung, Jahresabschluß, Bilanzanalyse
Einführung mit Fallbeispielen und Kontrollfragen
Michael Wobbermin
Buchhaltung, Jahresabschluß, Bilanzanalyse
Einführung mit Fallbeispielen und Kontrollfragen
- Broschiertes Buch
- Merkliste
- Auf die Merkliste
- Bewerten Bewerten
- Teilen
- Produkt teilen
- Produkterinnerung
- Produkterinnerung
Eine praxisorientierte Aufbereitung der Grundlagen der Buchführung, auch aus der internationalen Perspektive. Mit Beispielen, Übungsaufgaben und einer Fallstudie.
Eine Einführung in die Thematik des externen Rechnungswesens erfordert eine umfassende, international orientierte Darstellung.
Ausgehend vom Konzept einer "Bilanzkampagne" Grundlegende Technik Organisationsstruktur der Finanzbuchhaltung Die gängige Standardsoftware Vergleich deutsche und internationale Bilanzierungsstandards Die langjährige praktische Erfahrung des Autors in der Industrie wird in den vielen Beispielen, Übungsaufgaben und der durchgehenden Fallstudie deutlich.…mehr
Andere Kunden interessierten sich auch für
Eine praxisorientierte Aufbereitung der Grundlagen der Buchführung, auch aus der internationalen Perspektive. Mit Beispielen, Übungsaufgaben und einer Fallstudie.
Eine Einführung in die Thematik des externen Rechnungswesens erfordert eine umfassende, international orientierte Darstellung.
Ausgehend vom Konzept einer "Bilanzkampagne"
Grundlegende Technik
Organisationsstruktur der Finanzbuchhaltung
Die gängige Standardsoftware
Vergleich deutsche und internationale Bilanzierungsstandards
Die langjährige praktische Erfahrung des Autors in der Industrie wird in den vielen Beispielen, Übungsaufgaben und der durchgehenden Fallstudie deutlich.
Eine Einführung in die Thematik des externen Rechnungswesens erfordert eine umfassende, international orientierte Darstellung.
Ausgehend vom Konzept einer "Bilanzkampagne"
Grundlegende Technik
Organisationsstruktur der Finanzbuchhaltung
Die gängige Standardsoftware
Vergleich deutsche und internationale Bilanzierungsstandards
Die langjährige praktische Erfahrung des Autors in der Industrie wird in den vielen Beispielen, Übungsaufgaben und der durchgehenden Fallstudie deutlich.
Produktdetails
- Produktdetails
- Praxisnahes Wirtschaftsstudium
- Verlag: Schäffer-Poeschel
- 1. Auflage 1999
- Seitenzahl: 324
- Deutsch
- Abmessung: 240mm
- Gewicht: 630g
- ISBN-13: 9783791014470
- ISBN-10: 3791014471
- Artikelnr.: 07864780
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
- Praxisnahes Wirtschaftsstudium
- Verlag: Schäffer-Poeschel
- 1. Auflage 1999
- Seitenzahl: 324
- Deutsch
- Abmessung: 240mm
- Gewicht: 630g
- ISBN-13: 9783791014470
- ISBN-10: 3791014471
- Artikelnr.: 07864780
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Prof. Dr. Michael Wobbermin lehrt seit 1996 an der Hochschule Reutlingen Rechnungswesen und Softwareentwicklung. Nach der Promotion an der Universität Tübingen war er 15 Jahre in namhaften Unternehmen der Automobilindustrie Baden-Württembergs als Führungskraft in den Bereichen Investor Relations und Bilanzierung tätig. Er ist Lehrbeauftragter an der Berufsakademie Stuttgart, der Exportakademie Baden-Württemberg und der Internet Business School Educatis in Altdorf, Schweiz. An der IHK Stuttgart ist er ehrenamtliches Mitglied der Prüfungskommission Bilanzbuchhaltung International. Im Bundesfachausschuss des DIHK wirkt er an der bundeseinheitlichen Aufgabenerstellung im Fach Abschlüsse nach internationalen Standards mit. Seine Forschungsschwerpunkte sind die nationale und internationale Bilanzierung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber V
Vorwort VII
Abkürzungsverzeichnis XIV
Abbildungsverzeichnis XVIII
1 Zur Struktur des Rechnungswesens 1
1.1 Externes - internes Rechnungswesen 2
1.2 Instrumente der Finanzbuchhaltung 10
1.3 Wesentliche rechtliche Vorschriften zur Rechnungslegung 11
1.3.1 Handels-, steuerrechtliche und sonstige Regelungen 12
1.3.2 Prüfungs-, Publizitäts- und Sanktionsvorschriften 19
1.4 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 23
1.5 Kontrollfragen zu Kapitel 1 25
2 Wegweiser für eine "Bilanzkampagne" 27
2.1 Zeitlicher Rahmen für eine "Bilanzkampagne" 27
2.2 Inventur als Ausgangspunkt einer "Bilanzkampagne" 31
2.3 Inventar 34
2.4 Jahresabschluß: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang 37
2.5 Investor Relations-Instrumente 39
2.5.1 Bilanzpressekonferenz, Finanzanalystentreffen und Investorenmeeting 39
2.5.2 Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft 42
2.5.2.1 Im Vorfeld einer Hauptversammlung 42
2.5.2.2 Durchführung einer Hauptversammlung 45
2.5.2.3 Ende der "Bilanzkampagne": Gewinnausschüttung an Eigentümer 50
2.6 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 2 52
3 Grundlegende Technik der Buchhaltung 54
3.1 Erfolgsneutrale Buchungsvorgänge 54
3.1.1 Bebuchen von Bestandskonten 54
3.1.2 Proezßkette: Eröffnungsbilanz - Bestandskonten - Schlußbilanz 56
3.2 Buchungssätze 58
3.3 Hauptbuch oder Sachkontendarstellung 60
3.4 Erfolgswirksame Buchungsvorgänge: Aufwendungen und Erträge 62
3.4.1 Erfolgskonten 64
3.4.2 Das Gewinn- und Verlustkonto 65
3.5 Abschreibungen 66
3.6 Privatentnahmen und Privateinlagen 67
3.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 3 69
4 Organisation der Buchhaltung 72
4.1 Kontenrahmen und Kontenpläne 72
4.1.1 Trennung von Aufwand und Kosten 74
4.1.2 Gemeinschaftskontenrahmen 75
4.1.2.1 Einkreissystem und Prozeßgliederungsprinzip 75
4.1.2.2 Erläuterung der Kontenklassen - Betriebsergebniskonto 77
4.1.2.3 Kritik am Gemeinschaftskontenrahmen 78
4.1.3 Industriekontenrahmen 79
4.1.3.1 Zweikreissystem und Abschlußgliederungsprinzip 79
4.1.3.2 Erläuterung der Kontenklassen - Abgrenzungsrechnung 80
4.1.4 Gewinn- und Verlustrechnung: Gesamtkosten- oder Umsatzkostenverfahren 82
4.1.4.1 Unterschiede zwischen Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren 83
4.1.4.2 Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren: ein Zahlenbeispiel 86
4.2 Konventionelle und EDV-gestützte Finanzbuchhaltung 87
4.2.1 Organisatorische Grundlagen: Grund-, Hauptbuch, Nebenbücher 87
4.2.2 Konventionelle Finanzbuchhaltung 91
4.2.3 Einsatz von Standardsoftware 91
4.3 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 4 96
5 Buchung laufender Geschäftsfälle 98
5.1 Die Umsatzsteuer 98
5.1.1 Strukturmerkmale 98
5.1.2 Grundlegende Umsatzsteuerbuchungen 102
5.1.3 Eigenverbrauch 104
5.2 Lieferanten- und Kundenbeziehungen 106
5.2.1 Buchung von Anschaffungsnebenkosten 106
5.2.2 Handel mit Waren 108
5.2.3 Rücksendungen unbrauchbarer Lieferungen und Erzeugnisse bzw. Produkte 109
5.2.4 Preisnachlässe 111
5.2.4.1 Sofortrabatte, Boni und Mängelrügen 111
5.2.4.2 Skonti 113
5.2.5 Materialbuchungen: Lagerentnahmen oder Just-in-Time-Lieferungen 114
5.3 Finanzbereich 117
5.3.1 Wechselbuchungen 117
5.3.1.1 Bedeutung und Funktion des Wechsels 117
5.3.1.2 Wesentliche Wechselgeschäfte 120
5.3.2 Scheckbuchungen 124
5.3.3 An- und Verkauf von sonstigen Wertpapieren 125
5.3.4 Auszahlung der Dividende einer Aktiengesellschaft 126
5.3.5 Anzahlungen 128
5.3.5.1 Erhaltene Anzahlungen auf Vorratsbestellungen 128
5.3.5.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorratslieferungen 129
5.3.5.3 Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau 130
5.4 Verbuchung des Personalaufwands 131
5.4.1 Bestandteile des Personalaufwands 131
5.4.2 Buchungstechnik des Personalaufwands 133
5.4.3 Vorschüsse, Geldwerter Vorteil und Vermögenswirksame Leistungen 134
5.5 Besonderheiten der Anlagenbuchhaltung 136
5.5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 138
5.5.2 Andere aktivierte Eigenleistungen 141
5.5.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 141
5.5.4 Abschreibungen auf "Geringwertige Wirtschaftsgüter" 143
5.5.5 Veräußerung von Anlagegütern 146
5.6 Steuern des Unternehmens aus der Sicht des Finanzbuchhalters 148
5.6.1 Einkunftsarten des deutschen Steuerrechts 149
5.6.2 Gewinnabhängige und gewinnunabhängige Steuern (§ 275 HGB) 152
5.6.2.1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 152
5.6.2.2 Sonstige Steuern und Besonderheiten 154
5.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 5 156
6 Der Jahresabschluß 159
6.1 Abgrenzungen 159
6.1.1 Sonstige Forderungen und Sonstige Verbindlichkeiten 160
6.1.2 Aktive und passive Rechnungsabgrenzung 161
6.1.3 Rückstellungen 163
6.1.3.1 Überblick und grundlegende Rückstellungsbuchungen 164
6.1.3.2 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 167
6.1.3.3 Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen 168
6.2 Grundlegende Bewertungsmaßnahmen 172
6.2.1 Handels- und Steuerbilanz: das Maßgeblichkeitsprinzip 173
6.2.2 Bewertungsgrundsätze nach § 252 HGB 174
6.2.3 Wertmaßstäbe: Anschaffungs- und Herstellungskosten, Tages- und Teilwert 177
6.2.4 Ein Beispiel aus der Praxis: das Lohndeckungsverfahren zur Ermittlung der Herstellungskosten 181
6.2.5 Imparitätsprinzip 183
6.3 Spezielle Bewertungsmaßnahmen 186
6.3.1 Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens 186
6.3.2 Bewertung von Vorräten: Fest-, Durchschnittsbewertung und Verbrauchsfolgeverfahren 187
6.3.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen 190
6.3.4 Bewertung von Wertpapieren 195
6.3.5 Bewertung der Verbindlichkeiten 199
6.4 Hauptabschlußübersicht 201
6.5 Erfolgsverbuchung ausgewählter Rechtsformen 204
6.5.1 Einzelunternehmen und Personengesellschaften 204
6.5.2 Kapitalgesellschaften 206
6.6 Bilanzierung im Umbruch: Orientierung an internationalen Maßstäben 209
6.6.1 Weltmärkte im Wandel - "Treck zur Wall Street" 210
6.6.2 Wesentliche Unterschiede zwischen US-GAAP bzw. IAS und HGB 213
6.6.3 Auswirkungen für die deutsche Rechnungslegung 216
6.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 6 219
7 Auswertung des Jahresabschlusses der Speedy GmbH 223
7.1 Bilanzanalyse 223
7.1.1 Bilanz der Speedy GmbH 223
7.1.2 Beurteilung der Kapitalstruktur 225
7.1.3 Analyse der Vermögensstruktur 227
7.1.4 Liquiditätsanalyse 228
7.1.4.1 Langfristige Sicherung der Liquidität 229
7.1.4.2 Kurzfristige Sicherung der Liquidität 230
7.1.5 Die Bewegungsbilanz: Aufdeckung von Finanzierungs- und Investitionsvorgängen 232
7.2 Analyse des Erfolgs 233
7.2.1 Gewinn- und Verlustrechnung der Speedy GmbH: Beurteilung der Aufwands-
und Ertragsstruktur 233
7.2.2 Wirtschaftlichkeitskennzahlen 236
7.2.2.1 Umschlag der Vorräte 236
7.2.2.2 Forderungsumsetzung: Entwicklung des Zahlungsziels 238
7.2.2.3 Kapitalumschlag 239
7.2.3 Renditekennziffern 240
7.2.3.1 Kapitalrenditen 240
7.2.3.2 Umsatzrendite 243
7.2.4 Cash-Flow-Analyse 244
7.2.5 Zwei Alternativen zum "Jahresüberschuß" nach HGB 246
7.2.5.1 Rendite und Börsenbewertung: Ergebnis nach DVFA/SG 246
7.2.5.2 Operating Profit nach US-GAAP 248
7.3 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 7 249
8 Konsequenzen für die Speedy GmbH 251
Lösungshinweise zu den Kontrollfragen und Übungsaufgaben 255
Kapitel 1 255
Kapitel 2 257
Kapitel 3 260
Kapitel 4 264
Kapitel 5 268
Kapitel 6 274
Kapitel 7 278
Zwei Klausuren "externes Rechnungswesen" mit Lösungshinweisen 281
Industriekontenrahmen (IKR) 288
Literaturverzeichnis 291
Stichwortverzeichnis 299
(c) 1999 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH & Co. KG
Vorwort der Herausgeber V
Vorwort VII
Abkürzungsverzeichnis XIV
Abbildungsverzeichnis XVIII
1 Zur Struktur des Rechnungswesens 1
1.1 Externes - internes Rechnungswesen 2
1.2 Instrumente der Finanzbuchhaltung 10
1.3 Wesentliche rechtliche Vorschriften zur Rechnungslegung 11
1.3.1 Handels-, steuerrechtliche und sonstige Regelungen 12
1.3.2 Prüfungs-, Publizitäts- und Sanktionsvorschriften 19
1.4 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 23
1.5 Kontrollfragen zu Kapitel 1 25
2 Wegweiser für eine "Bilanzkampagne" 27
2.1 Zeitlicher Rahmen für eine "Bilanzkampagne" 27
2.2 Inventur als Ausgangspunkt einer "Bilanzkampagne" 31
2.3 Inventar 34
2.4 Jahresabschluß: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang 37
2.5 Investor Relations-Instrumente 39
2.5.1 Bilanzpressekonferenz, Finanzanalystentreffen und Investorenmeeting 39
2.5.2 Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft 42
2.5.2.1 Im Vorfeld einer Hauptversammlung 42
2.5.2.2 Durchführung einer Hauptversammlung 45
2.5.2.3 Ende der "Bilanzkampagne": Gewinnausschüttung an Eigentümer 50
2.6 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 2 52
3 Grundlegende Technik der Buchhaltung 54
3.1 Erfolgsneutrale Buchungsvorgänge 54
3.1.1 Bebuchen von Bestandskonten 54
3.1.2 Proezßkette: Eröffnungsbilanz - Bestandskonten - Schlußbilanz 56
3.2 Buchungssätze 58
3.3 Hauptbuch oder Sachkontendarstellung 60
3.4 Erfolgswirksame Buchungsvorgänge: Aufwendungen und Erträge 62
3.4.1 Erfolgskonten 64
3.4.2 Das Gewinn- und Verlustkonto 65
3.5 Abschreibungen 66
3.6 Privatentnahmen und Privateinlagen 67
3.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 3 69
4 Organisation der Buchhaltung 72
4.1 Kontenrahmen und Kontenpläne 72
4.1.1 Trennung von Aufwand und Kosten 74
4.1.2 Gemeinschaftskontenrahmen 75
4.1.2.1 Einkreissystem und Prozeßgliederungsprinzip 75
4.1.2.2 Erläuterung der Kontenklassen - Betriebsergebniskonto 77
4.1.2.3 Kritik am Gemeinschaftskontenrahmen 78
4.1.3 Industriekontenrahmen 79
4.1.3.1 Zweikreissystem und Abschlußgliederungsprinzip 79
4.1.3.2 Erläuterung der Kontenklassen - Abgrenzungsrechnung 80
4.1.4 Gewinn- und Verlustrechnung: Gesamtkosten- oder Umsatzkostenverfahren 82
4.1.4.1 Unterschiede zwischen Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren 83
4.1.4.2 Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren: ein Zahlenbeispiel 86
4.2 Konventionelle und EDV-gestützte Finanzbuchhaltung 87
4.2.1 Organisatorische Grundlagen: Grund-, Hauptbuch, Nebenbücher 87
4.2.2 Konventionelle Finanzbuchhaltung 91
4.2.3 Einsatz von Standardsoftware 91
4.3 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 4 96
5 Buchung laufender Geschäftsfälle 98
5.1 Die Umsatzsteuer 98
5.1.1 Strukturmerkmale 98
5.1.2 Grundlegende Umsatzsteuerbuchungen 102
5.1.3 Eigenverbrauch 104
5.2 Lieferanten- und Kundenbeziehungen 106
5.2.1 Buchung von Anschaffungsnebenkosten 106
5.2.2 Handel mit Waren 108
5.2.3 Rücksendungen unbrauchbarer Lieferungen und Erzeugnisse bzw. Produkte 109
5.2.4 Preisnachlässe 111
5.2.4.1 Sofortrabatte, Boni und Mängelrügen 111
5.2.4.2 Skonti 113
5.2.5 Materialbuchungen: Lagerentnahmen oder Just-in-Time-Lieferungen 114
5.3 Finanzbereich 117
5.3.1 Wechselbuchungen 117
5.3.1.1 Bedeutung und Funktion des Wechsels 117
5.3.1.2 Wesentliche Wechselgeschäfte 120
5.3.2 Scheckbuchungen 124
5.3.3 An- und Verkauf von sonstigen Wertpapieren 125
5.3.4 Auszahlung der Dividende einer Aktiengesellschaft 126
5.3.5 Anzahlungen 128
5.3.5.1 Erhaltene Anzahlungen auf Vorratsbestellungen 128
5.3.5.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorratslieferungen 129
5.3.5.3 Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau 130
5.4 Verbuchung des Personalaufwands 131
5.4.1 Bestandteile des Personalaufwands 131
5.4.2 Buchungstechnik des Personalaufwands 133
5.4.3 Vorschüsse, Geldwerter Vorteil und Vermögenswirksame Leistungen 134
5.5 Besonderheiten der Anlagenbuchhaltung 136
5.5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 138
5.5.2 Andere aktivierte Eigenleistungen 141
5.5.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 141
5.5.4 Abschreibungen auf "Geringwertige Wirtschaftsgüter" 143
5.5.5 Veräußerung von Anlagegütern 146
5.6 Steuern des Unternehmens aus der Sicht des Finanzbuchhalters 148
5.6.1 Einkunftsarten des deutschen Steuerrechts 149
5.6.2 Gewinnabhängige und gewinnunabhängige Steuern (§ 275 HGB) 152
5.6.2.1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 152
5.6.2.2 Sonstige Steuern und Besonderheiten 154
5.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 5 156
6 Der Jahresabschluß 159
6.1 Abgrenzungen 159
6.1.1 Sonstige Forderungen und Sonstige Verbindlichkeiten 160
6.1.2 Aktive und passive Rechnungsabgrenzung 161
6.1.3 Rückstellungen 163
6.1.3.1 Überblick und grundlegende Rückstellungsbuchungen 164
6.1.3.2 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 167
6.1.3.3 Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen 168
6.2 Grundlegende Bewertungsmaßnahmen 172
6.2.1 Handels- und Steuerbilanz: das Maßgeblichkeitsprinzip 173
6.2.2 Bewertungsgrundsätze nach § 252 HGB 174
6.2.3 Wertmaßstäbe: Anschaffungs- und Herstellungskosten, Tages- und Teilwert 177
6.2.4 Ein Beispiel aus der Praxis: das Lohndeckungsverfahren zur Ermittlung der Herstellungskosten 181
6.2.5 Imparitätsprinzip 183
6.3 Spezielle Bewertungsmaßnahmen 186
6.3.1 Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens 186
6.3.2 Bewertung von Vorräten: Fest-, Durchschnittsbewertung und Verbrauchsfolgeverfahren 187
6.3.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen 190
6.3.4 Bewertung von Wertpapieren 195
6.3.5 Bewertung der Verbindlichkeiten 199
6.4 Hauptabschlußübersicht 201
6.5 Erfolgsverbuchung ausgewählter Rechtsformen 204
6.5.1 Einzelunternehmen und Personengesellschaften 204
6.5.2 Kapitalgesellschaften 206
6.6 Bilanzierung im Umbruch: Orientierung an internationalen Maßstäben 209
6.6.1 Weltmärkte im Wandel - "Treck zur Wall Street" 210
6.6.2 Wesentliche Unterschiede zwischen US-GAAP bzw. IAS und HGB 213
6.6.3 Auswirkungen für die deutsche Rechnungslegung 216
6.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 6 219
7 Auswertung des Jahresabschlusses der Speedy GmbH 223
7.1 Bilanzanalyse 223
7.1.1 Bilanz der Speedy GmbH 223
7.1.2 Beurteilung der Kapitalstruktur 225
7.1.3 Analyse der Vermögensstruktur 227
7.1.4 Liquiditätsanalyse 228
7.1.4.1 Langfristige Sicherung der Liquidität 229
7.1.4.2 Kurzfristige Sicherung der Liquidität 230
7.1.5 Die Bewegungsbilanz: Aufdeckung von Finanzierungs- und Investitionsvorgängen 232
7.2 Analyse des Erfolgs 233
7.2.1 Gewinn- und Verlustrechnung der Speedy GmbH: Beurteilung der Aufwands-
und Ertragsstruktur 233
7.2.2 Wirtschaftlichkeitskennzahlen 236
7.2.2.1 Umschlag der Vorräte 236
7.2.2.2 Forderungsumsetzung: Entwicklung des Zahlungsziels 238
7.2.2.3 Kapitalumschlag 239
7.2.3 Renditekennziffern 240
7.2.3.1 Kapitalrenditen 240
7.2.3.2 Umsatzrendite 243
7.2.4 Cash-Flow-Analyse 244
7.2.5 Zwei Alternativen zum "Jahresüberschuß" nach HGB 246
7.2.5.1 Rendite und Börsenbewertung: Ergebnis nach DVFA/SG 246
7.2.5.2 Operating Profit nach US-GAAP 248
7.3 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 7 249
8 Konsequenzen für die Speedy GmbH 251
Lösungshinweise zu den Kontrollfragen und Übungsaufgaben 255
Kapitel 1 255
Kapitel 2 257
Kapitel 3 260
Kapitel 4 264
Kapitel 5 268
Kapitel 6 274
Kapitel 7 278
Zwei Klausuren "externes Rechnungswesen" mit Lösungshinweisen 281
Industriekontenrahmen (IKR) 288
Literaturverzeichnis 291
Stichwortverzeichnis 299
(c) 1999 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH & Co. KG
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber V
Vorwort VII
Abkürzungsverzeichnis XIV
Abbildungsverzeichnis XVIII
1 Zur Struktur des Rechnungswesens 1
1.1 Externes - internes Rechnungswesen 2
1.2 Instrumente der Finanzbuchhaltung 10
1.3 Wesentliche rechtliche Vorschriften zur Rechnungslegung 11
1.3.1 Handels-, steuerrechtliche und sonstige Regelungen 12
1.3.2 Prüfungs-, Publizitäts- und Sanktionsvorschriften 19
1.4 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 23
1.5 Kontrollfragen zu Kapitel 1 25
2 Wegweiser für eine "Bilanzkampagne" 27
2.1 Zeitlicher Rahmen für eine "Bilanzkampagne" 27
2.2 Inventur als Ausgangspunkt einer "Bilanzkampagne" 31
2.3 Inventar 34
2.4 Jahresabschluß: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang 37
2.5 Investor Relations-Instrumente 39
2.5.1 Bilanzpressekonferenz, Finanzanalystentreffen und Investorenmeeting 39
2.5.2 Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft 42
2.5.2.1 Im Vorfeld einer Hauptversammlung 42
2.5.2.2 Durchführung einer Hauptversammlung 45
2.5.2.3 Ende der "Bilanzkampagne": Gewinnausschüttung an Eigentümer 50
2.6 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 2 52
3 Grundlegende Technik der Buchhaltung 54
3.1 Erfolgsneutrale Buchungsvorgänge 54
3.1.1 Bebuchen von Bestandskonten 54
3.1.2 Proezßkette: Eröffnungsbilanz - Bestandskonten - Schlußbilanz 56
3.2 Buchungssätze 58
3.3 Hauptbuch oder Sachkontendarstellung 60
3.4 Erfolgswirksame Buchungsvorgänge: Aufwendungen und Erträge 62
3.4.1 Erfolgskonten 64
3.4.2 Das Gewinn- und Verlustkonto 65
3.5 Abschreibungen 66
3.6 Privatentnahmen und Privateinlagen 67
3.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 3 69
4 Organisation der Buchhaltung 72
4.1 Kontenrahmen und Kontenpläne 72
4.1.1 Trennung von Aufwand und Kosten 74
4.1.2 Gemeinschaftskontenrahmen 75
4.1.2.1 Einkreissystem und Prozeßgliederungsprinzip 75
4.1.2.2 Erläuterung der Kontenklassen - Betriebsergebniskonto 77
4.1.2.3 Kritik am Gemeinschaftskontenrahmen 78
4.1.3 Industriekontenrahmen 79
4.1.3.1 Zweikreissystem und Abschlußgliederungsprinzip 79
4.1.3.2 Erläuterung der Kontenklassen - Abgrenzungsrechnung 80
4.1.4 Gewinn- und Verlustrechnung: Gesamtkosten- oder Umsatzkostenverfahren 82
4.1.4.1 Unterschiede zwischen Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren 83
4.1.4.2 Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren: ein Zahlenbeispiel 86
4.2 Konventionelle und EDV-gestützte Finanzbuchhaltung 87
4.2.1 Organisatorische Grundlagen: Grund-, Hauptbuch, Nebenbücher 87
4.2.2 Konventionelle Finanzbuchhaltung 91
4.2.3 Einsatz von Standardsoftware 91
4.3 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 4 96
5 Buchung laufender Geschäftsfälle 98
5.1 Die Umsatzsteuer 98
5.1.1 Strukturmerkmale 98
5.1.2 Grundlegende Umsatzsteuerbuchungen 102
5.1.3 Eigenverbrauch 104
5.2 Lieferanten- und Kundenbeziehungen 106
5.2.1 Buchung von Anschaffungsnebenkosten 106
5.2.2 Handel mit Waren 108
5.2.3 Rücksendungen unbrauchbarer Lieferungen und Erzeugnisse bzw. Produkte 109
5.2.4 Preisnachlässe 111
5.2.4.1 Sofortrabatte, Boni und Mängelrügen 111
5.2.4.2 Skonti 113
5.2.5 Materialbuchungen: Lagerentnahmen oder Just-in-Time-Lieferungen 114
5.3 Finanzbereich 117
5.3.1 Wechselbuchungen 117
5.3.1.1 Bedeutung und Funktion des Wechsels 117
5.3.1.2 Wesentliche Wechselgeschäfte 120
5.3.2 Scheckbuchungen 124
5.3.3 An- und Verkauf von sonstigen Wertpapieren 125
5.3.4 Auszahlung der Dividende einer Aktiengesellschaft 126
5.3.5 Anzahlungen 128
5.3.5.1 Erhaltene Anzahlungen auf Vorratsbestellungen 128
5.3.5.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorratslieferungen 129
5.3.5.3 Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau 130
5.4 Verbuchung des Personalaufwands 131
5.4.1 Bestandteile des Personalaufwands 131
5.4.2 Buchungstechnik des Personalaufwands 133
5.4.3 Vorschüsse, Geldwerter Vorteil und Vermögenswirksame Leistungen 134
5.5 Besonderheiten der Anlagenbuchhaltung 136
5.5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 138
5.5.2 Andere aktivierte Eigenleistungen 141
5.5.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 141
5.5.4 Abschreibungen auf "Geringwertige Wirtschaftsgüter" 143
5.5.5 Veräußerung von Anlagegütern 146
5.6 Steuern des Unternehmens aus der Sicht des Finanzbuchhalters 148
5.6.1 Einkunftsarten des deutschen Steuerrechts 149
5.6.2 Gewinnabhängige und gewinnunabhängige Steuern (§ 275 HGB) 152
5.6.2.1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 152
5.6.2.2 Sonstige Steuern und Besonderheiten 154
5.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 5 156
6 Der Jahresabschluß 159
6.1 Abgrenzungen 159
6.1.1 Sonstige Forderungen und Sonstige Verbindlichkeiten 160
6.1.2 Aktive und passive Rechnungsabgrenzung 161
6.1.3 Rückstellungen 163
6.1.3.1 Überblick und grundlegende Rückstellungsbuchungen 164
6.1.3.2 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 167
6.1.3.3 Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen 168
6.2 Grundlegende Bewertungsmaßnahmen 172
6.2.1 Handels- und Steuerbilanz: das Maßgeblichkeitsprinzip 173
6.2.2 Bewertungsgrundsätze nach § 252 HGB 174
6.2.3 Wertmaßstäbe: Anschaffungs- und Herstellungskosten, Tages- und Teilwert 177
6.2.4 Ein Beispiel aus der Praxis: das Lohndeckungsverfahren zur Ermittlung der Herstellungskosten 181
6.2.5 Imparitätsprinzip 183
6.3 Spezielle Bewertungsmaßnahmen 186
6.3.1 Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens 186
6.3.2 Bewertung von Vorräten: Fest-, Durchschnittsbewertung und Verbrauchsfolgeverfahren 187
6.3.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen 190
6.3.4 Bewertung von Wertpapieren 195
6.3.5 Bewertung der Verbindlichkeiten 199
6.4 Hauptabschlußübersicht 201
6.5 Erfolgsverbuchung ausgewählter Rechtsformen 204
6.5.1 Einzelunternehmen und Personengesellschaften 204
6.5.2 Kapitalgesellschaften 206
6.6 Bilanzierung im Umbruch: Orientierung an internationalen Maßstäben 209
6.6.1 Weltmärkte im Wandel - "Treck zur Wall Street" 210
6.6.2 Wesentliche Unterschiede zwischen US-GAAP bzw. IAS und HGB 213
6.6.3 Auswirkungen für die deutsche Rechnungslegung 216
6.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 6 219
7 Auswertung des Jahresabschlusses der Speedy GmbH 223
7.1 Bilanzanalyse 223
7.1.1 Bilanz der Speedy GmbH 223
7.1.2 Beurteilung der Kapitalstruktur 225
7.1.3 Analyse der Vermögensstruktur 227
7.1.4 Liquiditätsanalyse 228
7.1.4.1 Langfristige Sicherung der Liquidität 229
7.1.4.2 Kurzfristige Sicherung der Liquidität 230
7.1.5 Die Bewegungsbilanz: Aufdeckung von Finanzierungs- und Investitionsvorgängen 232
7.2 Analyse des Erfolgs 233
7.2.1 Gewinn- und Verlustrechnung der Speedy GmbH: Beurteilung der Aufwands-
und Ertragsstruktur 233
7.2.2 Wirtschaftlichkeitskennzahlen 236
7.2.2.1 Umschlag der Vorräte 236
7.2.2.2 Forderungsumsetzung: Entwicklung des Zahlungsziels 238
7.2.2.3 Kapitalumschlag 239
7.2.3 Renditekennziffern 240
7.2.3.1 Kapitalrenditen 240
7.2.3.2 Umsatzrendite 243
7.2.4 Cash-Flow-Analyse 244
7.2.5 Zwei Alternativen zum "Jahresüberschuß" nach HGB 246
7.2.5.1 Rendite und Börsenbewertung: Ergebnis nach DVFA/SG 246
7.2.5.2 Operating Profit nach US-GAAP 248
7.3 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 7 249
8 Konsequenzen für die Speedy GmbH 251
Lösungshinweise zu den Kontrollfragen und Übungsaufgaben 255
Kapitel 1 255
Kapitel 2 257
Kapitel 3 260
Kapitel 4 264
Kapitel 5 268
Kapitel 6 274
Kapitel 7 278
Zwei Klausuren "externes Rechnungswesen" mit Lösungshinweisen 281
Industriekontenrahmen (IKR) 288
Literaturverzeichnis 291
Stichwortverzeichnis 299
(c) 1999 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH & Co. KG
Vorwort der Herausgeber V
Vorwort VII
Abkürzungsverzeichnis XIV
Abbildungsverzeichnis XVIII
1 Zur Struktur des Rechnungswesens 1
1.1 Externes - internes Rechnungswesen 2
1.2 Instrumente der Finanzbuchhaltung 10
1.3 Wesentliche rechtliche Vorschriften zur Rechnungslegung 11
1.3.1 Handels-, steuerrechtliche und sonstige Regelungen 12
1.3.2 Prüfungs-, Publizitäts- und Sanktionsvorschriften 19
1.4 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 23
1.5 Kontrollfragen zu Kapitel 1 25
2 Wegweiser für eine "Bilanzkampagne" 27
2.1 Zeitlicher Rahmen für eine "Bilanzkampagne" 27
2.2 Inventur als Ausgangspunkt einer "Bilanzkampagne" 31
2.3 Inventar 34
2.4 Jahresabschluß: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang 37
2.5 Investor Relations-Instrumente 39
2.5.1 Bilanzpressekonferenz, Finanzanalystentreffen und Investorenmeeting 39
2.5.2 Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft 42
2.5.2.1 Im Vorfeld einer Hauptversammlung 42
2.5.2.2 Durchführung einer Hauptversammlung 45
2.5.2.3 Ende der "Bilanzkampagne": Gewinnausschüttung an Eigentümer 50
2.6 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 2 52
3 Grundlegende Technik der Buchhaltung 54
3.1 Erfolgsneutrale Buchungsvorgänge 54
3.1.1 Bebuchen von Bestandskonten 54
3.1.2 Proezßkette: Eröffnungsbilanz - Bestandskonten - Schlußbilanz 56
3.2 Buchungssätze 58
3.3 Hauptbuch oder Sachkontendarstellung 60
3.4 Erfolgswirksame Buchungsvorgänge: Aufwendungen und Erträge 62
3.4.1 Erfolgskonten 64
3.4.2 Das Gewinn- und Verlustkonto 65
3.5 Abschreibungen 66
3.6 Privatentnahmen und Privateinlagen 67
3.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 3 69
4 Organisation der Buchhaltung 72
4.1 Kontenrahmen und Kontenpläne 72
4.1.1 Trennung von Aufwand und Kosten 74
4.1.2 Gemeinschaftskontenrahmen 75
4.1.2.1 Einkreissystem und Prozeßgliederungsprinzip 75
4.1.2.2 Erläuterung der Kontenklassen - Betriebsergebniskonto 77
4.1.2.3 Kritik am Gemeinschaftskontenrahmen 78
4.1.3 Industriekontenrahmen 79
4.1.3.1 Zweikreissystem und Abschlußgliederungsprinzip 79
4.1.3.2 Erläuterung der Kontenklassen - Abgrenzungsrechnung 80
4.1.4 Gewinn- und Verlustrechnung: Gesamtkosten- oder Umsatzkostenverfahren 82
4.1.4.1 Unterschiede zwischen Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren 83
4.1.4.2 Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren: ein Zahlenbeispiel 86
4.2 Konventionelle und EDV-gestützte Finanzbuchhaltung 87
4.2.1 Organisatorische Grundlagen: Grund-, Hauptbuch, Nebenbücher 87
4.2.2 Konventionelle Finanzbuchhaltung 91
4.2.3 Einsatz von Standardsoftware 91
4.3 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 4 96
5 Buchung laufender Geschäftsfälle 98
5.1 Die Umsatzsteuer 98
5.1.1 Strukturmerkmale 98
5.1.2 Grundlegende Umsatzsteuerbuchungen 102
5.1.3 Eigenverbrauch 104
5.2 Lieferanten- und Kundenbeziehungen 106
5.2.1 Buchung von Anschaffungsnebenkosten 106
5.2.2 Handel mit Waren 108
5.2.3 Rücksendungen unbrauchbarer Lieferungen und Erzeugnisse bzw. Produkte 109
5.2.4 Preisnachlässe 111
5.2.4.1 Sofortrabatte, Boni und Mängelrügen 111
5.2.4.2 Skonti 113
5.2.5 Materialbuchungen: Lagerentnahmen oder Just-in-Time-Lieferungen 114
5.3 Finanzbereich 117
5.3.1 Wechselbuchungen 117
5.3.1.1 Bedeutung und Funktion des Wechsels 117
5.3.1.2 Wesentliche Wechselgeschäfte 120
5.3.2 Scheckbuchungen 124
5.3.3 An- und Verkauf von sonstigen Wertpapieren 125
5.3.4 Auszahlung der Dividende einer Aktiengesellschaft 126
5.3.5 Anzahlungen 128
5.3.5.1 Erhaltene Anzahlungen auf Vorratsbestellungen 128
5.3.5.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorratslieferungen 129
5.3.5.3 Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau 130
5.4 Verbuchung des Personalaufwands 131
5.4.1 Bestandteile des Personalaufwands 131
5.4.2 Buchungstechnik des Personalaufwands 133
5.4.3 Vorschüsse, Geldwerter Vorteil und Vermögenswirksame Leistungen 134
5.5 Besonderheiten der Anlagenbuchhaltung 136
5.5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 138
5.5.2 Andere aktivierte Eigenleistungen 141
5.5.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 141
5.5.4 Abschreibungen auf "Geringwertige Wirtschaftsgüter" 143
5.5.5 Veräußerung von Anlagegütern 146
5.6 Steuern des Unternehmens aus der Sicht des Finanzbuchhalters 148
5.6.1 Einkunftsarten des deutschen Steuerrechts 149
5.6.2 Gewinnabhängige und gewinnunabhängige Steuern (§ 275 HGB) 152
5.6.2.1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 152
5.6.2.2 Sonstige Steuern und Besonderheiten 154
5.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 5 156
6 Der Jahresabschluß 159
6.1 Abgrenzungen 159
6.1.1 Sonstige Forderungen und Sonstige Verbindlichkeiten 160
6.1.2 Aktive und passive Rechnungsabgrenzung 161
6.1.3 Rückstellungen 163
6.1.3.1 Überblick und grundlegende Rückstellungsbuchungen 164
6.1.3.2 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 167
6.1.3.3 Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen 168
6.2 Grundlegende Bewertungsmaßnahmen 172
6.2.1 Handels- und Steuerbilanz: das Maßgeblichkeitsprinzip 173
6.2.2 Bewertungsgrundsätze nach § 252 HGB 174
6.2.3 Wertmaßstäbe: Anschaffungs- und Herstellungskosten, Tages- und Teilwert 177
6.2.4 Ein Beispiel aus der Praxis: das Lohndeckungsverfahren zur Ermittlung der Herstellungskosten 181
6.2.5 Imparitätsprinzip 183
6.3 Spezielle Bewertungsmaßnahmen 186
6.3.1 Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens 186
6.3.2 Bewertung von Vorräten: Fest-, Durchschnittsbewertung und Verbrauchsfolgeverfahren 187
6.3.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen 190
6.3.4 Bewertung von Wertpapieren 195
6.3.5 Bewertung der Verbindlichkeiten 199
6.4 Hauptabschlußübersicht 201
6.5 Erfolgsverbuchung ausgewählter Rechtsformen 204
6.5.1 Einzelunternehmen und Personengesellschaften 204
6.5.2 Kapitalgesellschaften 206
6.6 Bilanzierung im Umbruch: Orientierung an internationalen Maßstäben 209
6.6.1 Weltmärkte im Wandel - "Treck zur Wall Street" 210
6.6.2 Wesentliche Unterschiede zwischen US-GAAP bzw. IAS und HGB 213
6.6.3 Auswirkungen für die deutsche Rechnungslegung 216
6.7 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 6 219
7 Auswertung des Jahresabschlusses der Speedy GmbH 223
7.1 Bilanzanalyse 223
7.1.1 Bilanz der Speedy GmbH 223
7.1.2 Beurteilung der Kapitalstruktur 225
7.1.3 Analyse der Vermögensstruktur 227
7.1.4 Liquiditätsanalyse 228
7.1.4.1 Langfristige Sicherung der Liquidität 229
7.1.4.2 Kurzfristige Sicherung der Liquidität 230
7.1.5 Die Bewegungsbilanz: Aufdeckung von Finanzierungs- und Investitionsvorgängen 232
7.2 Analyse des Erfolgs 233
7.2.1 Gewinn- und Verlustrechnung der Speedy GmbH: Beurteilung der Aufwands-
und Ertragsstruktur 233
7.2.2 Wirtschaftlichkeitskennzahlen 236
7.2.2.1 Umschlag der Vorräte 236
7.2.2.2 Forderungsumsetzung: Entwicklung des Zahlungsziels 238
7.2.2.3 Kapitalumschlag 239
7.2.3 Renditekennziffern 240
7.2.3.1 Kapitalrenditen 240
7.2.3.2 Umsatzrendite 243
7.2.4 Cash-Flow-Analyse 244
7.2.5 Zwei Alternativen zum "Jahresüberschuß" nach HGB 246
7.2.5.1 Rendite und Börsenbewertung: Ergebnis nach DVFA/SG 246
7.2.5.2 Operating Profit nach US-GAAP 248
7.3 Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Kapitel 7 249
8 Konsequenzen für die Speedy GmbH 251
Lösungshinweise zu den Kontrollfragen und Übungsaufgaben 255
Kapitel 1 255
Kapitel 2 257
Kapitel 3 260
Kapitel 4 264
Kapitel 5 268
Kapitel 6 274
Kapitel 7 278
Zwei Klausuren "externes Rechnungswesen" mit Lösungshinweisen 281
Industriekontenrahmen (IKR) 288
Literaturverzeichnis 291
Stichwortverzeichnis 299
(c) 1999 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH & Co. KG