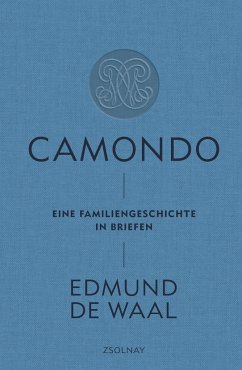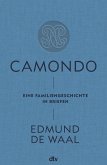Nach "Der Hase mit den Bernsteinaugen" ein neues Meisterwerk der Erinnerungsliteratur von Edmund de WaalGeschichte ist nicht Vergangenheit, sie hört nie auf und entfaltet sich in unseren Händen. Das schreibt Edmund de Waal in seinem neuen Buch, das ihn zurückführt in die Pariser Rue de Monceau, in der einst sein Vorfahre Charles Ephrussi den berühmten »Hasen mit den Bernsteinaugen« hütete, wo in unmittelbarer Nachbarschaft Marcel Proust wohnte und wo der Bankier Moïse de Camondo aus Konstantinopel ein Palais errichten ließ, in dem sich heute ein seit 1936 unverändertes Museum befindet. Niemand war zufällig in dieser »Straße der Anfänge«, sagt de Waal und beginnt, imaginäre Briefe an Moïse zu richten, über die vielfältigen Beziehungen ihrer beiden Familien, über Assimilation, Großzügigkeit, privates und öffentliches Leben und immer wieder über die Bedeutung der Erinnerung und dass es keinen »Schlussstrich« geben kann und darf.

Echo eines Lebens: In seinem Briefroman "Camondo" widmet sich Edmund de Waal dem kostbaren Erbe eines Pariser Bankiers.
Von Ursula Scheer
Ein Fremder, ein Verwandter, ein Freund: Edmund de Waal schreibt ihm Briefe, als wäre Comte Moïse de Camondo noch zugegen in seinem Stadtpalais in der Rue de Monceau Nummer 63, der Pariser Heimstatt einer Familie, einer Bank, einer Dynastie. Und ist der 1935 gestorbene Camondo nicht tatsächlich präsent in der Abwesenheit?
Das dem Petit Trianon in Versailles nachempfundene Haus, in dem die vier Winde auf dem Barockteppich des Salons die Backen blähen; die runde Bibliothek, in der die "Histoire de la poésie des Hébreux" neben den Klassikern steht; das Porzellanzimmer mit seiner vogelkundlichen Kollektion Meißener Preziosen; schließlich der zum Schrein der Erinnerung veredelte Schlafraum des Sohnes: Das Arrangement der Gegenstände in den von Camondo kunstsinnig ausgestatteten Räumen, die De Waal mit Worten erschließt, bewahrt die Umrisse des Daseins, das sich in ihnen einst entfaltete. Es erzählt von der nach kultureller Perfektion strebenden Assimilation einer wohlhabenden jüdischen Familie aus Konstantinopel, von Sammelleidenschaft, Patriotismus und Aufklärung, von der Sehnsucht nach Dauer und Zugehörigkeit im Land der Dreyfus-Affäre, die für die Spanne eines Lebens gestillt werden konnte.
Als Zwölfjähriger kam Moïse de Camondo 1869 mit seiner Familie vom Bosporus an die Seine. Kurz nach seinem Tod, als der von ihm errichtete prachtvolle Bau in der Rue de Monceau samt Interieur, wie er es verfügt hatte, im Namen des Gedenkens an seinen im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohn Nissim ein Teil des staatlichen Musée des Arts Décoratifs wurde, enthüllte ein Minister die Plakette. Zu Nissims Tod zwei Jahrzehnte zuvor hatte Proust seine Anteilnahme übermittelt. Die Mutter des Jungen, Irène Cahen d'Anvers, war als Mädchen von Renoir porträtiert worden. Kann man noch viel pariserischer werden? Alles sollte rein bewahrt werden: Auf penible Sauberkeit sei im Haus zu achten, lautete die Anweisung Camondos für sein Museum. Kein Staub dürfe sich sammeln. Doch ohne Staub keine Spuren, befindet der ihm nachschreibende De Waal, wohl wissend, das Staub einer anderen Substanz verwandt ist: der Asche. Auch von Paris fuhren Züge nach Auschwitz.
Moïse de Camondo konnte bei täglichen Gängen über den Vier-Winde-Teppich nicht ahnen, dass seine scheinbar so stabil in der Dritten Französischen Republik gründende Existenz als Bankier, Sammler und Citoyen gleichsam auf Luft gebaut war, dass sie schon über dem Abgrund schwebte, in den Europa vom Nazismus gestürzt werden würde. Das unvermeidliche Wissen darum, was Camondos Tochter Béatrice und deren Kinder erwartete, legt eine tiefe Melancholie über die im Musée Camondo wie in einer Zeitkapsel geborgenen Artefakte, vereint in einer Ära, die Stefan Zweig als das "goldene Zeitalter der Sicherheit" bezeichnete.
De Waal will sich der tödlichen Erstarrung, die in den Objekten lauert, ebenso wenig hingeben wie der bitter notwendigen Erinnerung entziehen. Wo von Menschen nur Gegenstände geblieben sind, ganz gleich, ob Kunstwerke oder bloße Utensilien, versteht es der britische Keramikkünstler und Autor wie kein anderer, die Dinge erzählend wieder mit der Wärme zu erfüllen, die sie in sich aufgenommen haben, als sie von anderen vor langer Zeit in Händen gehalten, auf Borden hin und her geschoben, benutzt, besessen wurden. Dinge vergegenwärtigen. Sie setzen Konversationen in Gang, über Raum und Zeit hinweg.
Eine Unterhaltung entspinnt sich auch in den 58 Briefen, die De Waal an Moïse de Camondo postum geschrieben hat, vereint mit Fotografien aus dessen Haus und übersetzt von Brigitte Hilzensauer in einem leinengebundenen Band mit Monogrammprägung. Auch das Buch ist ein Objekt. Sein Text verbindet in Betrachtungen, Annäherungen und Abschweifungen das Schicksal der Camondos mit der Familien- und Kulturgeschichte, der Edmund de Waal in seinem vielbeachteten Erstling "Der Hase mit den Bernsteinaugen" über die Ephrussis aus Odessa, seine jüdischen Vorfahren mütterlicherseits, nachspürte. Auf verwickelte Weise sind beide Familienkreise miteinander verbandelt. In der Rue de Monceau, auf jenem "goldenen Hügel" im achten Arrondissement, treffen sie schließlich Ende des neunzehnten Jahrhunderts aufeinander: an einem Ort der Begegnungen und Neuanfänge, der zur tödlichen Falle wurde. Meisterlich vereint De Waal in seinen essayistischen Briefen Archivalisches, Literarisches und im Musée Camondo Betrachtetes mit Imaginiertem und persönlichen Ansprachen. Er stellt zusammen, wie der Comte Dinge zusammengestellt hat: bis Bilder entstehen und die Echos der Vergangenheit so klar erklingen, dass sie ins Herz dringen.
Edmund de Waal: "Camondo".
Eine Familiengeschichte in Briefen.
Aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauer. Zsolnay Verlag, Wien 2021. 191 S., 33 Abb., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Auch in diesem Buch erzählt Edmund de Waal von einer sehr reichen, Kunst sammelnden jüdischen Familie. Diesmal aber nicht - wie in "Der Hase mit den Bernsteinaugen" von seiner eigenen, sondern von den Camondos, erzählt Rezensentin Christine Brinck. Im Buch schreibt de Waal 58 fiktive Briefe an Moise Camondo, der in seinem prächtigen Pariser Palais sitzt, in dem er 1936 starb. Der Rest der - gänzlich assimilierten - Familie wurde von den Nazis ermordet. Mit Ausnahme von Irene Camondo, lesen wir, die überlebte und ihr Porträt von Renoir an den Waffenlieferanten der Nazis, Emil Georg Bührle verkaufte. Doch darum geht es nicht. Vielmehr führt uns de Waal laut Rezensentin durch das Palais, erzählt die Geschichte seiner Kunstgegenstände, Vasen, Teppiche und Fotos, und macht so eine Facette des Französischen lebendig, eine Lebensart und ein Kulturverständnis, die untergegangen ist. Ein "herzzerreißendes Buch", so Brinck.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Wenn De Waal an die Bilder erinnert, die einmal seiner Familie gehört haben, wenn er die Möbel, das Geschirr, die Gläser, Wandschirme, Teppiche und Ziergegenstände beschreibt, die einst der Stolz seiner Verwandten gewesen waren, dann ist es, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Die Dinge fangen an, zu uns zu sprechen." Klara Obermüller, NZZ Bücher am Sonntag, 28.11.21 "Mit seinem Blick sehen wir Dinge, die uns selber gar nicht aufgefallen wären. [...] Camondo ist ein sehr dichtes Buch, es ist ungewöhnlich erzählt und sehr, sehr lesenswert." Barbara Tóth, Falter Bücher Podcast, 25.11.21 "Eine literarische Preziose, ein leises, zartes, ein aus der Zeit gefallenes Buch - mit einem ungeheuren Sog." Jochanan Shelliem, NDR Kultur, 02.11.21 "Man könnte Camondo auch als überaus kunstvollen Museumsführer lesen, aber einen solchen zu verfassen, war nicht die Absicht des Autors. Der wollte vielmehr ein Buch über das Vergessen und Erinnern schreiben, über das Trauern und das Weiterleben. Die Welt Camondos, die de Waal in seinen wunderschön nachdenklichen Briefen auferstehen lässt, wird brutal ausgelöscht." Barbara Tóth, Falter Buchbeilage, 20.10.21 "De Waal versteht es wie kein anderer, Gegenstände erzählend wieder mit Wärme zu erfüllen. (...) Meisterlich vereint De Waal Archivalisches, Literarisches und Betrachtetes mit Imaginiertem und persönlichen Ansprachen." Ursula Scheer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.10.21 "Wieder verschlägt es einem den Atem, wie de Waal das Aufeinanderprallen einer kunstsinnigen Familie mit dem Nazi-Regime beschreibt." Lisa Zeitz, Weltkunst, Oktober 2021 "Zurück bleiben die Sammlungen, die materiellen Archive, als deren einfühlsamer Deuter de Waal berühmt geworden ist. (...) Es sind die Dinge, die bei ihm Vergangenheit und Gegenwart verbinden, die ein Gespräch mit den Toten ermöglichen und die vor allem: Tradition stiften. Insofern ist der Band nicht nur ein Erinnerungsbuch, sondern auch eine Theorie des Museums und des Sammelns." Christoph Schmälze, SWR2 lesenswert, 27.9.21 "Edmund de Waal rekreiert mit seiner brieflichen Familiengeschichte eine faszinierende, eine andere Vorstellung von Adel zu Zeiten der Belle Époque und zugleich gelingt ihm eine poetische Meditation über so altmodisch scheinende Begrifflichkeiten wie Erinnerung, Erbe und Ehre." Kirstern Böttcher, Bayern 2, 21.09.21