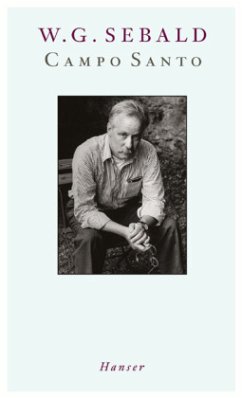Das Vermächtnis eines großen Erzählers: Im Mittelpunkt stehen Teile von W. G. Sebalds un-vollendetem Prosawerk, an dem er in den letzten Monaten seines Lebens arbeitete. Außerdem enthält der Band eine Zusammenstellung von Essays zur Literatur, die noch einmal Sebalds Vorlieben dokumentieren.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Burkhard Müller ist sehr beeindruckt von W. G. Sebalds nachgelassenen Schriften: Dies ist kein sprachlicher "Sperrmüll", wie es sonst so oft bei nachgelassenen Schriften der Fall sei, erklärt Müller. Er hat hier vielmehr kluge, aufschlussreiche Texte gefunden, die ihm sogar die Idee einer "wahren Traditionslinie der Einzelnen" - in etwa: Weiss, Sebald, Kluge und hoffentlich Folgende - eingegeben haben, gegen die "fortdauernde Dominanz der Gruppe 47". Der Grund dafür ist, dass sich Sebald in seinen Essays, die neben Reisestücken über Korsika und vor allem über den dortigen Totenkult dieses Buch füllen, sehr stark mit der deutschen Nachkriegsliteratur auseinandersetzt und den Mangel an wirklicher, ehrlicher Erinnerung beklagt. Diejenigen, die es doch getan haben (Sebalds Beispiele: Weiss, Améry, Hildesheimer), die "Entflohenen und irreparabel Beschädigten", mögen dabei auch von Ressentiments geprägt gewesen sein, doch seien ihre Werke für Sebald einem wirklichen Ringen mit der Vergangenheit entsprungen - im Gegensatz zu "einer leichtfertigen Verallgemeinerung, einer billigen Abfuhr der Katastrophe" deren er Böll und vor allem Grass bezichtige, dessen "Denkfaulheit" und so wohlfeile wie selbstgerechte "Gedenkerei" er ausführlich darlege. Müller stimmt ihm von Herzen zu und lobt den "gewissenhaften Ernst", die "knappe Schärfe" der Sebald'schen Gedanken.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH