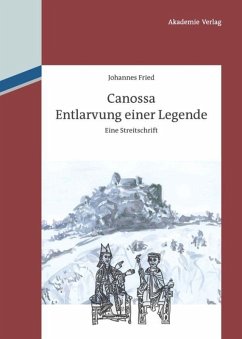Canossa war keine Wende. Canossa führte zu keiner Entzauberung der Welt. Dieses Canossa war ein Mythos, eine Legende. Tatsächlich schlossen Papst Gregor VII. und König Heinrich IV. in Canossa einen Friedensvertrag. Erinnerungsunkritische Kritik wollte diesen Pakt in Zweifel ziehen, als "neue Legende" voreilig dem Vergessen überantworten. Die vorliegende Streitschrift setzt sich mit dieser Kritik auseinander und zeigt, wie auch die gegenwärtige Geschichtsforschung der Modulationsmacht des Gedächtnisses ausgeliefert ist und damit zu Fehlurteilen führt. Sie verweist auf wesentliche Inhalte und Ziele des Vertrags von Canossa, den wechselseitigen Schutz der Ehre von Papst und König, die angestrebte Konsenserneuerung im Reich der Deutschen, zeigt aber auch sein Scheitern durch die Uneinigkeit der Führungseliten dort und in der Lombardei. Nicht Heinrichs Rekonziliation in Canossa, nicht die Kirchenreform, kein nach Weltherrschaft greifender Papst brachten die Wende, den Auftakt zu einem durch annähernd dreihundert Jahre immer wieder erneuerten, konfliktträchtigen Gegenkönigtum im römisch-deutschen Imperium, sondern interne Konflikte, der Hader unter den Deutschen.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit Nachdruck möchte Rezensent Michael Borgolte diese von dem Frankfurter Historiker Johannes Fried verfasste Streitschrift über die Vorgänge auf der Burg "Canossa" empfehlen. Dem Deutungsreichtum um den Bußgang König Heinrichs IV. zu Papst Gregor VII. im Jahre 1077 setze Fried eine Faktengeschichte entgegen, die auf der von ihm entwickelten Methode der "Memorik" beruhe. Und so weise der Historiker anhand der ältesten, möglichst "unmittelbaren" und somit nicht durch Erinnerungen verfälschten Zeugnisse nach, dass der König und der Papst nach der Buße und Rekonziliation Heinrichs einen Friedenspakt geschlossen hätten, um gemeinsam die Streitigkeiten im Reich zu überwinden. Der Kritiker lobt nicht nur die "kritische Akribie", mit der Fried die zahlreichen Quellenhinweise überprüfe und teilweise in Frage stelle, sondern ist auch überzeugt, dass nachfolgende Arbeiten an den neuen Erkenntnissen dieser treffenden Argumentation nicht vorbei kommen werden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Chronisten und Boten muss man zu lesen wissen: Johannes Fried vertieft sich in Quellen, um seine Deutung der Geschehnisse auf der Burg Canossa im Jahr 1077 zu verteidigen.
Ein seltsames Überleben sei zu nennen, was "Canossa" im Zitatenschatz des deutschen Volkes friste, schrieb kürzlich der Autor des einschlägigen Artikels in den "Deutschen Erinnerungsorten". Die ferne Reminiszenz an den Bußgang König Heinrichs IV. Ende Januar 1077 auf der Burg Canossa im Apennin, den Papst Gregor VII. durch Wiederaufnahme des deutschen Königs in die Gemeinschaft der Kirche honorierte, scheine freilich zu verlöschen. In der Tat: Seitdem der Streit um die katholische Konfessionsschule in den sechziger Jahren überwunden wurde, ist hierzulande kein Konflikt mehr denkbar, in dem ein nationales Trauma aus dem Mittelalter evoziert werden müsste, um die Souveränität des Staates gegen "Rom" zu verteidigen.
Historiker wollen Canossa indessen als Chiffre für einen gewaltigen Ordnungswandel im Reich und westchristlichen Europa verstehen. Gregor VII. habe "mit vollem Einsatz die päpstliche Wahrheit in der gesamten römischen Kirche" durchsetzen und eine "neuartige Gehorsamshierarchie" in einem "völkerübergreifenden Ordnungsraum" schaffen wollen. Andere Experten urteilen anders und nüchtern: "Der Bußgang von Canossa war keine Wende." Erst recht gelte das, wenn man über die deutsche Geschichte hinausblicke: "Kein Spanier, kein Franzose, kein Ire, Engländer, Schotte, Pole oder Italiener käme auf den Gedanken, Canossa zur Chiffre des großen geistigen Wandels zu erklären, der seit dem 11. Jahrhundert Europa oder doch seinen Westen erfasste."
Fragen nach der angeblich epochalen Bedeutung des Geschehens sind es indessen nicht, die deutsche Historiker jetzt wieder aufgeregt über Canossa debattieren lassen, sondern es geht um das, was in Canossa "wirklich geschah". Diese Wendung von der Sinn- zur Faktengeschichte ist erstaunlich, zumal sie ein Mediävist angestoßen hat, der noch vor wenigen Jahren für die Verbindung von "Wissenschaft und Phantasie" warb und die Kunst der geschichtlichen Erzählung wie kein anderer forderte und glanzvoll praktizierte: der Frankfurter Historiker Johannes Fried.
Fried wendet sich den Vorgängen um Canossa mit dem von ihm entwickelten Instrumentarium der "Memorik" zu. Auf der Grundlage neuer kognitionswissenschaftlicher Forschungen hat er ein Regelwerk zur Kritik schriftlicher Überlieferung erarbeitet, das wahrscheinlich als bedeutendste Innovation der historischen Methode seit dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts gelten kann. Entscheidend ist dabei die Erkenntnis, dass sich jede Erinnerung situationsbedingt und prädisponiert durch die je eigene Geschichte und Lebenslage des Subjekts oder erinnernden Kollektivs ständig verändert.
Es liegt nahe, diesen Veränderungen oder Verformungen durch Rückgriff auf das älteste, möglichst "unmittelbare" Zeugnis eines Geschehens zu entgehen; tatsächlich neigt Fried dazu, wie die griechischen Väter der Geschichte dem Augenzeugenbericht die höchste Authentizität zuzuschreiben, obwohl er doch selbst weiß, dass auch eine erste Schilderung auf Erinnerung beruht. Wie aber soll man Faktenkritik betreiben, wenn schon die Wahrnehmung des Geschehens selbst durch Erinnerungen gelenkt wird? Vielleicht wäre es für die "Memorik" der erfolgversprechendere Weg, statt der Sachverhalte die Autoren zu ihrem Gegenstand zu machen, die Schichten ihres Gedächtnisses auszuloten und die Grade ihrer memorialen Überformungen im Vergleich mit anderen zu ermitteln?
Fried will indessen die Leistungskraft seiner Methode durch den Nachweis "falscher" Erinnerungen erweisen, es geht ihm um die Erkenntnis der historischen Wahrheit selbst. Vor vier Jahren hat er mit diesem Ziel erstmals die Vorgänge von Canossa neu untersucht und dabei ein sensationelles Ergebnis erzielt (F.A.Z. vom 29. Januar 2009): Nach der Buße und Rekonziliation Heinrichs hätten der König und der Papst auf Canossa einen Friedenspakt geschlossen; bezeugt sei dieser durch einen ereignisnahen Chronisten, ohne dass wir Näheres erführen. Einige Jahre hätten die beiden Führer der Christenheit an dem Plan festgehalten, gemeinsam die Zwietracht im Reich zu überwinden, doch seien sie schließlich gescheitert, zumal die gegen Heinrich rebellierenden Fürsten nicht eingebunden waren. Canossa sei also ein Friedensfest. Das aber wollten andere prominente Mediävisten nicht glauben und verteidigten die herkömmliche Deutung einer einseitigen Demütigung des Saliers durch Papst Gregor mit den konventionellen Methoden der Textkritik. Diese Missachtung der "Memorik" hat Fried jetzt zu einer "Streitschrift" veranlasst, in der er seine Argumentation weiter entfaltet und besser begründet.
Eine von zwei Säulen seines Beweisganges kann er allerdings auf sichererem Fundament als die mutierende Memoria gründen: Die Zeitangaben des intensiven Briefverkehrs zwischen Italien und Deutschland erlauben ihm, die Pläne für Reisen und Begegnungen von Papst, König und Fürsten genauer als je zuvor zu berechnen. Demnach hatten Heinrich und Gregor genug Zeit, um ein Versöhnungstreffen zu planen, als die Fürsten noch hofften, mit Hilfe des Papstes einen der Ihren an Heinrichs Platz zu stellen. Natürlich kommt auch diese Konstruktion der Geschichte nicht ohne Phantasie aus. Wer sie aber künftig bestreiten wollte, dürfte sie nicht - wie noch unlängst geschehen - als bloße Spekulation diffamieren; er müsste sich schon die Mühe machen, die Vielfalt der Quellenhinweise mit der gleichen kritischen Akribie wie Fried zu überprüfen und ein ebenso stimmiges und belastbares Gefüge der Daten zu entwickeln.
Die Auswertung Arnulfs, des Mailänder Chronisten, der in Canossa vielleicht dabei war und wohl noch im selben Jahr aufschrieb, was er zu wissen glaubte, ist Frieds zweites Fundament. Nach Arnulf habe der Abt von Cluny zusammen mit Heinrichs Mutter Agnes und der Markgräfin Mathilde von Tuszien eine "allgemeine Unterredung" zwischen ihnen, dem Papst und Heinrich geplant, um Frieden und Gerechtigkeit herzustellen. Als Gregor von Rom aufgebrochen war, um nach "Alemannien" zu reisen, sei ihm Heinrich entgegengezogen und habe den Apostolicus in Canossa, Mathildes Burg, getroffen. Mit nackten Füßen und auf den Boden hingestreckt habe der König unter vielen Tränen die Verzeihung durch den Papst, also die Rücknahme der Exkommunikation, erwirkt, und zwar, indem er "unter der Bedingung, dass Recht gewährt werde, die Eide bestätigte, die seine Getreuen (für ihn) geleistet hätten". So seien durch die Klugheit der Mathilde zwischen ihnen Friedensvereinbarungen getroffen worden, obgleich die (lombardischen) Bischöfe dagegen opponierten.
Die hier erwähnten pacis federa zwischen König und Papst nehmen viele Historiker nicht ernst, weil sie unter Bezug auf das noch herzustellende Recht annehmen, es werde auf ein in Deutschland unter Vorsitz des Papstes und Beteiligung der Fürsten abzuhaltendes Gericht über Heinrich angespielt. Fried indessen zeigt überzeugend, dass die Formulierung "sub condictione iustitie faciende" nicht auf eine Gerichtsverhandlung verweise, sondern auf das Recht, das alle Streitparteien, auch der König, in Anspruch nehmen konnten. Auf welche Weise dies geschehen sollte, deute Arnulf nicht an. Die herrschende Annahme, dass ein Gericht in Augsburg zu Lasten Heinrichs gemeint sei, beruhe auf den von Ressentiments gesteuerten Fehlerinnerungen späterer Geschichtsschreiber, die unter dem Eindruck neuer Konflikte standen, welche 1080 zur zweiten Exkommunikation Heinrichs geführt hatten.
So scharfsinnig Fried den Wert zahlreicher Quellen in Frage stellt, bei denen die Dynamik der Erinnerung die "Wirklichkeit" zur Unkenntlichkeit verformt habe, so eindrucksvoll schält er Splitter unverfälschter Überlieferung aus anderen Zeugnissen verschiedener Provenienz heraus. Zutage gefördert werden so insbesondere die bisher völlig unbekannte Rolle, die ein päpstlicher Bote namens Kadalaus bei den Fürsten gespielt haben dürfte, und das für die Einordnung des Geschehens erst jetzt klar erkennbare Schicksal eines anderen Boten, des Erzbischofs Udo von Trier.
Kein Zweifel: Johannes Fried hat eine neue und umstürzende Deutung der Vorgänge um Canossa mit einer in sich stimmigen Argumentation vorgelegt, die kein ernst zu nehmender Historiker vom Tisch wischen kann. Man mag bedauern, dass er dies in einer Streitschrift getan hat, die seine Gegner zu wenig überlegten Repliken herausfordern könnte. Deren Anspruch muss nun aber sein, Fried auf dem neuen Feld der "Memorik" zu widerlegen.
MICHAEL BORGOLTE
Johannes Fried: "Canossa". Entlarvung einer Legende. Eine Streitschrift.
Akademie Verlag, Berlin 2012. 181 S., geb., 29,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Kein Zweifel: Johannes Fried hat eine neue und umstürzende Deutung der Vorgänge um Canossa mit einer in sich stimmigen Argumentation vorgelegt, die kein ernst zu nehmender Historiker vom Tisch wischen kann. Man mag bedauern, dass er dies in einer Streitschrift getan hat, die seine Gegner zu wenig überlegten Repliken herausfordern könnte. Deren Anspruch muss nun aber sein, Fried auf dem neuen Feld der "Memorik" zu widerlegen. Michael Borgolte in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. Juni 2012 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/johannes-fried-canossa-kein-bussgang-sondern-friedensfest-11793076.html