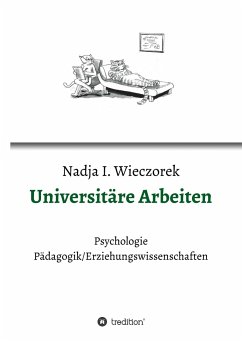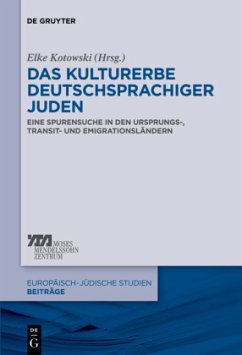Carl Schmitt und die Juden
Eine deutsche Rechtslehre. Diss.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Raphael Gross untersucht den historischen Kontext, in dem Carl Schmitts ständige Auseinandersetzung mit Juden und »dem Jüdischen« stand. Dabei wird deutlich, wie sich seine politische Theologie im Nationalsozialismus wandelte, als Schmitt eine Biologisierung des Politischen unternahm und eine »artgerechte«, »deutsche« Rechtslehre entwarf. In Schmitts Werken, die hier einer kritischen Lektüre unterzogen werden, überlagern sich traditionelle antijudaistische Vorstellungen mit modernen politischen Antisemitismen.