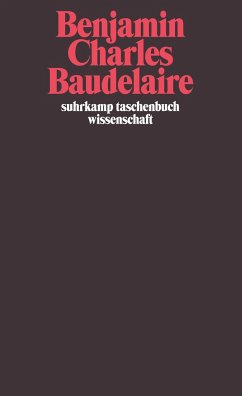Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus - ein Buch, an dem Benjamin von 1937 bis 1939 arbeitete und das er aus dem Passagenwerk ausgliederte - ist Fragment geblieben. Der vorliegende Band vereinigt die als einzige abgeschlossenen Texte Das Paris des Second Empire bei Baudelaire und Über einige Motive bei Baudelaire mit den Zentralpark-Fragmenten: aphorismen- und thesenartige Aufzeichnungen, in denen die ungeschrieben gebliebenen Teile des Baudelaire-Buches Kontur gewinnen.

Abends zum Gasthof herüberschlendern ist noch lange nicht sein Schönstes: Der Flaneur ist nicht totzukriegen, nur seine Deuter schreiben im fiebrigen Rausch
In seinem unvollendeten Buch über Charles Baudelaire als Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus stellte Walter Benjamin fest, dass "mit dem Aussterben der Passagen die Flanerie aus der Mode" gekommen sei. 1991 bestimmte Angelika Wellmann einen früheren Todeszeitpunkt: Die Flanerie sei "bereits im Jahre 1857 abgelaufen". Die Literaturwissenschaftlerin Sabine Becker pflichtete 1993 wieder Benjamin bei. "Mit dem Ende der Pariser Passagenwelt verschwindet auch der Typus des Flaneurs", schrieb sie, und das sei zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts geschehen. Gegen diesen Abgesang hat Harald Neumeyer in einer detailreichen Studie über Aufstieg und Niedergang des Flaneurs unlängst Einspruch erhoben: "In dieser Pauschalität ist Beckers Urteil nicht haltbar, weil dem Flaneur damit jede Anpassungsfähigkeit abgesprochen wird; anders gesagt: Nur wenn man ihn als gelassenen Beobachter schon auf der Folie einer spezifischen historischen Erscheinungsform definiert hat, lässt sich auch sein historisches Ende datieren."
Die Erforschung der Frage, wann der Flaneur von uns gegangen sei oder ob er nicht sogar noch lebe und flaniere, hat sich zu einem eigenen Wissenschaftszweig ausgewachsen. Da der Flaneur kein normalsterbliches Individuum ist, sondern ein Typus, helfen die verfeinerten Methoden der medizinischen Diagnostik den Fachleuten nicht weiter. Sie sind sich nicht einmal darüber einig, ob sie sich am Siechbett, am Grab oder um die exhumierten Gebeine des Flaneurs versammelt haben. Während die einen sein Skelett mazerieren, messen die anderen dem Flaneur noch das Fieber. Er wird gleichzeitig beweint, beatmet und obduziert, beim Flanieren observiert und wieder totgesagt: "Auch die heutigen Fußgängerzonen", schreibt Neumeyer, "stimmen vielmehr das Lied vom Tod des Flaneurs an, als dass sie seiner Gehbewegung durch die Schaffung einer verkehrsfreien Zone wieder einen Raum schenken. Man, das heißt der Verkäufer, spekuliert, damals wie heute, auch auf die Richtungs- und Ziellosigkeit einer Gehbewegung, um den mit ihr verknüpften freien Blick zu fesseln; man kokettiert mit dem Gehen-Sehen des Flaneurs als Kapitalanlage."
1988 war Rüdiger Severin optimistischer gewesen: "In den letzten Jahren entstanden im Rahmen der Sanierung von Innenstädten immer mehr Passagen; Lichthöfe in Edelkaufhäusern und auch in der Industriearchitektur gelten wieder als zeitgemäß. Vielleicht findet der Flaneur hier zu seinem dritten Frühling, in Gestalt des walk-man etwa." Barry Smart sah den Flaneur 1994 als "zapping radio listener" auferstehen, als "insular package-tour flanerie" betreibenden Pauschaltouristen und als wählerischen Restaurantgast. Florian Rötzer machte 1997 den "Netzflaneur" in den "schmutzigen, dunklen, extravaganten und innovativen Winkeln des Cyberspace" ausfindig. Andererseits hatte Peter Handke 1980 offiziell "Das Ende des Flanierens" verkündet. Aber ob man dem Flaneur Vitalität bescheinigt, Bulletins ausstellt oder Nachrufe widmet, tut nicht viel zur Sache: Jede Rede vom Flaneur wirft einen Distinktionsgewinn ab; ihr Inhalt ist zweitrangig.
In seiner großen Zeit war der Flaneur, in bedenklicher Ämterhäufung, unter anderem "der Priester des genius loci" (Benjamin), Dichter, Jäger, Lumpensammler, Spurenleser, Traumdeuter, Physiognom, Detektiv, Archäologe, Dandy, Tramp und "letzter Mohikaner" (Michael Opitz). Er erschien "als Agent der ästhetischen Moderne oder als Inspizient des Modernisierungsprozesses" (Harald Neumeyer). Ein brandneues Werk aus Kalifornien (Anke Gleber: "The Art of Taking a Walk") weist nach, dass der Flaneur Träumer, Historiker und moderner Künstler gewesen sei. In Abwandlung eines geflügelten, Daniel Düsentrieb von Erika Fuchs soufflierten Wortes darf man wohl sagen: Dem Flaneur war nichts zu schwör.
Benjamin zufolge trug er "die Züge des unstet in der sozialen Wildnis schweifenden Werwolf" und war doch zugleich von äußerst scheuem und subtilem Wesen. Ins Bild des Flaneurs gingen viele Knabenträume des zwanzigsten Jahrhunderts ein: Er war Kara Ben Nemsi, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Howard Carter, Marco Polo, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Clochard und eiskalter Engel zugleich, dabei finanzieller Sorgen ledig, trug ein duftendes Baguette unterm Arm und eine glimmende Gauloise im Mundwinkel und war überhaupt ein ganz famoses Haus.
In dieser glamourösen Gestalt bewegt sich der Flaneur noch heute durch die Sekundär- und Tertiärliteratur. Seit neuestem ist auch die bislang allenfalls unter "ferner liefen" verbuchte "Flaneuse" in den Fokus der akademischen Aufmerksamkeit vorgerückt. Anke Gleber hat die spezifisch weibliche Form der Flanerie untersucht und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass sie die Vorherrschaft des männlichen Blicks auf die Welt brechen könne. Die Studie ist grundsolide, aber auch Anke Gleber ist gelegentlich ins Schwärmen und Schwafeln geraten. Ihre Behauptung, die weibliche Flanerie sei ein Gegengift, eine neue Annäherung, ein neues Paradigma, ist weder zu beweisen noch zu widerlegen; sie ist nur schlechte Dichtkunst.
"Der Flaneur", dichtete Benjamin, "ist ein Preisgegebener in der Menge. Damit teilt er die Situation der Ware. Diese Besonderheit ist ihm nicht bewusst. Sie wirkt aber darum auf ihn nicht weniger. Sie durchdringt ihn beseligend wie ein Rauschgift, das ihn für viele Demütigungen entschädigen kann. Der Rausch, dem sich der Flanierende überlässt, ist der der vom Strom der Kunden umbrausten Ware." Der Text, dem diese Sätze entstammen, ist kanonisiert; er zählt zu den heiligen Schriften der Soziologie. Aber ist er auch plausibel? Gab es im späten neunzehnten Jahrhundert denn tatsächlich eine geheime Seelen- oder Wesensverwandtschaft zwischen Räucheraalen auf dem Fischmarkt und Bummelanten mit Parapluie, die sich außer Haus im Wiegeschritt die Beine vertraten? Und war die Rede von der Flanerie als Rausch und Rauschgift jemals mehr als ein Slogan, der zum Eintritt in Walter Benjamins Kuriositätenkabinett verlocken sollte?
Maßgeblich für die Traditionsbildung war nicht der Inhalt der von Benjamin hinterlassenen Schriften. Es war ihr Sound, der nicht einmal unverwechselbar war, sondern oft und gern imitiert wurde. "Der bannende Blick des Flaneurs im Garten der Mythen": So betitelte Renate Schlesier 1985 einen einschlägigen Aufsatz. In einem Benjamins Passagen-Werk gewidmeten Sammelband bezeichnete der Mitherausgeber Richard Faber seinen eigenen Beitrag 1986 wortwörtlich als "Metacollage-Essay". Gymnasiasten werden immer noch trockene "Erörterungen" abverlangt. Mit "Metacollage-Essays" dürfen nur arrivierte Benjamin-Forscher glänzen.
"Die großstädtische Masse ist das Lebenselement des Flaneurs. Sie ist ihm Labyrinth und Asyl zugleich, berauschendes Lebenselixier und unvergleichliches Beobachtungsfeld", dichtete 1989 Hans Robert Jauß. Von Berauschendem sprechen die auf den Spuren des Flaneurs wandelnden Fährtenleser verdächtig oft. Wer sich im Garten der Mythen an berauschenden Elixieren gelabt hat, ist von der Pflicht, sich verständlich auszudrücken, entbunden und braucht seine Gedanken nicht mehr zu ordnen; er darf sie collagieren oder metacollagieren. Kurz gesagt: Im heiligen Rausch darf gelallt werden.
Wunschbild und Phantasmagorie, die utopisch-emanzipatorische und die fetischistisch-entfremdende Seite der modernen Bilderwelt, überlagern sich in einem Bewohner der Metropole, der ihr dialektisches Bild par excellence ist: im Flaneur", schwärmte 1994 Willi Bolle, bis zum Delirium berauscht von Benjamins Passagen-Werk. Darin gehe es "um Oszillationen der kollektiven Vorstellungswelt, wobei mit Hilfe der Überblendungstechnik versucht wird, diese Prozesse mentalitätsgeschichtlich aufzuschlüsseln. Den Wort-Überblendungen auf der mikrologischen Textebene entsprechen im großen Syntagma der Komposition Überblendungen von Figuren und Sozialcharakteren, von Perspektiven und literarischen Gattungen - bis zur Überblendung von Epochen, wie sie für die allegorische Geschichtsschreibung charakteristisch ist."
Flanerie, Literatur, Utopie, Moderne, Dialektik, Allegorie, Syntagma, Metropole, Phantasmagorie, mikrologische Textebene, überblendete Epochen - in Willi Bolles Setzkasten waren alle Begriffe, die schillerten und oszillierten, liebevoll aufgereiht. Aber die Lackschicht auf den schönen Sammlerstücken war dünn, und mit ihrer Ausstellung war niemandem geholfen. Mit James Krüss zu sprechen: Wenn an Stangen Schlangen hangen und der Biber Fieber kriegt, dann entsteht zwar ein Gedicht, aber sinnvoll ist es nicht.
Und das soll es auch nicht sein. Die Priester des Flaneurkults betrachten sich zwar immer noch als Erben der Aufklärung, aber was sie verkünden, sind letzte, rauschhaft und phantasmagorisch erschaute Wahrheiten. Gewaltig rauschen ließ es beispielsweise Dietmar Voss 1988 in seinem Essay über die "Rückseite der Flanerie": "Erst das Aufbrechen der phantasmagorischen Zwangsbildungen eröffnet die Aussicht auf den Flaneur als ein rauschhaftes, ekstatisches Potenzial von Subjektivität, das exemplarisch offenbarend ist und nicht von einem personalen Unbewussten oder Verdrängten sich herschreibt. Der Flaneur ist letztlich kein Typus, sondern eine unbewusste Eigenschaft von allgemeiner Empfänglichkeit und Exzedierung, welche virtuell allen Menschen, von ihnen geschichtlich herausgearbeitet, eigen und erreichbar ist und in der industriellen Moderne des Kapitalismus und seinen Metropolen, von religiösen Überbauten befreit, eine offenbarende Kraft erwirken kann."
Mit anderen Worten, aber in ähnlicher Exaltation hielten zu Beginn des Ersten Weltkriegs Studienräte ihre Sedan-Reden. Damals versprach man sich das Erwirken offenbarender Kraft noch vom Waffendienst am Vaterland. Der salbungsvolle Ton hat überlebt, während das Objekt der feierlichen Betrachtung vom Parademarsch zur Flanerie übergegangen ist und dabei die chronologische Ordnung außer Kraft gesetzt hat: Als die Idee von der Armee als nationaler Erziehungsschule ihre größten und bösesten Blüten trieb, war die Belle Époque der Flanerie längst dahin; die letzten Flaneure hatten das Geheimnis ihrer hohen Kunst mit ins Grab genommen.
"Zu bummeln heißt zu vegetieren, zu flanieren heißt zu leben", wusste Honoré Balzac. Eine Gleichung von ebenso tückischer Schlichtheit hinterließ Victor Hugo: "Umherschweifen ist menschlich; Flanieren ist pariserisch." Die Nachwelt tat sich schwerer damit, das Flanieren zu definieren, auch wenn sie dabei mitunter betont forsch vorging: "Flanieren ist die Ostentation eines Lebens in der Käuflichkeit. Der Flaneur fühlt sich radikal in den Preis ein, weil er keinen hat - so ist er der radikal Preisgegebene der Menge. In ihm inkarniert sich die Macht der Entfremdung", fabulierte 1986 Norbert W. Bolz in einem von ihm selbst und Richard Faber herausgegebenen Band mit Studien über Benjamins Passagen-Werk. Bolz verglich den Flaneur mit der Hure, stufte ihn jedoch als noch durchtriebener ein: "Der Flaneur überbietet die Hure, indem er die Passage als Interieur belebt; die Passage ist ihm Bordell als ob." Wer da noch folgen kann, muss Musik in den Beinen haben. Gedanklich lässt sich der Schlingerkurs der Argumentation nicht nachvollziehen.
Man kann nicht behaupten, dass die Dechiffrierung der Flanerie seit den Tagen Balzacs nennenswerte Fortschritte gemacht habe. Redlich schien sich 1992 Heiner Weidmann um eine haltbare Definition zu mühen, doch auch ihn trug der Rausch aus der Kurve: "Flanieren ist Ähnlichkeitswahrnehmung: Etwas wird zugleich mit etwas anderem, das es ausschließt, wahrgenommen. ,Superposition' nennt Benjamin häufig dieses Phänomen im Zusammenhang mit dem Rausch; und der Rausch des Flaneurs ist nichts anderes als sein Lesen. Berauschend treten ihm Stadt und Landschaft, Straße und Stube zu Metaphern lesbar zusammen." Es hilft nichts: Jeder Definitionsversuch geht im Rauschen unter. Nicht nur die Epigonen und Nachdichter des Flaneurs, auch seine gelehrten Deuter berauschen sich an seinen Räuschen.
Der "delirierende Blick" und "die spezifische Gehbewegung des Flaneurs" gehörten zusammen, schreibt Harald Neumeyer und führt zum Beweis eine rhetorische, 1986 von der Schriftstellerin Undine Gruenter gestellte Frage an: "Muss ich noch sagen, dass das Gehen selbst zum Rausch wurde, zu Opium, Traum, Brand der Bilder?" Nein, Undine Gruenter hätte es nicht mehr sagen müssen. Es war schon tausendmal gesagt worden. Und doch sagte sie es zum tausendundersten Mal, und der akribische, engelsgeduldige Flanerie-Forscher Harald Neumeyer, einer der gründlichsten seiner Zunft, hat es vermerkt.
Es wäre vielleicht zu viel verlangt, ausgerechnet von den Trabanten Benjamins gesunde Respektlosigkeit zu erwarten. Viele von ihnen verstehen ihre Arbeit als Gottesdienst. 1990, im Katalog zu einer Benjamin-Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau, gaben sich die Ausstellungsmacher als Jünger zu erkennen, über welche Benjamins heiliger Geist ausgegossen worden sei: "Tatsächlich folgten wir unirritierbar einer Innervation, einem Impuls, der unseren Geist wie unsere Körper getroffen hatte bei der Vorstellung, Benjamins Denken auszustellen."
Es gebe "schlechtere Heilige" als Benjamin, bemerkten 1991 zwei andere Jünger, Hans Puttnies und Gary Smith, und versicherten treuherzig, dass sie mit ihrer "biografischen Recherche" keinesfalls "die Liturgie um ihn stören" wollten. Ein Hochamt zelebrierte 1992 Georg Lechner vom Pariser Goethe-Institut, als er ein Vorwort für den Katalog "Passagen. Nach Walter Benjamin" verfasste: "Walter Benjamin hat in diesem Jahrhundert Ort und Zeit literarisch neu unter Strom gestellt, die Klagemauer als jahrhundertealten Zeitraum entlarvt, dem Ort sein Gedächtnis wiedergegeben und dem Gedächtnis seinen Ort. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Symbiose: Geschichten - Geschichte. Wie für Kandinsky das Malen, so war für Benjamin Schreiben das Auftauchen an einem anderen Ort." Denn wie der Flaneur war auch sein oberster Herold ein Mann von vielen Talenten und sogar ein Vorläufer Daniel Düsentriebs: Er revolutionierte die Elektrotechnik, als er Ort und Zeit "neu unter Strom" stellte, er tauchte durch literarische Teletransportation beim Schreiben "an einem anderen Ort" auf, und im Vorübergehen entlarvte er die Klagemauer, die sich davon, wie man weiß, bis heute nicht so recht erholt hat. Das soll Walter Benjamin erst einmal jemand nachmachen.
Auf Knien näherte sich ihm 1992 die Schriftstellerin Elke Erb: "Nun habe ich Ursprung des deutschen Trauerspiels wieder gelesen, erst mit Geduld (jener Geduld, in die sich Stille füllt) und behutsam (so wie die Bewegung eines Blinden durch die Stadt als Gleiten vorstellbar ist). Dann aber war es, als ob das Gemüt - jene Sammelbildung der, einzeln Mut genannten, seelischen Kräfte, die sie als Gewächs überlebt, verwahrt und . . . - als ob das Gemüt Nahrung aufnimmt. Dankbarkeit ist nicht das ausreichende Wort." Absatz. Fortsetzung: "In dem Raum, der sich solcher Wahrnehmung beim Lesen imaginär geöffnet hatte, lag winterliches Licht gebreitet, aus dessen Unruhe und kurzer Gewissheit ich auch ein nachträgliches Begehren verstand, das mich mit Mahnung und Sehnsucht auf den rechten Weg, besser - in die rechte Heimat wies: Was hast du woanders verloren!"
Komponiert hatte Elke Erb ihren Psalm für den von Michael Opitz und Erdmut Wizisla herausgegebenen Psalter "Aber ein Sturm weht vom Paradiese her. Texte zu Walter Benjamin". Aus der tränenseligen Anrufung der rechten Heimat, der seelischen Kräfte, des winterlichen Lichts, der Dankbarkeit, der Sehnsucht und jener "Geduld, in die sich Stille füllt", war von Benjamins zum Teil doch immerhin scharfen und diskutablen Gedanken nicht mehr viel herauszuhören. Nicht von der Hand zu weisen ist der Verdacht, dass seine Anbeter, wenn sie entflammt über den Flaneur und Benjamins Deutungen des Flaneurs theoretisieren, insgeheim von der großen Mausefalle Pigalle wachträumen, von Jetonstapeln, ejakulierenden Champagnerflaschen, von langen Nächten im Folies-Bergère und jenem prickelnden Je-ne-sais-quoi, das sich seit Olims Zeiten jeder Tourist von seiner Paris-Visite versprechen darf.
Moden kommen und gehen. Auch die akademische Mode der Flaneur-Vergötterung wird eines noch fernen, aber schon deutlich überfälligen Tages den Weg alles Vergänglichen gehen müssen. Als legitimer Erbe des Flaneurs könnte dann der gemeine Autofahrer des späten zwanzigsten Jahrhunderts in seine Rechte treten. An Breitenwirksamkeit kann er es mit dem Flaneur allemal aufnehmen, und die Physiognomie der modernen Metropolen hat er stärker verändert als alle anderen Verkehrsteilnehmer. In den Rang des philosophisch Bedenkenswerten und Betrachtungswürdigen kann sich das Autofahren aber erst emporschwingen, wenn es von gestern sein wird. Das kann noch dauern. Aber dann wird kein Halten mehr sein.
GERHARD HENSCHEL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main