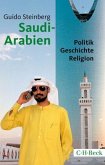China macht Angst. Im Bewusstsein des Westens gilt China als Herausforderung der universalen Werte liberaler Gesellschaften. Doch umgekehrt gilt dasselbe: Es sind die freiheitlichen Ideale der westlichen Gesellschaft, die die traditionellen chinesischen Ordnungsmuster erschüttern und ehemals feste Orientierungspunkte auflösen. China hat Angst - vor der Freiheit.
Helwig Schmidt-Glintzer untersucht die kulturellen Tiefenstrukturen einer von der Partei bestimmten Nation, in der jede Kritik an der staatlichen Ordnung als Bedrohung ihrer Existenz empfunden wird, und er fragt nach den Vorstellungen von Glück und einem gelingenden Leben in einer Gesellschaft, in der Individualität als fragwürdiger Wert gilt. Er stellt die Eigengesetzlichkeit des chinesischen Modernisierungsprozesses ins Zentrum seiner Überlegungen und zeigt auf, wie sich universalistische Wertbindungen zu den kulturellen und religiösen Traditionen verhalten. Wenn wir verstehen wollen, was der Aufstieg Chinas für uns bedeutet, werden wir fragen müssen: Was bedeutet die Freiheit in China?
Helwig Schmidt-Glintzer untersucht die kulturellen Tiefenstrukturen einer von der Partei bestimmten Nation, in der jede Kritik an der staatlichen Ordnung als Bedrohung ihrer Existenz empfunden wird, und er fragt nach den Vorstellungen von Glück und einem gelingenden Leben in einer Gesellschaft, in der Individualität als fragwürdiger Wert gilt. Er stellt die Eigengesetzlichkeit des chinesischen Modernisierungsprozesses ins Zentrum seiner Überlegungen und zeigt auf, wie sich universalistische Wertbindungen zu den kulturellen und religiösen Traditionen verhalten. Wenn wir verstehen wollen, was der Aufstieg Chinas für uns bedeutet, werden wir fragen müssen: Was bedeutet die Freiheit in China?

Sechzig Jahre nach der Gründung besteht die Volksrepublik China auf dem Recht, alle Fehler, die andere Länder im Lauf der Weltgeschichte schon begangen haben, auch einmal zu machen.
Von Peter Sturm
Vielleicht ist es eine Folge der Gobalisierung, dass Menschen sich nur noch selten mit einem Thema, einem Land vertieft beschäftigen. Minütlich stürzen so viele Informationen und solche, die es gerne wären, auf uns ein, dass es großer Anstrengungen bedarf, auch nur die Übersicht über die Schlagzeilen zu behalten. Dies steigert wohl die Bedeutung von Jahrestagen. Die Volksrepublik China feiert in diesem Jahr den 60. Jahrestag ihrer Gründung. Und weil das Land auch noch "Ehrengast" der Frankfurter Buchmesse ist, reagieren die Verlage entsprechend. Ob das alles marktgerecht ist, muss Außenstehende zwar nicht interessieren, ist aber trotzdem eine interessante Frage.
Es gibt Bücher, die (ein weiteres Mal) endgültige Antworten auf Fragen geben wollen, die vielen im Zusammenhang mit China durch den Kopf gehen. Dann gibt es Erfahrungsberichte aus dem Alltag in China. Es gibt wissenschaftliche Werke. Und es gibt Publikationen, die ohne große rhetorische Girlanden wichtige Fakten über das große und vielgestaltige Land liefern. Mit einem für die Regierung in Peking potentiell heiklen Thema befasst sich Klemens Ludwig. In der Volksrepublik leben 55 ethnische Minderheiten. Die machen zwar weniger als zehn Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Aber da sie zum großen Teil in Grenzregionen leben, sind sie aus Sicht einer notorisch misstrauischen Führung Quellen potentieller Instabilität. Ernsthafte Schwierigkeiten hat Peking allerdings nur mit zwei Völkern innerhalb des "chinesischen Volkes", mit Tibetern und Uiguren. Weil deren Aufbegehren gegen - wie viele es dort empfinden - die chinesische Besetzung im Ausland viel Aufmerksamkeit findet, sucht die chinesische Propaganda die Ursache für die Konflikte auch gerne im Ausland. Erleichtert wird ihr das durch die Existenz einer nennenswerten und politisch aktiven Exilgemeinde beider Völker.
Im Selbstverständnis der Herrschenden können Autonomiebestrebungen der Minderheitenvölker bestenfalls Ausfluss großer Undankbarkeit sein, gilt doch die Herrschaft Chinas als quasi naturgegeben. Die geographischen Grenzen dieser Herrscherauffassung sind, wie Ludwig herausarbeitet, fließend. Dass dies bei Nachbarvölkern nicht zu Begeisterungsstürmen führt, ist an sich klar. Aber wenn man sich für berufen hält, über andere zu herrschen, fehlt für solche Feinheiten wahrscheinlich das Gefühl. Qualitativ hat das Buch das Zeug zum Nachschlagewerk. Wie viele entsprechende Versuche Umschlag und Heftung zulassen, wäre ein interessanter Test, dessen Ergebnis man dem offenbar sehr kostenbewussten Verlag mitteilen sollte.
Der Gegenentwurf der Eliten zum europäisch-amerikanischen Modell.
Mit den tieferen Ursachen des Verhaltens der chinesischen Regierung - nicht nur gegenüber nationalen Minderheiten - befasst sich Helwig Schmidt-Glintzer. Er versucht Verständnis für chinesische Denkweisen zu vermitteln, ohne dabei freilich der Pekinger Regierung in allen Lebenslagen argumentativ nach dem Mund zu reden. China, beziehungsweise seine Regierung, hat also Angst vor der Freiheit. Wie das die Bewohner des Landes sehen, hat bislang weder die Führung ausprobieren wollen, noch das Ausland nachprüfen können. Klar dürfte sein, dass auch ein freiheitlich verfasstes China nicht das bloße Abbild eines europäischen oder anderen westlichen Landes wäre. Nationale kulturelle Traditionen lassen sich nicht verleugnen. Die lassen sich konstruktiv gebrauchen. Die kann man aber auch missbrauchen. Die Außenwelt muss in jedem Einzelfall entscheiden, was gerade vorliegt, und ihre Reaktion daran ausrichten. Das wird vor allem bei der Führung selten auf große Gegenliebe stoßen. Das Streben nach allerhöchstem (Pekinger) Wohlwollen kann aber eigentlich keine Kategorie internationaler Politik sein, auch wenn das Verhalten mancher einen anderen Schluss zulässt.
Dass "Freiheit", wie Schmidt-Glintzer herausarbeitet, mit Chaos und Zügellosigkeit gleichgesetzt wird (ob von den Menschen oder von der Führung, bleibt unklar), muss man nicht auf Anhieb verstehen. Allerdings wird man es zur Kenntnis nehmen müssen. Dass Freiheit immer dort ihre Grenzen hat, wo die Freiheit des Nächsten beginnt, ist in Europa Allgemeingut. Also könnte China vielleicht doch in und von Europa etwas lernen. Da China ja energisch auf dem Recht besteht, alle Fehler, die andere im Lauf der Weltgeschichte gemacht haben, auch einmal machen zu dürfen, sind solche Ratschläge dort vermutlich nicht erwünscht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Pekings plumper Umgang mit kleinen Freiheitsbestrebungen im Ergebnis zu dem Chaos führt, das man energisch verhindern will, ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen.
Während Chinas Führer ängstlich auf ihr Land blicken, ist ihr Umgang mit der Außenwelt von zunehmendem Selbstbewusstsein, das zuweilen in die bekannte Arroganz des Neureichen umschlägt, geprägt. Dieses Selbstbewusstsein gründet sich mittlerweile, wie Mark Leonard ausführlich darlegt, längst nicht mehr nur auf wirtschaftliche Macht. Chinas Eliten sind dabei, ein eigenes Modell der Globalisierung zu entwickeln, das auf andere Weltgegenden abfärbt und als Gegenentwurf zum europäisch-amerikanischen Modell gesehen wird. Man beklagt, dass China viel zu lange danach gestrebt habe, ausländische Modelle und Ideen zu kopieren, anstatt sich auf die eigene Kraft zu verlassen. Wie weit dieses Streben nach intellektueller Autarkie der heutigen und künftigen Welt gerecht wird, bleibt abzuwarten. Ignorieren darf man es nicht.
Leonard arbeitet heraus, dass die (systemkonformen) Denker innerhalb der Führungsstruktur die Funktionen ausüben, die in westlichen Systemen Parteien und gesellschaftliche Gruppen haben. Insofern ist auch das "neue China" strukturell durchaus von dieser Welt. Und die nicht zu bestreitende Attraktivität der chinesischen Ideen zum Beispiel in Afrika resultiert nicht zwangsläufig daraus, dass sie die Lösung vieler Probleme bedeuteten. Westlich-demokratische Ideologie ist in gewisser Weise eine Ansammlung von Zumutungen, zumindest für Regierende anderer Systeme. Dass man sich da gerne andere Partner sucht, ist naheliegend. Die Qualitätsprobe der Ideen steht freilich noch aus.
In China werden allerlei Experimente gemacht. Diese orientieren sich an den unterschiedlichsten Ideen. Das könnte zu einem produktiven Wettbewerb führen. Aber in einem Einparteienstaat siegt eben nicht mit größter Wahrscheinlichkeit die beste/erfolgreichste Idee. Vielmehr gewinnt die, mit der man zur richtigen Zeit das Ohr des richtigen Herrschers erreicht. Die Propagierung der anderen Ideen wird dann im schlimmsten Fall zum lebensgefährlichen Experiment.
Das war zwar in Europa vor 200 Jahren auch nicht anders. Damals war jedoch die Welt eine ganz andere. Welche unerfreulichen Auswirkungen die offizielle Propaganda gegen aufbegehrende nationale Minderheiten haben kann, schildert die österreichische Fernsehkorrespondentin Cornelia Vospernik in ihrem an sich sehr kurzweiligen Buch mit Erlebnissen aus dem Alltag in China. Mehrfach und an unterschiedlichen Orten wird sie gefragt, ob sie ein "Xinjiang-Mensch" sei. Einfach strukturierte Menschen (nur sie?) stellen sich die zu Monstern stilisierten, angeblich immer terroristischen Uiguren so vor, wie Europäer aussehen. Frau Vosperniks Hinweis auf ihre wahre Herkunft lässt das Misstrauen nicht unbedingt sinken. Denn sie sagt das alles in flüssigem Chinesisch. Und welcher Europäer, so Volkes Meinung in China, kann das schon? Vielleicht, so denken manche, ist sie eben doch ein "Xinjiang-Mensch". Und ein solcher kann kein guter sein.
Der Marsch durch das Jahrhundert mit Hilfe von fünf Leitbegriffen.
Das in einem angenehmen Plauderton und nicht ohne Selbstironie geschriebene Buch weckt beim Durchschnittseuropäer wahrscheinlich nicht den Wunsch, demnächst nach China umzuziehen. Dabei verkneift sich die Autorin jede überflüssige Häme. Missstände werden allerdings als solche benannt. Jedes Land hat eben seine Eigenheiten. Die muss man nicht mögen. Aber man muss sie akzeptieren.
Inmitten der unzähligen Bücher über das gegenwärtige und mögliche künftige China tut es gut, zur Abwechslung einmal ein Stück solide Geschichtswissenschaft in die Hand zu bekommen. Und wie so manches andere Stück solider Wissenschaft ist auch Sabine Dabringhaus' Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert nichts für Leser mit wenigen oder gar keinen Vorkenntnissen. Wer zumindest ein Ereignisraster im Kopf hat, wird souverän durch die Wirren dieses Jahrhunderts geführt. An dessen Beginn war China das, was man einen Spielball ausländischer Mächte nannte. An seinem Ende schickte es sich an, viele auf der Welt das Fürchten zu lehren. Die Autorin bewerkstelligt den Marsch durch das Jahrhundert mit Hilfe von fünf Leitbegriffen: Konfuzianismus, Nationalismus, Kommunismus, Demokratisierung und Kapitalismus. Das Spannungsverhältnis zwischen dem, was chinesische Traditionen genannt wird, und westlichen Ideen und Vorstellungen durchzieht das ganze Werk. Zu Beginn des Jahrhunderts sahen viele Chinesen die einzige Rettung für ihr Land in der unkritischen Übernahme alles Westlichen. Heute werden Methoden des Wirtschaftens, die in Europa oder Amerika entwickelt wurden, gerne übernommen. Politisch ist der Westen jedoch nach Meinung der Führung, die vorgibt, genau zu wissen, was gut ist für "ihr" Volk, Gift.
Mit solchen Widersprüchen muss nicht nur die chinesische Regierung leben. Die Außenwelt wird sich in vielen Fragen an diesem Land und seinen Führern noch oft die Zähne ausbeißen. Falls es gut läuft, wird sich China in die globalisierte Welt des 21. Jahrhundert einfügen als wichtiges Land, das freilich bereit ist, die Regeln einer internationalen Gemeinschaft auch auf sich anzuwenden. Nicht alles, was aus dem heutigen China zu hören ist, lässt dieses angenehme Szenario wahrscheinlich erscheinen.
Klemens Ludwig: Vielvölkerstaat China. Die nationalen Minderheiten im Reich der Mitte. C. H. Beck Verlag, München 2009. 190 S., 12,95 [Euro].
Helwig Schmidt-Glintzer: Chinas Angst vor der Freiheit. Der lange Weg in die Moderne. C. H. Beck Verlag, München 2009. 149 S., 10,95 [Euro].
Mark Leonard: Was denkt China? Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2009. 197 S., 14,90 [Euro].
Cornelia Vospernik: In China. Reportagen abseits der Schlagzeilen. Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 2009. 159 S., 19,90 [Euro].
Sabine Dabringhaus: Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert. C. H. Beck Verlag, München 2009. 293 S., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Hewig Schmidt-Glintzers Untersuchung der tieferen Ursachen für das Verhalten der chinesischen Regierung, die jede Kritik als existenzbedrohend empfindet, scheint Rezensent Peter Sturm recht erhellend. Im Rahmen einer Sammelrezension von Büchern, die anlässlich des 60. Jahrestages der Volksrepuplik erschienen sind, attestiert er dem Autor, Verständnis für die Denkweisen der Führung Chinas zu vermitteln, ohne sich opportunistisch anzubiedern. Schmidt-Glintzer macht ihm klar, warum die chinesische Regierung Angst vor der Freiheit hat: sie setzt sie mit Chaos und Zügellosigkeit gleich. Sturm geht in seiner Besprechung auch auf das europäische Freiheitsverständnis ein und sieht hier einen Punkt, wo China von Europa lernen könnte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH