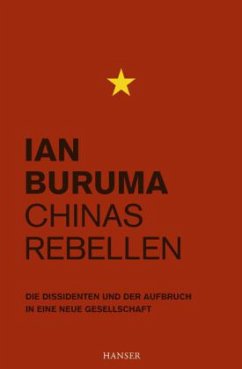Chinas Dissidenten. Werden sie die Zukunft Chinas bestimmen? Manche von ihnen haben im Exil alle Hoffnung auf einen Wandel in China begraben, andere kämpfen noch immer für eine freies Land. Ian Burumas große Reportage erzählt von ihren Träumen und Enttäuschungen, aber auch vom dramatischen Umbruch, den China zur Zeit durchlebt und dessen Erschütterungen auch den Westen erreichen werden.

Von Kultur will Ian Buruma nichts wissen, wenn er mit den Rebellen vom Tiananmen und anderen Dissidenten redet / Von Mark Siemons
Chai Ling war die bekannteste Studentenführerin auf dem Platz des Himmlischen Friedens, wo im Frühjahr 1989 Hunderttausende für Demokratie und Menschenrechte demonstrierten. "Wir, die Kinder, sind bereit, unser Leben für die Sache der Wahrheit einzusetzen": Mit solchen Worten hatte die gerade einmal 23 Jahre alte Psychologiestudentin ihre Kommilitonen zum Hungerstreik bewegt. Berühmt wurde ihr Tonbandprotokoll, in dem sie sich erinnert, wie sich die Studenten, als die Panzer kamen, bei den Händen faßten und mit Tränen in den Augen "Nachkommen des Drachen", die Rock-Hymne ihrer Generation, sangen. "Wir wußten, daß das Ende nahte. Es war an der Zeit, für die Nation zu sterben."
Auf abenteuerlichen, bis heute nicht ganz geklärten Wegen konnte Chai Ling in den Westen fliehen, zuerst nach Paris, später nach Cambridge, Massachusetts, wo sie heute eine Software-Firma betreibt. Der holländische Sinologe und Reporter Ian Buruma hatte sie 1996 kennengelernt, als sie noch durch die Talkshows zog und sich routiniert über die "konstitutionell gezogenen Grenzen der Macht" ausließ. Als er sie drei Jahre später wieder traf, nunmehr als Unternehmenschefin, wollte sie über "all diesen alten Kram, diesen Dreck" gar nicht mehr reden. Im Grunde habe sie immer "nur darum kämpfen wollen, sie selbst zu sein", und dann am Ende gemerkt, daß sie die geborene Unternehmerin sei. So war Chai Ling, "die einstige Ikone der Geschichte", kommentiert Buruma, "in eine Welt übergelaufen, die alle Geschichte für Mumpitz erklärte".
Chai Lings Weg ist typisch für viele Mitglieder der Tiananmen-Generation. Aber ist mehr nicht geblieben? Ian Buruma hat überall, wo Chinesisch gesprochen wird, in Amerika, Singapur und Taiwan ebenso wie in der Volksrepublik selbst, außer Chai Ling noch viele andere von "Chinas Rebellen" aufgesucht, um sie nach ihren politischen Vorstellungen und dem Grund ihres Engagements zu fragen. Heute, da das faszinierte Staunen über den rasanten ökonomischen Aufstiegs Chinas bloß noch mit dem politischen Status quo zu rechnen scheint, ist das ein großes Thema. Auch für den Westen liegt ja offenbar nichts ferner und entlegener als die damalige Demokratiebewegung; "China" wird unwillkürlich mit der das Land regierenden Kommunistischen Partei identifiziert. Doch wenn das Land tatsächlich wieder zu einer Größe werden sollte, auf die sich der Westen einzustellen hat, wäre eine solche Fixierung auf die gegenwärtigen Machtverhältnisse eine möglicherweise sehr fahrlässige Kurzsichtigkeit.
Darüber hinaus trifft die Frage nach den Dissidenten einen Nerv der chinesischen Kultur selbst: Wie verhält sich der Widerstand von heute zum traditionellen Desinteresse der Intellektuellen an politischer Positionierung? Rebellionen hat es in China zwar immer gegeben, doch anders als im Westen haben sie nie zu einer dauerhaften Gewaltenteilung geführt. Theoretiker wie der französische Philosoph François Jullien halten die im Daoismus wie im Konfuzianismus gründende Weigerung, Stellung zu beziehen, für den blinden Fleck des chinesischen Denkens; sie sei der Grund dafür, daß China bis heute keine politischen Institutionen ausgebildet habe, die die Macht des Fürsten begrenzen. Wie nun steht es heute mit dem Bewußtsein für solche Voraussetzungen einer funktionstüchtigen Zivilgesellschaft?
Buruma will diese Fragen nicht abstrakt, sondern über seine Gesprächspartner beantworten. Er besuchte mehrere Studentenführer von damals, unter anderen Wu'er Kaixi; viele sind heute in der amerikanischen Geschäftswelt tätig und in die heillosen Intrigen der Exil-Paranoia verstrickt. Auch das Urbild der chinesischen Demokratiebewegung, der Arbeiter Wei Jingsheng, lebt heute in Amerika, wo er Buruma vor allem mit seiner anarchistischen Fahrweise beeindruckte. Schon 1978 hatte er die Wandzeitung "Demokratie: Die fünfte Modernisierung" veröffentlicht und damit Deng Xiaoping persönlich herausgefordert. Nach vielen Haftstrafen wurde er 1997 abgeschoben.
In den Vereinigten Staaten besuchte Buruma auch den Journalisten Liu Binyan, den Politikwissenschaftler Yan Jiaqi, den Astrophysiker Fang Lizhi (der "chinesische Sacharow") und die Autoren der Fernsehserie "Heshang", die in den achtziger Jahren dafür warben, die Gebrechen Chinas mit westlichen Ideen zu heilen und heute als evangelische Prediger wirken und das Christentum als das Wertfundament bezeichnen, das China fehlt. In Hongkong traf Buruma Martin Lee, den Vorsitzenden der Demokratischen Partei, und den vom Festland geflohenen Arbeiterführer Han Dongfang (auch diese beiden praktizierende Christen). In Peking sprach er mit einer jener "Müttern vom Tiananmen", deren Kinder damals getötet worden waren. Doch auch in Singapur und Taiwan, die es mit nichtkommunistischen Regimen zu tun haben (in Taiwan liegt die Demokratisierung nicht lange zurück, Singapur wird immer noch autoritär regiert), sprach er mit Oppositionellen, die oft viele Jahre im Gefängnis für ihre demokratische Gesinnung gebüßt haben.
So unterschiedlich diese Rebellen auch sind, fand Buruma bei den meisten doch etwas Gemeinsames vor. Sie sprachen nämlich nicht nur von der Überwindung des Machtmonopols, dem Recht auf Redefreiheit und ähnlichen politischen Universalien. Sie bezogen sich vielmehr mit mehr oder minder großer Intensität auch auf jenes alles überwölbende Über-Ich, das "China" heißt. Wenn sie die Notwendigkeit von Reformen herausstrichen, dann häufig mit der alten Ambition, "China zu retten". Selbst jene Kantonesin, die in Amerika zu einer "feschen, gutgekleideten, ehrgeizigen New Yorkerin" geworden ist, überrascht Buruma damit, daß sie immer "Wir Chinesen" sagt und spirituelle Werte als Voraussetzung der Zivilgesellschaft betrachtet: "Wir Chinesen haben ein gemeinsames Heimatgefühl, wissen Sie, wir lieben China und wollen das Land wieder stark machen." Im Internet, das Buruma als virtuellen Vorschein des auf Erden noch nicht realen chinesischen Pluralismus beschreibt, wecken die stärksten Emotionen die kollektiven Traumata wie das Massaker 1937 von Nanjing, und die schärfste Kritik an der Regierung besteht in dem Argwohn, daß diese "China nicht genügend liebe".
Mit so etwas kann Buruma wenig anfangen. In vielen Aufsätzen und Büchern, vor allem "Der Staub Gottes", das seine Erfahrungen in verschiedenden südostasiatischen Ländern zusammenfaßt, hat Buruma scharfzüngig jene Ideologie gegeißelt, die mit dem Verweis auf irgendwelche "asiatischen Werte" oder sonstigen kulturellen Besonderheiten demokratische Grundrechte als "westlich" denunziert und damit suspendiert. "Oft benutzen die Herrschenden das Kulturelle nur als Legitimation für die Verewigung ihres Machtmonopols", schreibt er auch in diesem Buch. Was ihn nun aber irritert, ist, derlei Vorstellungen nicht nur bei den Herrschenden zu finden, sondern auch bei denen, die ihnen Widerstand leisten. Bei allem Respekt, manchmal sogar Bewunderung, die er den Protagonisten des Widerstands sonst entgegenbringt, liefert er sie in diesem Punkt seinem Spott aus, ohne sich mit ihren kulturellen Beweggründen überhaupt noch weiter zu beschäftigen.
Das ist leider auch der Punkt, an dem das Buch mit seiner doch so elektrisierenden Ausgangsfrage langweilig zu werden beginnt. Buruma ist so durchdrungen von der Einsicht, daß kulturelle Faktoren ideologisiert und mißbraucht werden können, daß er sie offenbar überhaupt für irrelevant hält, zumindest als Voraussetzung für die Demokratie. Wenn nur das Wort fällt, bricht die Reflektion auch schon ab und bringt sich so um jede spezifische Erkenntnis, die über das ohnehin schon vorher Gewußte (Demokratie besser als Diktatur) hinausgeht. Dabei bleibt dem Autor zum Beispiel auch die Selbstbestimmung der Tibeter in ihrer religiösen Prägung fremd; er vermag da nichts anderes als die fatale Alternative zwischen Modernisierung chinesischen Stils einerseits und der Herrschaft von Hohenpriestern andererseits wahrzunehmen.
So oft bügelt Buruma die Ansichten seiner Gesprächspartner nieder, wenn sie den seinen nicht ganz entsprechen, daß man bald den Eindruck gewinnt, daß er an ihnen gar nicht richtig interessiert ist. So ähneln sich die Begegnungen in ihrem immergleichen kritischen Gestus, und da sie deshalb meist nichts ergeben, was über die Referierung der Geschichte hinausgeht, fällt der Reportage-Gestus etwas ins Leere. Die anfangs so erfrischende Schreibstrategie, immer wieder zwischen der Schilderung von Gesprächssituationen, historischen Exkursen und eigenen Reflektionen hin und her zu pendeln, nutzt sich dadurch bald ab.
Das liegt auch daran, daß sich die Reflektionen meist auf eine durchaus kurze Reichweite beschränken, gleich, ob es um die Geschichte oder um die Gegenwart geht. Zur Kennzeichnung der Tradition fällt Buruma meist nur das Interpretationsmuster des "Konfuzianismus" ein, der es ja, wie man weiß, mit der demokratischen Kultur nicht so hat. Statt, wie es leicht fällt, die klassische rhetorische Figur der "Rettung des Landes" zu belächeln, wäre es aufschlußreicher gewesen, sich zu fragen, was heute unter ihr verstanden wird und wie sie sich unter dem Eindruck der Ökonomisierung der Gesellschaft verändert. Wie man an Chai Ling sieht, war ja auch die Demokratiebewegung von 1989 mindestens so sehr an chinesischen Traditionen wie an abstrakt-universalistischen Prinzipien orientiert.
Genauso wenig scheint Buruma an einer Untersuchung der Entwicklungen seit den neunziger Jahren gelegen zu sein. Zur Aktivierung seiner moralisch-demokratischen Reflexe genügt es ihm zu konstatieren, daß da eine kommunistische Partei herrscht - als sei damit alles gesagt. Man wird ihm nicht vorwerfen können, daß er wie so viele China-Begeisterte aus der Wirtschaft die fortdauernde Willkürherrschaft und Repression übersähe. Aber er scheint für die strukturellen Wandlungen blind zu sein, denen die Partei selbst unterworfen ist, und dafür, daß sie längst nicht mehr Herr über all die Veränderungen ist, die sie angestoßen hat.
Das Buch beschäftigt sich auch nicht mit den Auswirkungen, die die wirtschaftliche Liberalisierung auf das Selbstbewußtsein der Bürger und deren Bereitschaft hat, ihre Interessen aktiv zu vertreten. Auch wenn immer noch genügend Tabus bleiben, wurde in den letzten Jahren der Radius des Sag- und Diskutierbaren allmählich erweitert. Von einer weiträumigen Demokratiebewegung, die sich vor allem an Ideen orientiert oder gar an Amerika anlehnt, ist zwar heute nichts zu sehen. Doch die reale Teilnahme an konkreten Entscheidungen ist größer als damals, und der Wille, sich nicht alles bieten zu lassen, auch. Die Zahlen, die das chinesische Sicherheitsministerium veröffentlicht hat, verzeichnen einen eklatanten Anstieg von konfliktiven "Zwischenfällen": 2001 waren es noch achtzig am Tag, im Dezember 2002 waren es siebenhundert. Besonders häufig sind die wütenden Proteste von Wanderarbeitern, denen ihr Lohn verweigert wird. Diese Rebellionen jenseits der großen Abstraktionen kommen bei Buruma kaum vor.
So liest sich sein Buch, dessen Protagonisten fast alle 1990 schon bekannt waren, wie die historische Chronik einer bereits abgeschlossenen Epoche, und als solche hat es einen unbestreitbaren dokumentarischen Wert: Man kann es als Enzyklopädie der Themen und Personen benutzen, die für China in den achtziger Jahren wichtig waren. Doch da es dabei stehenbleibt, wirkt die Schilderung der bisweilen enttäuschten Dissidenten von damals, ganz entgegen der Absicht, am Ende resignativ. Das haben Chinas Rebellen nicht verdient.
Ian Buruma: "Chinas Rebellen". Die Dissidenten und der Aufbruch in eine neue Gesellschaft. Aus dem Englischen von Hans Günter Holl. Carl Hanser Verlag, München 2004. 446 S., geb., 25,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Was für ein interessanter Stoff, wie enttäuschend der Umgang des Autors damit, so ließe sich das Urteil des Rezensenten Mark Siemons zusammenfassen. Ian Buruma hat einstige Protagonisten der chinesischen Rebellion von 1989 aufgesucht, vielfach im Ausland, um sie nach ihrer heutigen Haltung zum damaligen Geschehen zu fragen. Was er erlebte, muss ihn zutiefst enttäuscht haben. Wenig ist übrig vom Widerstandsgeist, immerzu berufen sich die Befragten auf chinesische Traditionen, auf "jenes überwölbende Über-Ich, das 'China' heißt". Damit kann nun Buruma, so Siemons bedauernd, herzlich wenig anfangen. Die "kulturellen Beweggründe" interessieren ihn wenig, er spottet darüber, so Siemons. Und diese ständig wiederholte Haltung, die findet der Rezensent doch arg "langweilig". Auch über die Entwicklung der neunziger Jahre erfahre man wenig. Immerhin, räumt Siemons ein, taugt das Buch als "historische Chronik einer bereits abgeschlossenen Epoche".
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"
"Die Rebellen als Vordenker: der hinreißende Erzähler Buruma stellt sie uns als mutige, mal verzagte, mal ungebeugte Einzelkämpfer vor, die eine Hoffnung eint: Dass irgendwann alle Chinesen ihre Meinung frei sagen können." Matthias Nass, Die Zeit