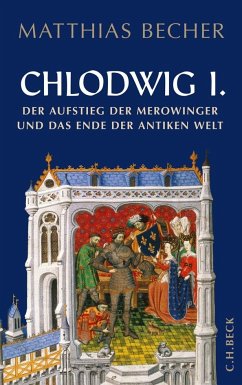Anlässlich des 1500. Todestages Chlodwigs I. (27. November 511) erzählt Matthias Becher in seiner Biographie dieses Frankenkönigs spannend und faktenreich vom Aufstieg der Merowinger in der Völkerwanderungszeit.
Angelockt durch die wachsende Schwäche Roms in der Spät-antike waren Goten, Franken, Burgunder und andere Völker in das entstehende Machtvakuum gestoßen. Wenige Jahre vor der Geburt Chlodwigs aus dem fränkischen Geschlecht der Merowinger war schließlich der letzte römische Kaiser abgesetzt worden (476 n.Chr.), und fortan tobte der Kampf um die Vormacht südlich und nördlich der Alpen.
Matthias Becher erhellt gleichermaßen die militärischen und diplomatischen Erfolge von Chlodwigs Vater Childerich, die Kämpfe Chlodwigs um die Führung im Frankenreich und seine religionsgeschichtlich bedeutende Entscheidung, den katholischen Glauben anzunehmen. Ein Ausblick auf das Nachleben Chlodwigs beschließt den gut bebilderten und mit hilfreichen Karten ausgestatteten Band.
Angelockt durch die wachsende Schwäche Roms in der Spät-antike waren Goten, Franken, Burgunder und andere Völker in das entstehende Machtvakuum gestoßen. Wenige Jahre vor der Geburt Chlodwigs aus dem fränkischen Geschlecht der Merowinger war schließlich der letzte römische Kaiser abgesetzt worden (476 n.Chr.), und fortan tobte der Kampf um die Vormacht südlich und nördlich der Alpen.
Matthias Becher erhellt gleichermaßen die militärischen und diplomatischen Erfolge von Chlodwigs Vater Childerich, die Kämpfe Chlodwigs um die Führung im Frankenreich und seine religionsgeschichtlich bedeutende Entscheidung, den katholischen Glauben anzunehmen. Ein Ausblick auf das Nachleben Chlodwigs beschließt den gut bebilderten und mit hilfreichen Karten ausgestatteten Band.

Von vielen Franzosen wird er als Vater ihrer Nation gefeiert: Der Frankenkönig Chlodwig erfährt in der Darstellung Matthias Bechers ein paar waghalsige Umdeutungen
Führt ein Staatsterrorist die Gründerväter Europas an? Von Chlodwig (dessen Lebenszeit von 465 bis 511 angesetzt wird), dem fränkischen Kleinkönig, der in wenigen Jahrzehnten durch Siege über Römer, Alemannen und Westgoten fast ganz Gallien unter seine Herrschaft brachte und mit Beitritt zur Reichskirche die katholische Dominanz in der mittelalterlichen Geschichte Europas bewirkte, wird jedenfalls Schreckliches berichtet.
Nach dem Zeugnis des Romanen Gregor, Bischofs von Tours (gestorben um 594), habe der Merowinger auch noch die anderen fränkischen Könige ausgerottet, darunter seine Verwandten. König Ragnachar von Cambrai und seinen Bruder habe Chlodwig mit dem Axthieb von eigener Hand erschlagen, andere habe er hinrichten und ermorden lassen oder zu tödlicher Familienfehde angestiftet. Noch viele weitere Könige habe er umbringen lassen, schreibt Gregor mit fasziniertem Entsetzen, "sogar seine Verwandten, von denen er fürchtete, sie könnten ihm das Reich nehmen. Als er aber eines Tages seine Leute versammelt hatte, soll er zu ihnen von seinen Blutsverwandten, die er ermordet hatte, so geredet haben: ,Weh mir, dass ich nun wie ein Fremdling unter Fremden stehe und keine Verwandten mehr habe, die mir, wenn das Unglück über mich kommen sollte, Hilfe gewähren könnte!' Aber er sprach dies nicht aus Schmerz um den Tod derselben, sondern aus List, ob sich vielleicht noch einer fände, den er töten könnte."
Die historische Forschung verzeiht Chlodwig in der Regel seine Grausamkeiten, wendet sich aber gern angeekelt von diesem Zeugnis eines vermeintlichen Zynismus ab. Ganz falsch, ruft nun der Bonner Professor Matthias Becher dazwischen, Verfasser einer Biographie des trotz allem großen Franken. Es sei ja schon merkwürdig, dass Chlodwig seine restlichen Verwandten nicht selbst gekannt haben solle; und vollends unglaubwürdig sei, dass er sich mit seiner unverhohlenen Todesdrohung so herausfordernd verhalten habe.
Vielmehr müsse man annehmen, Chlodwig habe sein jahrelanges Morden in der fränkischen Führungsschicht verborgen gehalten, so dass er nun mit einer gespielten Trauer über das Ende seiner Angehörigen deren Gefolgsleute zu sich hinüberzuziehen verstand: "Mit dieser öffentlich inszenierten Klage machte er es ihnen leichter, seine Herrschaft zu akzeptieren. Die Klage um die toten Könige war sozusagen eine Geste der Versöhnung."
Mit dieser Deutung hätten wir uns also von Gregors Bewertung des königlichen Verhaltens befreit; vor allem würde zwar Chlodwig nichts von seiner wohlberechneten Grausamkeit genommen, doch könnten wir ihm und seinen Zeitgenossen dazu immerhin ein gebrochenes Verhältnis unterstellen, und unsere ethischen Maßstäbe wären weniger verletzt.
Dagegen kann man mit Recht danach fragen, ob einer der führenden Franken über den Drahtzieher einer Mordserie, wie sie Chlodwig unterstellt wird, im Zweifel gewesen sein konnte? Sehr wohl mochte es auch sein, dass Chlodwig diejenigen erkennen wollte, die sich möglicherweise, berechtigt oder nicht, noch als seine Verwandten ausgeben und Anteile an der Herrschaft einfordern würden. Wer von diesen eitel und habsüchtig war, der konnte wohl selbst die Gefahr für Leib und Leben verkennen, wenn er nach Chlodwigs Verwandtenklage hervortrat. Warum soll man zudem ausschließen, dass Chlodwig ehrlich betrübt war? Konnte, was ein Herrscher für geboten hielt, nicht auch sein Gemüt belasten? Alles was wir über die Bedeutung der Verwandtenhilfe im frühen Mittelalter wissen, spricht dafür, dass Chlodwig die selbstgeschaffene Verlassenheit besorgt, wenn nicht depressiv gemacht hat.
Bechers Interpretation ist also keineswegs zwingend und resultiert weniger aus der Kunst der Quellendeutung als aus Vorannahmen, die eine starke Strömung der gegenwärtigen Forschung über politisches Handeln im Frühmittelalter hegt. Hier wird auf Seiten der Mächtigen gern eine Inszenierung vermutet, die es zu entschlüsseln gelte, um auf die "wahren" Motive zu stoßen. Die gezogenen Folgerungen bleiben aber meist nichts mehr als luftige Spekulationen. Solange die innere Plausibilität der historischen Zeugnisse nicht erschöpft ist, sollte man nicht zu waghalsigen Umdeutungen Zuflucht nehmen.
Wer bei Chlodwigs Handeln an Machiavelli denkt, macht sich kaum eines Anachronismus schuldig. Was also zeichnet den Fürsten nach der Lehre des großen Florentiners aus? Nicht nur, dass er sich um die Zuschreibung der Grausamkeit nicht sorgen müsse, wenn er seine Untertanen einig und treu erhalten wolle. Sondern mehr noch: Ein Fürst, der eine große Menge Soldaten befehlige, könne ohne den Namen des Grausamen niemals Herr über sie bleiben. Genau dies hat Becher bei seiner Deutung der berühmten Geschichte übersehen: Bei seinen Kriegs- und Vernichtungszügen konnte es Chlodwig nicht so sehr um die neu Unterworfenen gehen als um die Befriedigung seiner eigenen Krieger und die Verheißung neuer Herrschaften und Beute, für die eben die Grausamkeit, zumindest mehr als die Liebe, der Schlüssel war. Man verkennt die Härte einer archaischen Kriegergesellschaft und überschätzt die bezwingende Kraft der herrischen Geste, wenn man Chlodwigs Trauerrede auf einen falschen Adressaten bezieht. Es gibt keinen hinreichenden Grund, Gregors Deutung und Wertung des Geschehens zu verwerfen.
Jeder, der sich mit Chlodwig beschäftigt habe, würde ihm die beschriebene Handlungsweise zutrauen, schreibt Becher trotzdem. Sein eigenes Bild des unbestreitbar bedeutenden Frankenkönigs hat er allerdings nirgends expliziert. Er begnügt sich leider damit, in chronologischer Folge und unter Rückgriff auf die gesamte fränkische Vorgeschichte Sachverhalt für Sachverhalt, Geschehen für Geschehen abzuhandeln; ausführliche, immer dichter und länger werdende Quellenzitate werden kommentiert, aber nie in eine geschlossene historische Erzählung integriert. Was Bechers Buch bietet, ist ein Ereignis- und Themenreferat auf dem Boden der Spezialforschung, in der der Autor bestens beschlagen ist.
Nachdem Chlodwig noch nach 1500 Jahren zum Jubelfest seiner Taufe ( 496?) von vielen Franzosen als Vater ihrer Nation gefeiert wurde, könne er im Zeichen der europäischen Einigung auch durch die Deutschen als historische Leitfigur entdeckt und anerkannt werden, argumentiert Becher. Ob aber sein nüchternes Buch dazu einen Betrag leisten kann?
MICHAEL BORGOLTE
Matthias Becher: "Chlodwig I." Der Aufstieg der Merowinger und das Ende der antiken Welt.
Verlag C. H. Beck. München 2011. 330 S., 17 Abb. und Karten, geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Verhalten äußert sich Rezensent und Professor für mittelalterliche Geschichte Michael Borgolte über Matthias Bechers Biografie des Frankenkönig Chlodwig I. (465 bis 511). Der war offenbar sogar für mittelalterliche Verhältnisse ein ausgemachter Schlächter, der reihenweise konkurrierende Könige und Verwandte umbrachte. Bechers Interpretation, die Klage des Königs über den Tod seiner Angehörigen - ganz allein stehe er jetzt da, ein 'Fremder unter Fremden' - sei ein Versöhnungsangebote an deren Gefolgsleute gewesen, kann Borgolte nicht so recht überzeugen. Zudem scheint ihm die Darstellung von einer großen Nüchternheit. Der Autor legt sein Bild des Frankenkönigs nach Ansicht des Rezensenten nirgendwo explizit dar, sondern beschränkt sich darauf, chronologisch die Sachverhalte samt Vorgeschichte darzustellen. Quellen werden ausgiebig zitiert und kommentiert, zu Borgoltes Bedauern aber nicht in eine "geschlossene historische Erzählung" integriert. Das Buch ist für ihn letztlich ein "Ereignis- und Themenreferat auf dem Boden der Spezialforschung".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH