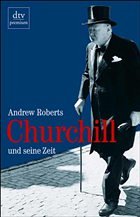Gelehrt, amüsant und bösartig. Ein sehr britisches Buch über einen sehr britischen Staatsmann und vor allem seine Feinde.
Vom belächelten Kriegstreiber zum Mitbezwinger Hitlers und Premierminister: Als Chamberlain 1938 mit Hitler das Münchener Abkommen schloss, galt Churchill, damals bereits 64 Jahre alt, als Abenteurer, der politisch gescheitert war. Zwei Jahre später war er der Retter der Nation und verkörperte den Widerstand Großbritanniens gegen die Nazis. Von 1940 bis 1955 hat er Englands Konservative und zudem neun Jahre lang das Land geführt. Doch in seiner Ära verloren die Briten endgültig den Großmachtstatus. Wie von der Cheshire-Katze blieb nur ein breites Grinsen. Was in dieser Zeit passiert ist, will Andrew Roberts anhand prägnanter Personenporträts festhalten und kommt dabei zu provozierenden Erkenntnissen. Heldenverehrung ist nicht sein Anliegen.
Vom belächelten Kriegstreiber zum Mitbezwinger Hitlers und Premierminister: Als Chamberlain 1938 mit Hitler das Münchener Abkommen schloss, galt Churchill, damals bereits 64 Jahre alt, als Abenteurer, der politisch gescheitert war. Zwei Jahre später war er der Retter der Nation und verkörperte den Widerstand Großbritanniens gegen die Nazis. Von 1940 bis 1955 hat er Englands Konservative und zudem neun Jahre lang das Land geführt. Doch in seiner Ära verloren die Briten endgültig den Großmachtstatus. Wie von der Cheshire-Katze blieb nur ein breites Grinsen. Was in dieser Zeit passiert ist, will Andrew Roberts anhand prägnanter Personenporträts festhalten und kommt dabei zu provozierenden Erkenntnissen. Heldenverehrung ist nicht sein Anliegen.

Das britische Empire ging an zuviel Charme zugrunde / Churchill im Spiegel der Churchillianer
Andrew Roberts: Churchill und seine Zeit. Aus dem Englischen von Friedrich Griese. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1998. 478 Seiten, Abbildungen, 36,- Mark.
Mit einem charmanten Lächeln übergab Lord Mountbatten 1947 die Macht in Indien und die Verantwortung für fast 600 000 Tote im Pandschab an eine Verfassunggebende Versammlung. Ein Jahr später ging die Ära der "Churchillianer" auf dem Subkontinent endgültig zu Ende.
Fünfzehn Jahre lang, von 1940 bis 1955, hat Winston Churchill die Geschichte Britanniens bestimmt. Mehr als die Hälfte der Zeit war er Premierminister. Eine Ära, die Andrew Roberts neu interpretiert. Nach dem Vorbild Lytton Stacheys ("Eminent Victorians") schreibt er über die "Eminent Churchillians". Sie waren keine Anhänger des britischen Premierministers, sondern "repräsentativ für die britische Öffentlichkeit in der Churchill-Ära". Ihre Handlungen und Reaktionen zeigen einen neuen Churchill: Was der Premierminister zugelassen, wen er geschützt und, bewußt wie unbeabsichtigt, protegiert hat, fällt auf ihn selbst zurück.
Zu den Churchillianern zählen König Georg VI., Lord Louis Mountbatten, Walter Monckton, Arthur Bryant, die "Hinterbänkler" der Konservativen Partei. Allesamt Menschen, die "sich an die politische Realität der Churchillschen Vorherrschaft anpaßten, aber im Grunde nie auf der Höhe der Ereignisse waren" und die bis heute ein historischer Mythos umgibt.
Georg VI. folgte seinem abgedankten Vorgänger Edward VIII. auf dem Thron nach. Er war kein politisches Genie und wußte darum. Er war kein großer Redner, aber er intrigierte. Der König spielte Minister gegeneinander aus und sorgte ab und an für ihre Entlassung. Königlicher Wille stand über demokratischen Spielregeln. Der Monarch sympathisierte mit Chamberlain, dem Premierminister des Münchener Abkommens - weit mehr, als die übliche Unparteilichkeit des Königs zulassen sollte. Doch Chamberlain stürzte in der Norwegen-Debatte, als das Unterhaus über die britische Niederlage gegen die Wehrmacht in Skandinavien diskutierte.
Churchill wurde Premierminister. Der König akzeptierte den neuen Regierungschef nur, weil sein Kandidat Lord Halifax nicht zur Verfügung stand. Die politischen Zustände im Europa der dreißiger Jahre und das Vorgehen der Diktatoren waren dem Monarchen fremd. Die Kriegserklärung Italiens verwirrte ihn: "Mussolini nannte keinen Grund." Provokant urteilt Roberts: "Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, daß der König über irgend etwas nachgedacht hat."
Lord Mountbatten scheiterte als Offizier und machte dennoch eine beispiellose militärische Karriere. Überhastet führte er als Kapitän sein Schiff zu Kriegsbeginn in die Schlacht und fast in den Untergang. Später kosteten seine militärischen Abenteuer Menschenleben. Das Landungsunternehmen in Dieppe plante der Lord so unzureichend, daß 3369 junge Kanadier innerhalb von neun Stunden von der gut vorbereiteten deutschen Truppe getötet oder gefangengenommen wurden. Dennoch ernannte Churchill Mountbatten zum Oberkommandierenden der alliierten Streitkräfte in Südostasien. Nach dem Krieg wurde er indischer Vizekönig und bestand darauf, daß Indien bereits 1947 in die Unabhängigkeit entlassen wurde. Eine geordnete Übergabe der Macht an die künftigen Herrscher in Indien und Pakistan war in 18 Monaten nicht möglich. Im Pandschab kam es wegen der Teilung der Provinz zum Völkermord. Sikhs und Inder jagten Muslime, Pakistanis trieben Hindus über die Grenze nach Osten.
Was Mountbatten zu seinen übereilten Handlungen brachte, nennt Roberts den "Überschuß an Adrenalin" und die vom Lord zelebrierte "Doktrin der Unfehlbarkeit". Zu einem Biographen sagte Mountbatten: "Es ist merkwürdig, aber wahr, daß ich mit allem, was ich in meinem Leben getan und gesagt habe, recht hatte." Churchill bremste Mountbatten nicht. Erst, als der Lord 1948 aus Indien nach Britannien zurückkehrte, empfing der Premierminister ihn nicht mehr. Dennoch wurde Mountbatten Erster Seelord und Chef des Verteidigungsstabs. 1979 tötete ihn eine Bombe der IRA.
Walter Monckton war ein Charmeur. Er hing keiner politischen Richtung an. "In Wahrheit verkörperte er die Maxime von John Maynard Keynes, daß praktische Männer, die glauben, völlig frei von irgendwelchen intellektuellen Einflüssen zu sein, gewöhnlich die sklavischen Anhänger eines verstorbenen Ökonomen sind." Monckton selbst hing Keynes an.
Konfrontation war nicht die Sache Moncktons. Als Arbeitsminister in den fünfziger Jahren gab er im Streitfall den Gewerkschaften so weit nach, daß das britische Lohngefüge bis in die achtziger Jahre aus dem Lot geriet. Er entwickelte die Idee der "Vergleichbarkeit". Vergleichbare Arbeit sollte gleich bezahlt werden - eine kaum leistbare Aufgabe in einer stark diversifizierten Gesellschaft. Was die Nation im Krieg zusammenhielt, führte sie in Churchills zweiter Amtszeit fast in den Ruin. Erst Margaret Thatcher begrenzte die Macht der Gewerkschaften, die Monckton unfreiwillig aufgebaut hatte.
Arthur Bryant war Historiker, Patriot, "Nazi-Sympathisant und Faschismus-Mitläufer". Aus antidemokratischer Gesinnung engagierte er sich für das Münchener Abkommen. Bryant verkörperte die Sorte Historiker, "die von der Macht so fasziniert sind, daß sie zwischen denen, die sie ausüben, nicht mehr objektiv zu unterscheiden vermögen". Erst als die Diktatoren unterlagen, verlor Bryant seinen Glauben an sie.
Trotz dieser Einstellung wurde Bryant von allen wichtigen Politikern hochgeschätzt. Churchill hielt ihn für einen der bedeutendsten Historiker Britanniens. Denn die Bücher, die Bryant schrieb, sind nicht gut, aber sie wirken so. Daß der Historiker mit seiner Hinwendung zu Deutschland und privaten Diplomatieversuchen Churchill im Jahr 1940, als Britannien kurz vor der Niederlage stand, in den Rücken fiel, war nach dem Krieg schnell vergessen.
Die Konservative Partei war die Regierungspartei Churchills und Hort der größten Kritik an dem Staatsmann. In den ersten Monaten führten die Torys einen "Guerrillakrieg" gegen Churchill. Das zu beweisen fällt Roberts trotz großen Bemühens schwer, denn "alte Männer vergessen, doch alte Politiker vergessen selektiv". Aus Bruchstücken privater und öffentlicher Quellen setzte er ein neues Bild der Jahre 1940 und 1941 zusammen.
Chamberlain wurde aus dem Amt getrieben - mehr aus politischem Ungeschick vieler Tory-Abgeordneter als aus Abneigung gegen den Premierminister. Churchill wurde Premierminister einer Koalitionsregierung, in der die Torys die Mehrheit hatten. Aber diese Fraktion setzte sich vor allem aus Chamberlain-Anhängern zusammen, die auch nach dessen Rücktritt nicht vom neuen Regierungschef überzeugt waren. Mehr als ein halbes Jahr lang konnte Churchill sich der Unterstützung der Labour Party sicherer sein als der seiner eigenen Partei. Auch nach der Rettung des britischen Expeditionsheeres aus Dünkirchen blieben viele Tory-Hinterbänkler skeptisch. Als Churchill durch geschickte Kabinettsumbildungen einige Vertreter der Appeasementpolitik, unter anderen Außenminister Halifax, aus dem Regierungsapparat entfernte, erreichte das Mißtrauen seinen Höhepunkt - und band die Kräfte der Regierung. Erst 1941 gewann Churchill die Oberhand. Am 20. Juli bildete er sein Kabinett erneut um, diesmal ohne jede Rücksicht auf das Chamberlain-treue konservative Establishment.
Zwei Dinge waren allen Churchillianern gemeinsam: Charme und die Idee des Commonwealth. Der Charme seiner Diplomaten und Politiker sollte den britischen Staat erhalten. Aber Charme unterdrückt die notwendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. "Die britische Macht schwand allmählich dahin und hinterließ, wie die Cheshire-Katze, nur ein breites Grinsen." Die Idee des Commonwealth enthielt die psychologische Botschaft, daß Britannien noch immer eine Großmacht war, auch nachdem es längst aufgehört hatte, eine zu sein. Die Idee, nationale Erneuerung könne nach den Kriegsjahren nötig sein, verschwand dahinter.
Roberts schreibt keine Biographie. Er entwirft ein Milieubild der britischen Gesellschaft der Kriegs- und Nachkriegszeit: originell, provokant, auf den Effekt hin berechnet.
KARSTEN POLKE-MAJEWSKI
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main