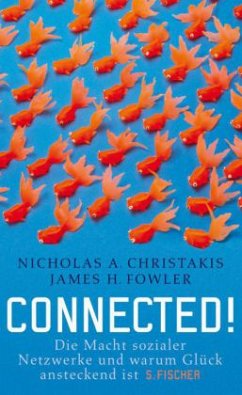Dieses Buch kann Ihr Leben verändern -- wenn es jemand liest, den Sie nicht kennen.
Ihre politische Einstellung, Ihre Partnerschaft, Ihr Leibesumfang - Sie glauben, das alles bestimmen Sie selbst? Weit gefehlt! Es sind Menschen, die Sie oft nicht mal persönlich kennen - die Freunde eines Freundes eines Freundes -, die Ihr Leben bis ins kleinste Detail maßgeblich beeinflussen.
Die international renommierten Wissenschaftler Nicholas A. Christakis und James H. Fowler haben soziale Netzwerke erforscht und zeigen, wie diese unmerklich auf unser Verhalten abfärben. Für ihre Forschungen erschlossen sie die bislang größte Menge an persönlichen Daten, u.a. aus Facebook-Profilen und der Erfassung und Langzeitstudie einer gesamten Kleinstadt. Die Auswertung zeigt: Verhaltensmuster und Gefühle der Menschen sind wie ein Fischschwarm. Nicht ein einzelner Fisch entscheidet, wohin es geht, sondern der Schwarm trifft die Entscheidung.
Auf verblüffende, provokante und unterhaltsame Weise zeigen Christakis und Fowler wie groß die Macht sozialer Ansteckung ist.
Ihre politische Einstellung, Ihre Partnerschaft, Ihr Leibesumfang - Sie glauben, das alles bestimmen Sie selbst? Weit gefehlt! Es sind Menschen, die Sie oft nicht mal persönlich kennen - die Freunde eines Freundes eines Freundes -, die Ihr Leben bis ins kleinste Detail maßgeblich beeinflussen.
Die international renommierten Wissenschaftler Nicholas A. Christakis und James H. Fowler haben soziale Netzwerke erforscht und zeigen, wie diese unmerklich auf unser Verhalten abfärben. Für ihre Forschungen erschlossen sie die bislang größte Menge an persönlichen Daten, u.a. aus Facebook-Profilen und der Erfassung und Langzeitstudie einer gesamten Kleinstadt. Die Auswertung zeigt: Verhaltensmuster und Gefühle der Menschen sind wie ein Fischschwarm. Nicht ein einzelner Fisch entscheidet, wohin es geht, sondern der Schwarm trifft die Entscheidung.
Auf verblüffende, provokante und unterhaltsame Weise zeigen Christakis und Fowler wie groß die Macht sozialer Ansteckung ist.

Alles, was wir tun, beeinflusst die Freunde der Freunde unserer Freunde. Und was diese tun, beeinflusst uns. Nicholas Christakis und James Fowler über soziale Ansteckung.
Nicht nur Lachen und Gähnen sind ansteckend, auch Glück und Unglück, Schwangerschaften, Kopf- und Rückenschmerzen, Müdigkeit, Juckreiz, Übergewicht und sogar Selbstmord. Allerdings verbreiten sich diese Infektionen nicht über Viren und Bakterien, sondern über soziale Netzwerke. Der Mediziner und Soziologe Nicholas Christakis und der Politikwissenschaftler James Fowler analysieren, wie soziale Netzwerke entstehen und funktionieren. Damit sind sie einem ebenso zentralen wie vernachlässigten Faktor für die Erklärung menschlichen Verhaltens auf der Spur. Denn der Mensch ist weder des eigenen Glückes Schmied, so die Autoren, noch ist er bloßes Objekt gesellschaftlicher Kräfte, er ist vor allem Teil sozialer Netzwerke.
Jeder Mensch kennt etwa 150 Personen, die wiederum 150 Personen kennen und so fort. Um durchschnittlich sechs Ecken sind wir so mit allen Menschen der Welt bekannt. Die Wirkung sozialer Netze verebbt allerdings hinter der dritten Ecke, haben die Autoren herausgefunden. Alles, was wir tun, beeinflusst also unsere Freunde, die Freunde unserer Freunde und die Freunde der Freunde unserer Freunde. Und was diese tun, beeinflusst uns. Das bedeutet, dass unser Verhalten auf Menschen einwirkt und von Menschen beeinflusst wird, die wir gar nicht kennen und denen wir vielleicht niemals begegnen werden. Netzwerkforscher können dies sogar messen: Ist ein Bekannter einsam, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir selbst einsam sind, um 52 Prozent, ist der Bekannte eines Bekannten einsam, erhöht sie sich um 25 Prozent, um drei Ecken liegt sie noch bei 15 Prozent.
Mit dem Glück verhält es sich ähnlich. Für ihre "Glücksstudie" sammelten die Autoren Daten über die familiären und partnerschaftlichen Beziehungen und das Glücksempfinden von mehr als zwölftausend Einwohnern eines amerikanischen Ortes und rekonstruierten damit das "soziale Glücksnetzwerk" von 1020 Personen. Sie stellten fest, dass glückliche und unglückliche Menschen nicht gleichmäßig verteilt, sondern in Gruppen vorkommen und sich die unglücklichen eher am Rand des Netzwerks befinden. Die Erklärung: Glück überträgt sich durch das soziale Netz. Ist der Freund eines Freundes glücklich, macht uns das immer noch zehn Prozent glücklicher, das Glück des Freundes des Freundes des Freundes hebt unsere Stimmung um sechs Prozent. Das Glück eines vollkommen Fremden kann damit mehr Einfluss auf uns haben als ein zusätzliches Jahreseinkommen von zehntausend Dollar, das den Autoren zufolge nur um zwei Prozent glücklicher macht.
Zu den wichtigsten Verbreitungsmechanismen in sozialen Netzen zählen Gefühlsansteckung und Nachahmung. "Wenn die Menschen tun können, was sie wollen, ahmen sie einander in der Regel gegenseitig nach", zitieren die Autoren den Sozialkritiker Eric Hoffer. Dies kann extreme Formen annehmen: Am 30. Januar 1962 brachen drei Schülerinnen eines christlichen Mädcheninternats in Bukoba, Tansania, in unkontrollierte Lachanfälle aus. Mitte März musste die Schule geschlossen werden, weil fast drei Viertel der Schülerinnen ähnliche Symptome zeigten. Mit den Schülerinnen verbreiteten sich die Lachanfälle in die umliegenden Dörfer, nach einigen Monaten versickerte die Epidemie, glücklicherweise ohne Todesfälle, wie die staatliche Gesundheitsbehörde feststellte. Eine körperliche Ursache für die Lachkrankheit wurde nie gefunden. Sie gilt, wie die Tanzwut im Europa des Pestzeitalters, als "psychogene Massenerkrankung".
Oft sind die Übertragungswege subtiler, etwa beim Übergewicht: Die Mode-Models mögen dünner sein denn je, faktisch messen wir uns an unseren Freunden. Und wenn Heather zunimmt, weil sie keinen Sport mehr treibt, und das ihre Freundin Maria zu der Einsicht bringt, dass dick sein gar nicht so schlimm ist, sie deshalb ihre andere Freundin Amy nicht drängt, mit dem Joggen weiterzumachen, und in der Folge diese auch dick wird, hat die Gewichtszunahme von Heather das Gewicht von Amy beeinflusst, ohne dass die beiden auch nur voneinander wussten.
Über soziale Netzwerke, so die Autoren, können wir den Herzschlag der Gesellschaft wahrnehmen und darauf reagieren. Und indem die Netzwerkforschung ihre Gesetzmäßigkeiten sichtbar und nachvollziehbar werden lässt, macht sie soziale Prozesse verständlicher. Bei einer Wahl sind theoretisch alle Stimmen gleich viel wert. Das stimmt, wenn der Zettel erst in der Urne liegt. Doch niemand wählt für sich allein. Die Autoren konnten nachweisen, dass eine Person je nach ihrer Position im sozialen Netzwerk bis zu hundert andere an die Wahlurne holt. Und da Anhänger einer Partei zu Grüppchenbildung neigen, bedeutet dies in der Regel einen deutlichen Stimmengewinn für eine Partei.
Netzwerkforscher simulieren, wie es kleinen gut vernetzten Gruppen immer wieder gelingen kann, ihre Meinung durchzusetzen. Sie weisen nach, dass die Position im sozialen Netzwerk für die Lebenschancen einer Person wichtiger ist als Ethnie, Klasse, Geschlecht oder Bildung. Aus diesen Erkenntnissen leiten sie auch konkrete Vorschläge ab: Armut ließe sich demnach effizienter bekämpfen, wenn man Menschen dabei unterstützte, soziale Netze zu knüpfen oder auszubauen, als durch finanzielle Zuwendungen. Gesundheitsprogramme müssten auf soziale Bindungen und Gruppensolidarität bauen. Idealerweise würde ein soziales Netzwerk erst kartografiert, seine Zentren identifiziert und die Gesundheitskampagnen dann gezielt auf diese Zentren ausgerichtet. Doch es geht sogar ohne Kartografie: Würde man nur jeweils die Bekannten von willkürlich ausgewählten Personen impfen, könnte man der Theorie zufolge durch das Impfen von nur 30 Prozent denselben Impfschutz erreichen wie durch die konventionelle Massenimpfung von 99 Prozent der Bevölkerung. Denn die Personen im Zentrum eines Netzwerks werden von vielen Menschen als Bekannte angegeben und sind so zuverlässig zu identifizieren.
Menschen, so zeigen die Autoren, sind für soziale Netzwerke gemacht, dafür sprechen ihre Evolutionsgeschichte, ihre Gene, die Struktur ihres Gehirns, ihr auffallendes Interesse an Fernsehshows, in denen Gruppeneffekte eine zentrale Rolle spielen, und ihr ständiges Geschwätz über nichts und wieder nichts, das sich eher als weiterentwickelte Form des Lausens denn als Informationsaustausch verstehen lasse.
Die Funktionsweise sozialer Netzwerke zu verstehen ist für die Selbsterkenntnis des homo dictyos, des Netzmenschen, so wichtig wie für das Verständnis der Gesellschaft. Dass die vernetzte Menschheit als "Überorganismus" ein völlig neu dimensioniertes Selbstbewusstsein entwickele, dürfte dennoch etwas übertrieben sein. Wir glauben uns am Ruder eines Schiffes auf stürmischer See, so die Autoren, doch faktisch sind wir mit bewährten Instrumenten auf ausgefahrenen Routen unterwegs. Kein Wunder, wenn der Leser bei der Lektüre häufig an einen Ameisenstaat denken muss.
MANUELA LENZEN
Nicholas A. Christakis, James H. Fowler: "Connected!" Die Macht sozialer Netzwerke und warum Glück ansteckend ist. Aus dem Amerikanischen von Jürgen Neubauer. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2010. 440 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Dass sich der sozial gut vernetzte Mensch gleich ein ganz neues Selbstbewusstsein aneignet, wie es Nicholas A. Christakis und James H. Fowler in ihrem Buch nahelegen, möchte Manuela Lenzen nicht für bare Münze nehmen. Über die Entstehungs- und Funktionsweisen sozialer Netzwerke und deren Einfluss auf menschliche Verhaltensweisen und Gesellschaft lässt sich Lenzen allerdings gern belehren. Staunenswert findet sie: Wie unser Verhalten von Menschen beeinflusst wird, die wir gar nicht kennen, etwa in einem von den Autoren rekonstruierten Glücksnetzwerk von 1020 Personen. Für Lenzen werden nicht nur soziale Prozesse verständlicher. Sie erkennt auch, wie wichtig soziale Netzwerke für die (Über)lebenschancen eines Menschen sind, wichtiger als Ethnie, Klasse, Geschlecht oder Bildung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH