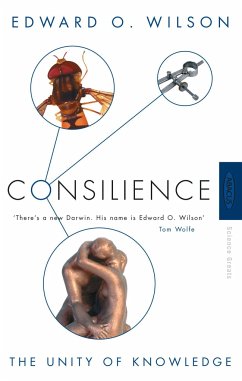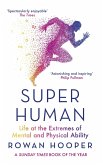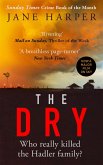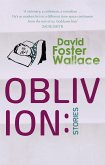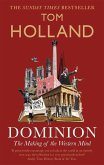Edward O. Wilson schwingt das Schwert der Naturwissenschaft und mäht alles nieder / Von Helmut Mayer
Glaubensbekenntnisse sind keine Argumente. Werden sie trotzdem dafür gehalten, läuft es in gravierenden Fällen darauf hinaus, daß ernstzunehmende Argumente und Thesen gar nicht erst zustande kommen. Ein solcher Fall ist Edward O. Wilsons Buch über "Die Einheit des Wissens". Wilsons Credo lautet, daß "alle greifbaren Phänomene, von der Sternengeburt bis hin zu den Funktionsweisen von gesellschaftlichen Institutionen, auf materiellen Prozessen basieren, die letzten Endes auf physikalische Gesetze reduzierbar sind, ganz egal, wie umständlich oder lang ihre Sequenzen sind". Die physikalischen Gesetze, an die Wilson denkt, sind solche der fundamentalen Art: Zuletzt wird sich alles auf diese "eigentlichen" Gesetze zurückführen lassen, auf das Vokabular einer grundlegenden Physik.
Das funktioniert bekanntlich nicht, weder in den Naturwissenschaften selbst noch in den Geisteswissenschaften: Wer etwa die Plattentektonik aus der Quantenelektrodynamik gewinnen möchte, wird sich ebenso schwertun wie derjenige, der sich bemüht, die Eigenart der Sonnette von Shakespeare aus den Befunden der Hirnforschung abzuleiten, die ihrerseits nicht in der Sprache der physikalischen Standardtheorie formuliert sind. Das weiß Wilson zwar, aber es hält ihn nicht davon ab, diesen Reduktionismus als das Telos der Entwicklung in den Wissenschaften zu postulieren - unbeeindruckt auch davon, daß gelingende vertikale Reduktionen auf eine tieferliegende Theoriestufe in der Wissenschaft ziemlich seltene Ausnahmen sind und nicht die Regel, die vielmehr in horizontalen Verknüpfungen besteht.
Nun kann man mit solchen kruden Formen von Reduktionismus leben, solange sie Hintergrundüberzeugungen von wissenschaftlichen Praktikern bleiben, die sich ansonsten halbwegs an die Standards ihres Metiers halten. Schiefe Verallgemeinerungen von handlichen Berufsideologien gibt es häufig, und die Stabilität der Institution Wissenschaft kommt gerade darin zum Ausdruck, daß es auf sie glücklicherweise nicht ankommt. Doch bei Wilson wird diese Berufsideologie, die man getrost beiseite lassen könnte, zur Hauptsache.
Sie wird es deshalb, weil Wilson sein physikalistisches Credo als Argument dafür ins Feld führt, daß alle wissenschaftlichen Disziplinen auf einen einzigen Erklärungsansatz zusammenschnurren sollen. Und das geht so: Weil doch offensichtlich alle Gegenstände Teile eines einzigen, lückenlosen kausalen Zusammenhangs sind, müssen wir nur diesen kausalen Zusammenhängen folgen, um endlich die "Einheit des Wissens" herzustellen. Anthropologie, Psychologie und Biologie befassen sich zum Beispiel unter verschiedenen Perspektiven mit menschlichem Verhalten. Da aber nun einmal klar ist, daß es "eigentlich" um ein kausales Kontinuum geht, in dem alle komplexen Phänomene letztlich auf elementare Ursachen zurückgeführt werden können, sind diese verschiedenen Perspektiven letztlich auch nur Facetten einer einzigen "harmonisierten" Erkenntnis.
Die Prämisse lautet also: Alle Gegenstände und Phänomene, aber nun wirklich alle, lassen sich über kausal vermittelte Zwischenstufen von zunehmender Komplexität von einem elementaren Gegenstandsbereich und seinen Gesetzen aus einsichtig machen; die Beschreibungen von Handlungen ebenso wie Prozesse der Vergesellschaftung oder die Entwicklung von Kunstgattungen. Das ist nun keine irgendwie testbare oder auch nur einlösbare Hypothese, sondern eine metaphysische Behauptung der denkbar grandiosen Art. Dazu läßt sich immerhin eines sagen: Nichts in unserer wissenschaftlichen und alltäglichen Weltbewältigung spricht dafür. Daß die Hypothese bisher durch keinen einzigen Beweis widerlegt ist, worauf Wilson allen Ernstes triumphierend hinweist, ist dagegen trivial.
Doch selbst wenn man diese Prämisse akzeptierte, folgt daraus noch lange nicht, daß wir verpflichtet oder auch nur prinzipiell in der Lage wären, die Perspektive dieses postulierten elementaren Erklärungsansatzes einzunehmen. Bündiger ausgedrückt: Aus der großzügigen ontologischen Behauptung folgt mitnichten die epistemische These von der "Einheit des Wissens". Daß dies zwei Paar Schuhe sind, entgeht Wilson vollkommen: Munter vermengt er die theoretische "Vernetzung" von wissenschaftlichen Erklärungen mit der "Herstellung" eines "nahtlosen Gewebes aus Ursache und Wirkung".
So eine tiefliegende Verwirrung macht Wilsons Begriff der "Vernetzung" - im Original steht das auch im Englischen eher selten verwendete "consilience" - von wissenschaftlichen Disziplinen wertlos: Wie verschiedene wissenschaftliche Theorien und ihre entsprechende Vokabulare tatsächlich Übergangsregeln etablieren und einander zuarbeiten können, kommt nicht in den Blick. Das verwundert nicht, denn von symmetrischen Beziehungen ist bei Wilson natürlich ohnehin nicht die Rede. Das angebliche "Durchqueren" der verschiedenen Disziplinen - notabene am Leitfaden von Kausalbeziehungen - ist nur rhetorische Fassade vor der dahinterstehenden Behauptung, daß die zentrale Disziplin ohnehin schon gefunden sei, die uns die Einheit des Wissens beschert.
Wilson ist Biologe, deshalb muß man nicht lange raten, welche Disziplin er im Auge hat. Einmal abgesehen von der heiklen Frage, wie es um das Verhältnis von Biologie und Physik steht: Warum ist die Biologe zentral für die anvisierte Einheit des Wissens? Ganz einfach, weil wir Produkte der Evolution sind und mit unserem Gehirn denken. Woraus sich ergibt, daß eine vollständige Theorie der neuronalen Prozesse in unserem Gehirn die letzten Aufschlüsse über alle geistigen Produkte an die Hand geben wird. Wir müssen dann nur hinschauen, um zu sehen, warum wir welche Theorien entwerfen, was wir warum als Kunst schätzen, für einen logisch richtigen Schuß erachten und so weiter.
Leider sind wir zwar noch nicht soweit, aber mit ein bißchen Optimismus dürfen wir doch in nächster Zukunft damit rechnen, daß sich uns durch die vollständige Kenntnis der materiellen Basis unseres Denkens am "Kreuzweg von Natur- und Geisteswissenschaft" alles entschlüsseln wird. Einstweilen müssen wir uns allerdings noch mit dem zufriedengeben, was Wilson so alles an vielversprechenden Antizipationen dieser Begegnung am Kreuzweg aus Darstellungen von Kollegen exzerpiert hat, um es zu "vernetzen".
Die rhetorische Grundstruktur seiner Ausführungen ist dabei leicht zu erkennen: Von relativ bescheidenen, oft soliden oder manchmal selbst schon etwas verworrenen Überlegungen zur naturalen Basis unseres Verhaltens reißt ihn seine szientistische Naherwartung gleich zu Generalisierungen der gröbsten Art hin. Da wird zum Beispiel aus den schätzenswert ernüchternden und notwendigen Einsichten in unseren animalischen Unterbau sofort die Empfehlung einer Definition des Moralempfindens durch "die Analyse der neuralen und endokrinen Reaktionen" und der Suche nach den "präskriptiven Genen", welche es bestimmen. Und zuletzt ist ohnehin immer das "psychobiologische Verständnis des Denkprozesses" der versprochene Stein der Weisen. Daß rationale und normative Begründungen von anderer Natur sind als der Verweis auf ein Genötigtsein durch vermeintliche Naturtatsachen, ist Wilson keinen Gedanken wert. Vermutlich fällt das für ihn unter die Selbsttäuschungen des Naturwesens Mensch, die wissenschaftlich zu entlarven sind.
Wenn Wilson wenigstens ein geschliffen argumentierender Naturalist wäre, dann könnte man über seine Prognosen immerhin streiten. Aber dazu reicht die begriffliche Disziplin bei ihm nicht hin, auch wenn er sich auf "das Schwert der Naturwissenschaft" beruft. Seine Ausführungen über die "epigenetischen Regeln" menschlichen Verhaltens, die für den "kollektiven Einfluß von Erbmaterial und Umwelt" stehen, kann man stellenweise geradezu als Strategie kalkulierter Unschärfe lesen: Immer dann, wenn der Verdacht des genetischen Determinismus allzu aufdringlich wird, gestattet Wilson sich den salvierenden Verweis auf die "massiven Einwirkungen kultureller Entwicklungen".
Im allgemeinen ist die Unschärfe aber alles andere als kalkuliert. Sie entspricht vielmehr dem Gestus des "ehrlichen Maklers" zwischen den verschiedenen Ansätzen und Disziplinen, als den Wilson sich sieht. Ein Makler, der sich mit Begründungen für die Zurückweisung opponierender Ansichten nicht lange aufhält. Freud zum Beispiel schärfte zwar "die allgemeine Aufmerksamkeit für die versteckten irrationalen Prozesse im Gehirn", lag aber ansonsten einfach ganz daneben. Kants Konzept der praktischen Vernunft ist verwirrend, aber nicht "weil es so tiefgründig ist, sondern einfach, weil es falsch ist. Denn wie wir heute wissen, stimmt seine Aussage nicht mit den Nachweisen über die Funktionsweisen des Gehirns überein". Das klingt zwar infam, ist aber nur borniert.
Von solcher Borniertheit legt Wilson in seinem Buch reichlich Zeugnis ab. Eigentlich reicht es schon zu sehen, was er aus seinen Abstechern in andere Disziplinen und Bereiche so alles mitbringt, um die richtige Vorstellung von diesem "Makler" zu bekommen. Halten wir uns gar nicht erst lange damit auf, daß er bei seiner Suche nach Vorläufern seines Einheitsideals nebenbei Rousseau die Losung "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" unterstellt und die deutschen Romantiker "unter der Führung von Goethe, Hegel, Herder und Schelling" antreten läßt. Abschreibefehler können schließlich jedem unterlaufen.
Interessanter ist schon die Bestimmung des Dekonstruktivismus als Technik der Literaturinterpretation, "die davon ausgeht, daß die Absichten eines Autors ausschließlich für ihn erkennbar sind". Dafür bekommt man allerdings eine runde Definition von Kunst, von der die Dekonstruktivisten nur träumen können: Sie ist nämlich "das Mittel, durch das Menschen mit vergleichbaren Wahrnehmungsvermögen einander Gefühle vermitteln". Nebenbei bringt sie übrigens auch noch "Ordnung und Sinn in das Chaos des Alltags".
Die deutsche Fassung tut dann noch das Ihrige hinzu, um Wilsons ungeschickten Resümees zusätzliche Glanzlichter aufzusetzen. Wenn er etwa die emphatische Schlußwendung des Manifests des Wiener Kreises zitiert, liest sich das so: "Das wissenschaftliche Verständnis von Realität dient dem Leben und wird seinerseits vom Leben bedient." Womit dem Leser nicht gut gedient ist, denn der Satz lautet: "Die wissenschaftliche Weltauffassung dient dem Leben, und das Leben nimmt sie auf." Angesichts dessen, was Wilson zum Logischen Positivismus einfällt - er funktionierte nicht, weil seine Vertreter "keine Ahnung von den Funktionsweisen des Gehirns hatten" -, verschlägt das allerdings auch nichts mehr.
Wilson mag es mit seinem Buch gut gemeint haben. Nur reicht das leider genausowenig wie die Gefühle in der Kunst. So hat er jenen Wissenschaftlern, die sich mit mehr Umsicht, begrifflicher Klarheit und Takt um Verbindungen zwischen Geistes- und Naturwissenschaft bemühen, einen wahren Bärendienst erwiesen. Als akzeptable wissenschaftliche Sühne für seine missonarisch-visionären Verirrungen bleibt ihm eigentlich nur, sein nächstes Buch wieder den Ameisen zu widmen. Bei ihnen kennt er sich nämlich wirklich aus.
Edward O. Wilson: "Die Einheit des Wissens". Aus dem Amerikanischen von Yvonne Badal. Siedler Verlag, Berlin 1998. 442 S., geb., 49,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main