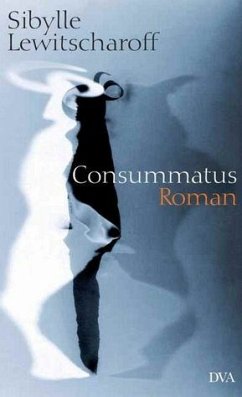Stuttgart, April 2004. Ralph Zimmermann sitzt im Café Rösler, leert zu viele Gläser Wodka, während Stationen seines Lebens Revue passieren - Tod der Eltern, Kindheit, vor allem die fatale Liebe zu einer Underground-Sängerin, mit der er bis zu ihrem Tod einige Monate lang durch Europa kreuzte. Die Sehnsucht hatte den Mann ins Jenseits geführt. Mit der Pflicht, Bericht zu erstatten, wurde er von dort zurückgeschickt. Seitdem sind die Toten um ihn, seitdem muß er daran herumrätseln, was sich im Jenseits gezeigt hat: kluge Tiere, zaghafte Tote, die eine Schleuse meiden, hinter der man Jesus lachen hört. Selbst im Café halten sich die Toten in seiner Nähe auf. Andy Warhol, Jim Morrison und Edie Sedgwick sind mit von der Partie, die Eltern auch und natürlich seine Geliebte. Stunden später macht sich Zimmermann auf den Weg und gerät in ein Unwetter. Schnee hüllt ganz Stuttgart ein. In den Flocken treiben die Toten ihr zartestes Annäherungsspiel.

Orpheusle: Sibylle Lewitscharoffs schwäbische Jenseitsreise
Bei manchen passionierten "Tatort"-Zuschauern sorgt es für Mißmut, wenn er mehr über Täter und Opfer, Rätsel und falsche Fährten weiß als die ermittelnden Kommissare: Wenn die Hauptfiguren im dunkeln tappen, ist man der eigenen Gewißheiten nicht recht froh, selbst wenn gerade das für Spannung sorgt. Aus dem gleichen Grund ist das Beiseite-Sprechen auf dem Theater aus der Mode gekommen - der Zuschauer wird auch hier nicht gern zum Mitwisser, während die auf der Bühne so tun müssen, als hätten sie nichts gehört.
So ähnlich fühlt sich der Leser im neuen Roman von Sibylle Lewitscharoff: Das Rätsel, daß dem Leser hier aufgegeben wird, ist das Rätsel eines Lebens nach dem Tod. Doch leider liefert die Erzählung die Lösung gleich dazu, indem nicht nur die Lebenden, sondern auch die Toten zu Wort kommen. "Consummatus" ist der innere Monolog eines Kaffeehausbesuchers namens Ralph Zimmermann, eines Deutsch- und Geschichtslehrers, Mitte Fünfzig, der sich mit schwäbischer Regelmäßigkeit samstags in den Vollrausch trinkt und dabei immer wieder den Verlauf seines Lebens - und auch den seines eigenen Todes - heraufbeschwört. Wenige Jahre zuvor hatte er nämlich eine Nahtoderfahrung, bei der er der großen, fatalen Liebe seines Lebens, der bei einem Unfall ums Leben gekommenen Rocksängerin Joey, ins Jenseits folgte und ohne sie wieder in seinen drögen Paukeralltag zurückkehren mußte.
Diese pathetische Lebensbeichte und große Totenklage eines modernen, sozusagen umkehrten Orpheus (nicht er, sondern seine Eurydike sang zum Stein- und Beinerweichen) aber wird nun immer wieder unterbrochen durch die vorwitzigen, albernen, lebensweisen Kommentare einer regen und kregen Totengeisterschar, zu der neben der schon zu Lebzeiten fledermäusig-flatterhaften Joey auch deren Freunde und Bekannte wie Andy Warhol, der "Doors"-Sänger Jim Morrison und "Factory"-Star Edie Sedgwick gehören. Die Joey-Figur ist der 1988 verunglückten Underground-Ikone Nico nachempfunden (die ja in den letzten Jahren eine allerdings nur ideelle Renaissance erfuhr). Die nur vom Leser, nicht vom Erzähler wahrnehmbaren Promi-Stimmen aus dem Off des Lebens sind in blasserer Schrift abgesetzt, als sei dem Jenseits die Tinte ausgegangen.
Während Zimmermann bei Kaffee und mehr und mehr Wodka sein Leben Revue passieren läßt, wehmütig der knapp einjährigen wilden Zeit auf Tournee mit Joey gedenkt und sich grübelnd einen Reim auf das Jenseits zu machen versucht, fallen ihm die Geister ins Wort und benehmen sich wie Primaner auf Klassenfahrt. Es läßt sich schwerlich eine riskantere Konstruktion für ein Buch über dieses ja nicht gerade unbeackerte Feld finden. Doch Lewitscharoff, eine belesene und intelligente Autorin, wird von dem naheliegenden Einwand, mit der Totenrede verletzte man die erzählerische Glaubwürdigkeit, nicht getroffen werden. Denn die Literatur darf alles, auch Menschen als Käfer erwachen oder Tiere sprechen lassen. Natürlich darf sie auch Tote allerprominentesten Schlags daherquasseln lassen wie ein Damenkränzchen - wir sind schließlich im Café.
Die Grenzen zwischen Leben und Tod kann man literarisch nicht nur in der Vormoderne durchaus erfolgreich überschreiten. Im existentialistischen Geist hat das Thornton Wilder in "Unsere kleine Stadt" oder, daran anschließend, Max Frisch in seinem Nachkriegsbewältigungsdrama "Nun singen sie wieder" getan. Aktuelle Versuche unternahmen etwa der junge deutsche Autor Marcus Jensen in seinem Roman "Oberland" (2004) oder der Amerikaner Stewart O'Nan in "Halloween" (2003): Gerade dieser letzte Roman ist ein guter Vergleich, weil auch hier die Toten/Untoten ein plappernder, alberner Haufen waren - hier bei einem Autounfall verunglückte Jugendliche. Doch mit dem Kunstgriff, sie den Roman selbst erzählen zu lassen, legitimierte O'Nan eine allwissende Perspektive, die tiefe Reflexionen über Leben und Tod erlaubte.
Das ist also keine Frage der Lizenz. Sondern eine des Zwecks. Bei Lewitscharoff nun dienen die Geisterstimmmen dazu, vergleichbar den ironisch-besserwisserischen Fußnoten im letzten Ingo Schulze, die alkoholisch beflügelten philosophisch-theologischen Aufschwünge komisch zu brechen. So soll es wohl auch höhere Ironie sein, daß gerade die zur Legende verklärten Morrison oder Warhol im Jenseits aus reiner Langeweile ins Neckische regredieren: Was dem Leben des Deutschlehrers einst die Aura von Künstlertum und Freiheit gab, ist auf der anderen Seite auch nur ein sinnlos-lächerliches Ewigkeitstotschlagen. Die immer wieder beschworene Transzendenz der Kunst, der allgegenwärtigen Musik der "Doors" oder Dylans und der beschworenen sakral-mystischen Tradition moderner Literatur ist auch schon eine Vermischung von Weltlichem und Göttlichem. Die im Text immer wieder aufblitzende, aphoristisch glänzende Sprachkraft ist somit ein Abglanz der Erlösungshoffnungen, die die banale Realität des Jenseits längt dementiert hat: Zimmermann rätselt lange über seine Eindrücke von der Hadesfahrt: eine merkwürdige Schleuse, ein kichernder Jesus.
Am Ende des Romans mischt sich der göttliche Logos selbst in die Totenrede ein. Ob der betrunkene Zimmermann sein Delirium oder seine Erleuchtung erlebt, ist nicht mehr zu unterscheiden. Der Titel des Romans, der auf die letzten Worte Jesu am Kreuz ("Consummatum est", Es ist vollbracht), aber auch auf den Alkoholkonsum des Erzählers anspielt, bleibt in der Schwebe. Der Tod mag uns aus den Fesseln banaler Alltagsexistenz befreien, doch vielleicht warten "dort" nicht nur das Reich der Freiheit, sondern ganz neue quälende Fragen.
Sibylle Lewitscharoff: "Consummatus". Roman. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2006. 238 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Den Beschreibungen von Rezensent Richard Kämmerlings zufolge handelt es sich bei Sibylle Lewitscharoffs neuem Buch um eine komplexe und nicht ganz unanstrengende Lektüre. Trotzdem hat er das Buch offensichtlich mit Gewinn beiseite gelegt. Bei diesem "inneren Monolog" eines Deutsch- und Geschichtslehrers handelt es sich, wie Kämmerlings schreibt, um die "pathetische Lebensbeichte und große Totenklage" eines modernen Orpheus mit Nahtoderfahrung. Besonders beeindruckt Kämmerlings die Sprachkunst der Autorin. Formal riskant scheint jedoch deren Unternehmen zu sein, den Monolog immer wieder mit den Kommentaren einer munteren Runde Totengeister zu unterschneiden, die nur der Leser wahrnehmen könne und zu denen der Rezensent Freunde des Protagonisten ebenso und echte Promis vom Schlage Warhols oder Jim Morrisons zählen kann. Doch Lewitscharoff zeigt sich dem Rezensenten schließlich als zu belesene und intelligente Autorin, um aus diesen "albernen und lebensweisen" Einwürfen kein literarisches Kapital für ihr Buch zu schlagen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH