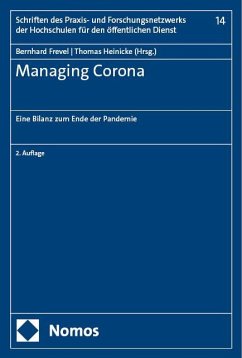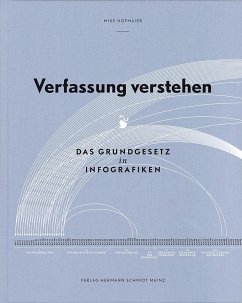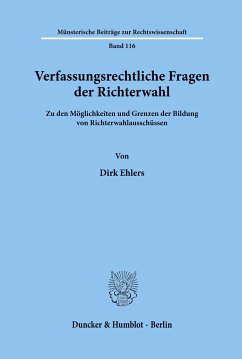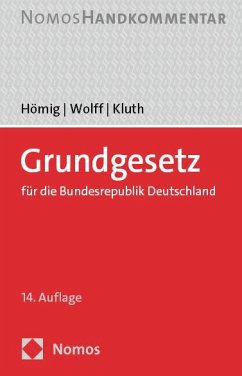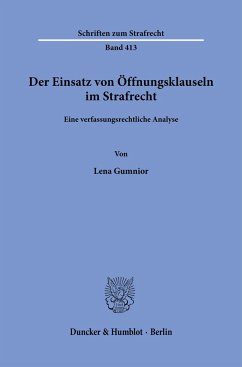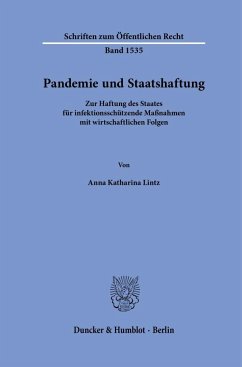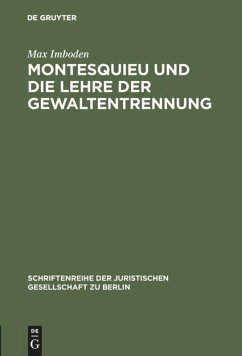Nicht lieferbar
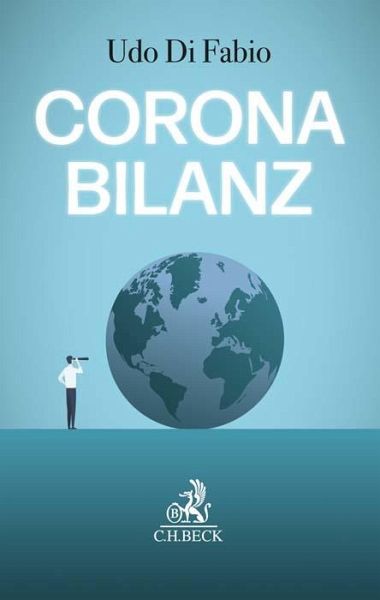
Coronabilanz
Lehrstunde der Demokratie
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Verschiebungen im Ordnungsgefüge des demokratischen Staates Ausgelöst durch die Corona-Krise und die gegen sie gerichteten staatlichen Maßnahmen stellen sich grundlegende Fragen, die nahezu alle Bereiche unserer Demokratie betreffen: Hat sich das Recht in der Krise bewährt oder versagt? Funktioniert das System der Gewaltenteilung und der Föderalismus eigentlich auch in der Krise, sind die Parlamente umgangen worden? Waren die Hilfsmaßnahmen zielführend und ausreichend? Und was war mit Recht und Moral bei der Frage der Zumutbarkeit? War die Grundentscheidung, zur Rettung von Menschenlebe...
Verschiebungen im Ordnungsgefüge des demokratischen Staates Ausgelöst durch die Corona-Krise und die gegen sie gerichteten staatlichen Maßnahmen stellen sich grundlegende Fragen, die nahezu alle Bereiche unserer Demokratie betreffen: Hat sich das Recht in der Krise bewährt oder versagt? Funktioniert das System der Gewaltenteilung und der Föderalismus eigentlich auch in der Krise, sind die Parlamente umgangen worden? Waren die Hilfsmaßnahmen zielführend und ausreichend? Und was war mit Recht und Moral bei der Frage der Zumutbarkeit? War die Grundentscheidung, zur Rettung von Menschenleben wichtige Teile einer Gesellschaft stillzustellen, Bildungsverluste und Vereinsamung in Kauf zu nehmen, in der Abwägung richtig oder wenigstens vertretbar? Wie ist die Rolle der Wissenschaft im demokratischen Regierungssystem? Vertieft sich während der Krise die Spaltung in der Gesellschaft oder entstehen Chancen für eine neue Solidarität? Wie verändern sich Einstellungen zur EU und zur Globalisierung? Steht in der Ferne China als neues Modell der staatlich gelenkten Marktwirtschaft? Das Werk stellt eine hochkarätige Analyse der Verwandlung der liberalen Demokratie in der pandemischen Krise dar und bietet Lösungsansätze für die ebenso vielfältigen wie grundlegenden Fragen.