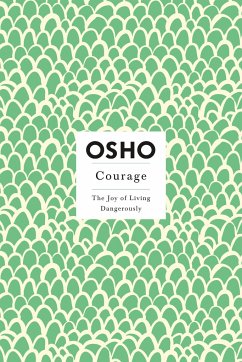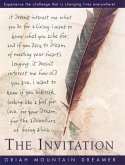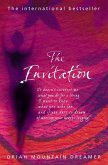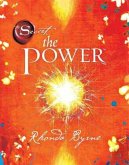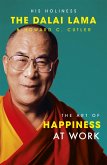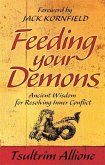Osho discusses where fears originate, how to understand them and how to find the courage to face them. The change in our lives that can cause fear is actually a cause for celebration. Rather than clinging to the familiar, we can learn to see new situations as opportunities for adventure.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Joris Ivens war ein Freund starker Kontraste und ließ in seinen Filmen linke Schimären fortleben
Über seinen weltweit gefeierten Sohn schrieb der Vater ein paar nüchterne Worte ins Tagebuch. "Er ist ein großes Kind und ein guter Bohemien. Sein Film über Spanien und seine Bekanntheit in Amerika machen ihn berühmt. Niemand glaubt, daß er nicht eine schreckliche Menge Geld verdient. Und niemand wird mir Geld leihen." Zu diesem Zeitpunkt war das große Kind achtundvierzig Jahre alt. Und klamm wie meistens.
Vielleicht geht es nicht anders. Vielleicht müssen große Regisseure Kinder bleiben, da nur ein staunender Blick große Filme erzeugt. Joris Ivens drehte seinen ersten mit dreizehn; Schokoladenpulver und Truthahnfedern machten aus seiner Nijmegener Familie Helden des Wilden Westens. Liest man die Jahreszahl dieses Homevideos, stellt sich der märchenhafte Schleier ein, der Ivens' Lebenslauf umgibt: 1911. Als man sich gerade so eben an den Anblick von Autos gewöhnt hatte, debütierte mit Ivens ein Mensch, der sein Jahrhundert auf Filmrollen bannen sollte. Er blieb dabei immer der Junge mit den Truthahnfedern: abenteuerlustig und aktiv, idealistisch und naiv, unfertig, unreif und liebenswert.
Wie jeder anständige Revolutionär entstammte er einer bürgerlichen Familie. Vater und Großvater waren Fotografen, Joris sollte ihre Nachfolge in der Firmenleitung antreten. Doch er war für das Geschäftsleben nicht geschaffen, spätestens seine Zeit im wildbewegten Berliner Nachtleben der zwanziger Jahre warf ihn aus den geregelten Bahnen. Der Sinn stand ihm nach Künstlerleben und Revolution. Seine Bewegungsstudie "Die Brücke" wurde warm aufgenommen, weitere Filme folgten, bald fand er sich in anderen Kreisen wieder, in kargen Wohnstätten, dreieckigen Beziehungskisten und in einem Land der Umwälzungen: der Sowjetunion. Die Furchtlosigkeit, mit der Ivens sich in immer neue Abenteuer stürzte, wäre in jedem Indianerfilm am Platz gewesen.
Ebenso die Schwarzweißmalerei. Die Jahre in der Sowjetunion sahen ihn als inbrünstig gläubigen Vorspuler der Revolution. Moskau erschien ihm "wie ein Märchen". In Magnitogorsk drehte er sein "Heldenlied" (1932) auf die Industrialisierung und bemerkte keine Zwangsarbeiter. Die offensichtlichsten Greueltaten des Regimes erklärte er zum notwendigen Übel, da eine klare Linie nötig sei. An Stalins Schauprozessen zweifelte er keinen Moment. Daß er nicht noch eines Schlimmeren belehrt wurde, war einem seiner schlafwandlerischen Seitenwechsel zu verdanken. Als der Terror richtig losbrach, als diverse Bekannte nach und nach ermordet wurden, war das große Kind auf einmal in Amerika.
Wie ein kosmopolitischer Forrest Gump lernte Ivens in den nächsten Jahrzehnten die Berühmten und Mächtigen des Planeten kennen, und alle hatten sie den Dokumentarfilmer gerne um sich. Mit Hemingway stürzte er sich in den spanischen Bürgerkrieg. Fritz Lang, Errol Flynn, Dashiell Hammett und Liz Taylor, um nur ein paar zu nennen, stützten seine Anliegen mit Spenden. Tschiang Kai-schek und Ho Tschi Minh empfingen ihn, Castro unterrichtete ihn aus erster Hand über die Revolution, Eleanor Roosevelt lobte ihn nach einem Abendessen in ihrer Zeitungskolumne - als hätte das FBI ihn nicht längst unter "gefährlicher Kommunist" verbucht. Und unerschütterlich drehte Ivens, was halt gerade anlag. Oft waren es kriegerische Auseinandersetzungen und der Aufbau des Sozialismus, zwischendurch aber konnte er Reklame für Philips machen oder für die Elektrifizierungskampagne in Amerika. Mit jugendlicher Gedankenlosigkeit flog er bald hier-, bald dorthin, wie im Märchen nahm man ihn überall auf, und wie im Märchen wurde Joris Ivens unendlich alt, damit seine Filme das gesamte Jahrhundert einfangen konnten. 1911 begonnen, endete seine Karriere in einer anderen Welt. 1989 brachte er "Eine Geschichte des Windes" zur Aufführung, es war sein letzter Film, ganz richtig starb er gleich danach, und ganz richtig trat er in seinem letzten Film selbst auf; ein alter Mann, ein altes Kind.
Ob er an ein Lebensende geglaubt hat, wissen wir nicht. Obwohl seine Gesundheit oft genug angeschlagen war, ließ sein Tatendrang nicht nach - der Tod schickte nur ab und zu Telegramme. Seine Familie starb ihm nach und nach weg, nie war Ivens auch nur im selben Land. Soziale Bande konnten ihn nicht halten. Auch seine großen Lieben ließ er regelmäßig wieder fallen, zuweilen lebte er schon anderswo mit der nächsten zusammen, wenn die vorige noch gar nichts ahnte.
Oft genug erschien die Realität dem Dokumentaristen ungeeignet. Das betrifft die politische Naivität und die Nonchalance, mit der ihn sein Geschwätz von gestern bald nicht mehr kümmerte. Doch auch vor den Kameras gab es Inszenierungen, die dem wahren Leben einiges an Ironie und Tragik beimengten. 1942 drehte er für die kanadische Marine einen Seekriegsfilm, der die Kaperung eines deutschen U-Bootes zeigte - in Ermangelung eines Originals malte man ein holländisches um. Im spanischen Bürgerkrieg dokumentierte Ivens die Bombardierung der Zivilbevölkerung - an anderen Tagen wurden die Kampfhandlungen unterbrochen, weil Freund und Feind für die Kamera posieren wollten. Auf Kuba wurde eine Rebellengruppe gleich zweimal überwältigt - beim ersten Durchgang war das Licht nicht so gut. Manchmal war das ganze Leben ein Cowboy-und-Indianer-Spiel.
Was ist von diesem Leben geblieben? Die Erinnerung an einen Mann, der das oft geächtete zwanzigste Jahrhundert gekannt und festgehalten hat. Ein Lebenswerk, das alles umfaßt vom poetischen Stummfilm über die Vietnam-Dokumentationen bis zur Berichterstattung von der DDR-Friedensfahrt - und das in aller Herren Ländern ausgezeichnet wurde. Neuerdings gibt es auch noch die sehr gründliche Biographie von Hans Schoots. Wer nicht begreifen mag, daß Joris Ivens existiert hat, kann sich hier vergewissern.
KLAUS UNGERER
Hans Schoots: "Living Dangerously". A Biography of Joris Ivens. Amsterdam University Press, Amsterdam 2000. 443 S., br., 18,50 brit. Pfund.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main