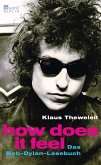Gareth Murphy schreibt eine Wirtschaftsgeschichte der Popmusik - und unterschätzt dabei die Rolle des Publikums.
Von Tobias Rüther
Und noch eine Geschichte der Popmusik. Diesmal aber eine, die sich für die Industrie interessiert, für die Pioniere, Entdecker und Abgreifer der Branche: In "Cowboys & Indies" schildert Gareth Murphy die anderthalb Jahrhunderte, seit 1860 in Paris das erste Lied mit einem Phonautographen aufgezeichnet wurde, als eine Ahnenreihe von record men, wie er sie nennt. Starke Figuren, die sich hinter ihre Künstler klemmten, dafür sorgten, dass deren Platten unter die Leute kamen, oder mit diesen Platten nur reich werden wollten. Um die Apparate und den Apparat geht es im Buch des Briten - nicht um aufgezeichnete Lieder wie jenes allererste, es war übrigens "Au clair de la lune".
Seit kurzem erscheinen ständig Popmusik-Geschichten - theoretische Grundlagenforschung wie von Diedrich Diederichsen ("Über Pop-Musik"), essayistische Fallstudien wie die von Karl Bruckmaier ("The Story of Pop") oder kulturwissenschaftlich angereicherte Universalgeschichte wie die des Popmusikers und Kritikers Bob Stanley ("Yeah Yeah Yeah"). Genauso melden sich neuerdings auch die Akteure selbst mit Autobiographien zu Wort: Keith Richards, Pete Townsend, Rod Stewart, Neil Young, Westbam, jetzt kamen noch die Memoiren von Chrissie Hynde und Elvis Costello dazu. Popmusik ist sich selbst historisch geworden. Was vielleicht daran liegt, dass ihre Liebhaber und Darsteller in ein Alter gekommen sind, wo man zurückschaut, sortiert, verklärt, verwirft, überhöht.
Leider ändert Gareth Murphys Wirtschaftsgeschichte aber nichts daran, dass diese neue historische Perspektive erst mal die auf sehr viele Männer und ein paar Frauen ist, die Geschichte gemacht haben: Édouard-Léon Scott de Martinville, der 1860 "Au clair de la lune" in seinen Phonautograph sang. Emile Berliner, der etwas später das "Gramophone" baute. Guglielmo Marconi und sein Radio, Thomas Edison und seine "Diamond Discs". Dann die Impresarios wie John Hammond, der aus dem amerikanischen Geldadel kam und vor dem Zweiten Weltkrieg Billie Holiday entdeckte und danach Aretha Franklin, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan, Leonard Cohen.
Murphy beschreibt, wie George Martin Mitte der Sechziger die EMI verließ, weil die ihn so mies bezahlte, obwohl die Beatles ohne Martin nicht die Beatles wären und die EMI ohne die Beatles nicht so reich - und wie Martin damit den Weg eröffnete für den Beruf des freien Produzenten. Murphy beschreibt auch reihenweise interessante Spinner und Tyrannen - wie Richard Branson (Virgin) und Chris Blackwell (Island Records) - und die Kokainwolke, die in den Siebzigern die Industrie einnebelte. Dann kam der Punk, dann kamen Independent-Giganten wie Daniel Miller (der auf seinem Label Mute Depeche Mode groß machte) oder Geoff Travis von Rough Trade, die Murphy als Vorbilder für anständiges Wirtschaften im Sinne der Kunst und der Künstler feiert.
Unterwegs hält er ein paar ewige Regeln der Musikindustrie fest: zum Beispiel, dass sich immer irgendwer über den Klang einer neuen Abspieltechnik beschwert hat, egal ob Schellack oder CD. Und dass diese Industrie regelmäßig katastrophale Einbrüche und Neuanfänge erlebt hat. Diese Katastrophen vergleicht Murphy mit Waldbränden, weil auch die dafür sorgten, dass im Boden Mineralien für zukünftiges Wachstum entstehen.
Fünfhundert Seiten Wirtschaftsgeschichte des Pops - aber das Publikum kommt so gut wie gar nicht vor. Seltsam, denn Murphy interessiert sich ja gerade für die Figuren, die heute schon wussten, was wir morgen hören wollen würden.
Diese record men immer wieder als "Schlitzohren" zu bezeichnen, die es halt draufhatten, ist einfach zu wenig. Murphy unterschätzt die Rolle des Publikums in diesem Geschäft - genau wie die Industrie es tat, bis es mal wieder zu spät war. Diedrich Diederichsen hat in seinem Standardwerk erklärt, man müsse, solle Popmusik sogar ohne ihre Erzeuger beschreiben, weil sie erst dort entsteht, wo sie gehört wird. Apple verdient mit dieser Erkenntnis viel Geld; als iPod ist sie zum Gerät geworden, jeder sein eigener Plattenmogul. Die verwöhnte, monomanische Musikindustrie aber, die Gareth Murphy in seinem Buch beschreibt, hat immer geglaubt, Macht über die Bedürfnisse des Publikums zu haben. Es ist umgekehrt.
Gareth Murphy: "Cowboys & Indies". Eine abenteuerliche Reise ins Herz der Musikindustrie.
Aus dem Englischen von Bernd Gockel. Edition Tiamat, Berlin 2015. 480 S., br., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Aus der Fülle pophistorischer Neuerscheinungen und Autobiografien greiser Stars schließt Tobias Rüther sicher nicht zu Unrecht, dass der Pop sich selbst historisch geworden sei. Immerhin: Murphy beleuchtet das Phänomen aus neuer Perspektive - der der Erfinder von Geräten wie dem Grammophon und der Produzenten und Labelgründer. Hier geht's um Wirtschaftsgeschichte. So erfährt man etwa, dass mit dem Abschied des Beatles-Produzenten George Martin von der EMI die Figur des freien Produzenten entstand, der für die Entwicklung des Genres so entscheidend ist. Eine Dimension des Pop aber, so Rüther, hat Murphy nicht berücksichtigt: das Publikum. Und damit, so der Rezensent weiter, hat der Autor den selben Fehler gemacht wie die Industrie selbst, die nie damit gerechnet hatte, dass sich die Konsumenten des Pop von ihr emanzipieren könnten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH