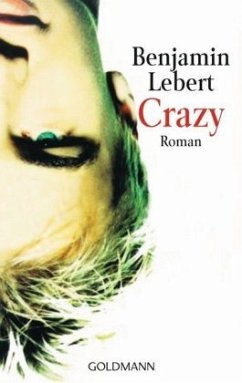In seinem autobiographischen Roman Crazy erzählt der sechzehnjährige Benjamin Lebert mit erstaunlicher Wärme, großem Witz und einer guten Portion Selbstironie von der Schwierigkeit des Erwachsenwerdens.
"Hallo Leute. Ich heiße Benjamin Lebert, bin sechzehn Jahre alt, und ich bin ein Krüppel. Nur damit ihr es wißt. Ich dachte, es wäre von beiderseitigem Interesse."
Mit diesen Worten stellt sich Benjamin Lebert an seinem ersten Schultag seinen neuen Mitschülern im Internat Schloss Neuseelen vor. Es ist sein fünfter Schulwechsel. Diesmal soll er endlich die 8. Klasse bestehen. Zusammen mit seinen fünf Freunden übersteht Benjamin die Zeit im Internat.
Bei allen Unternehmungen, bei nächtlichen Besuchen auf dem Mädchengang genauso wie bei heimlichen Ausflügen ins Dorf, beschäftigt sie fortwährend die Frage, worum es in dieser ganzen Veranstaltung namens Leben eigentlich geht: um Mädchen, um Sex, um Freundschaft und ums Erwachsenwerden oder vielleicht auf einfach nur darum, immer weiterzumachen, wie verrückt die Welt und wie "crazy" man selbst auch sein mag.
"Hallo Leute. Ich heiße Benjamin Lebert, bin sechzehn Jahre alt, und ich bin ein Krüppel. Nur damit ihr es wißt. Ich dachte, es wäre von beiderseitigem Interesse."
Mit diesen Worten stellt sich Benjamin Lebert an seinem ersten Schultag seinen neuen Mitschülern im Internat Schloss Neuseelen vor. Es ist sein fünfter Schulwechsel. Diesmal soll er endlich die 8. Klasse bestehen. Zusammen mit seinen fünf Freunden übersteht Benjamin die Zeit im Internat.
Bei allen Unternehmungen, bei nächtlichen Besuchen auf dem Mädchengang genauso wie bei heimlichen Ausflügen ins Dorf, beschäftigt sie fortwährend die Frage, worum es in dieser ganzen Veranstaltung namens Leben eigentlich geht: um Mädchen, um Sex, um Freundschaft und ums Erwachsenwerden oder vielleicht auf einfach nur darum, immer weiterzumachen, wie verrückt die Welt und wie "crazy" man selbst auch sein mag.

Zu Benjamin Leberts Debütroman "Crazy"
Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte mich, als ich vor zwei Jahren in einer Zeitschrift Auszüge aus seinem Tagebuch las, einfach nur still an seiner Begabung freuen sollen, an seiner dunklen, komischen, altklugen Art, mit der er von seinem seltsamen Teenagerleben erzählte. Ich hätte ihm unbedingt Zeit lassen sollen. Aber nein, ich mußte natürlich den großen Entdecker spielen und alle in meinem Verlag damit verrückt machen, daß es da ein echtes Wunderkind gibt, einen sechzehnjährigen Jung-Salinger, der garantiert längst von der Literatur träumt, so daß man ihn nur noch, bevor andere auf die Idee kommen, ganz schnell um einen Roman anhauen müßte.
Und genau das haben sie dann auch getan, und er hat diesen Roman auch geschrieben, und das tut mir nun wirklich sehr leid.
Natürlich ist Benjamin Lebert ein Wunderkind, daran hat sich nichts geändert. Natürlich kann er Dinge, von denen die meisten seiner erwachsenen Schriftstellerkollegen noch nicht einmal träumen, von denen sie gar nicht wissen, daß sie unter den Tasten und hinter den Bildschirmen ihrer Computer verborgen sind. Dieser verdammte kleine Supermann kann zum Beispiel die Schwärze eines nächtlichen Himmels so verzweifelt schön und traurig beschreiben, daß man denkt, es hätte noch nie ein anderer vor ihm getan, er weiß, daß Worte nicht immer nur dafür da sind, daß man sie hinschreibt, daß also eine gut gesetzte Pause, eine wie beiläufig entstandene Lücke eine ergreifende Szene überhaupt erst ergreifend macht, und daß er andererseits neben Henry Miller wohl der einzige Autor ist, bei dem so laute, grelle Worte wie "Fotze" oder "ficken" romantisch klingen, sagt ohnehin alles über sein fast unerreichbares poetisches Talent.
Und trotzdem. Und trotzdem hätte sein Roman "Crazy" niemals gedruckt werden dürfen, und bevor ich erkläre, wieso, sollte ich sagen, worum es darin eigentlich geht. Es ist zunächst einmal die Passionsgeschichte eines sehr aufgeregten, sehr niedergeschlagenen Sechzehnjährigen, dessen gerade erst beginnendes Leben bereits ein einziger Trümmerhaufen ist. Da wäre zum einen diese blöde halbseitige Lähmung, die er von Geburt an hat; er kann seinen linken Arm und sein linkes Bein kaum bewegen, sie sind fast taub und dafür aber um so empfindlicher für jede Art von Schmerz, was ja nun auch nicht wirklich ein Trost ist für ihn. Da wären seine scheißmodernen Eltern, die ihn wie verrückt lieben und trotzdem immer nur unglücklich machen, weil sie jedes Gefühl und jede Leidenschaft, die sie haben, egoistisch in ihr "Cosmopolitan"-Ehedrama investieren, so daß für ihn nur Kälte und Schweigen übrig bleiben sowie die Abschiebehaft für lästige Jugendliche, Internat genannt.
Und schließlich wäre da seine kaputte, verzweifelte, alles bestimmende Sehnsucht nach dem ersten Mal, nach nassen Mädchenmündern, nach weichen Brüsten und warmen Ärschen, eine Sehnsucht, die nichts mit der üblichen Geilheit pubertierender Dauerständer zu tun hat, sondern fast schon quasi-religiös daherkommt: Dieser traurige Junge erhofft sich vom Sex nämlich mehr als Sex, er denkt, wer in einer Frau kommt, kommt auch in den Himmel - oder zumindest hat er hinterher keine irdischen Sorgen mehr.
Ist das der Stoff für einen perfekten Wunderkind-Roman? Leider nicht ganz. Denn auch ein Wunderkind kann immer nur von seinem eigenen Leben erzähten, und weil dieses eigene Leben noch so jung, so frisch, so rätselhaft ist, kann das Wunderkind, bei all seiner schriftstellerischen Virtuosität, nichts anderes tun, als an diesem Leben viel zu nah dran zu bleiben, so nah eben wie ein Teenager, der faszisniert, erstaunt und erschrocken immer wieder ganz dicht an den Badezimmerspiegel heranrückt, um sich am Anblick seiner wild wuchernden Akne zu weiden.
Konkreter gesagt: Natürlich heißt Benjamin Leberts "Crazy"-Held Benjamin Lebert; und natürlich schlägt sich der echte Benjamin Lebert mit derselben elenden Behinderung herum wie der ausgedachte, natürlich verbrachte er ebenfalls das letzte Jahr in einem Internat, und ich bin mir sicher, daß er uns nichts, aber auch gar nichts von dem, was er dort erlebt, gedacht, gefühlt hat, verschweigt. Das ist oft ein Segen für sein Buch und auch für die deutsche Literatur, die er - Junggenie bleibt eben Junggenie - so um ein paar Bilder und Momente bereichert, die jetzt schon von absolutem Ewigkeitswert sind.
Unvergeßlich etwa die Szene, in der sich der "Crazy"-Benjamin mit seinen Freunden mitten in der Nacht zum Mädchentrakt des Internats durchschlägt, und das mit dem Durchschlagen meine ich genau so, denn ihre Angst, vom Lehrer erwischt zu werden, die Feuertreppe in zehn Meter Tiefe hinunterzustürzen oder am Ende vor den Mitschülerinnen nicht zu bestehen, befeuert sie mit demselben hysterischen Mut wie Soldaten, die in eine aussichtslose Schlacht ziehen. Ergreifend auch, wie Benjamin Lebert einfach nur das Zimmer von Troy beschreibt, von diesem Endlos-Sitzenbleiber, der nie ein Wort sagt und ein düsteres Geheimnis mit sich herumzutragen scheint: Da hängen an allen Wänden Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, auf denen man weinende Kinder, zerbombte Städte und die theatralisch verzogenen Fratzen von Goebbels und Hitler sieht, da liegen auf dem Fensterbrett ein paar ungelenk selbstgezeichnete Frauenakte herum, und dann ist da dieses Bett, genau in der Mitte des Raums, und die Decke ist mit dem riesigen feuerspeienden Drachen aus "Dragonerart" bedruckt, und das Laken darunter ist - Geheimnis gelöst! - das stinkende, fleckenübersäte Laken eines ewigen Bettnässers.
Einmaliger und unerreichter Höhepunkt des Romans ist aber die Stelle, als "es" endlich soweit ist, als Leberts Benjamin, ohne zu wissen, wie ihm geschieht, auf dem nassen, kalten Boden eines Waschraums von einer frühreifen Mitschülerin regelrecht genommen wird, und obwohl alles echt ist, ihre Brüste, ihr Hintern und das Kondom, das sie ihm überstreift, kann er es lange gar nicht glauben, fast genauso lang, wie das Ganze dauert, und dann ist es schon wieder vorbei, und er weiß nur noch: Seine Hoffnung auf ewige Erlösung hat sich nicht erfüllt.
Ja, das alles ist garantiert wahr und auch genauso passiert, und daß der große kleine Benjamin Lebert es uns - beflügelt von seiner jugendlichen Gabe zu staunen und seinem erwachsenen Sinn für die Poesie des Moments - auch genauso erzählt, ist nur gut. Schlecht ist jedoch, daß er ähnlich distanzlos und ungefiltert nicht nur von seinem Leben zu uns spricht, sondern auch darüber räsoniert.
Ganz genau: räsoniert. Anders kann man die endlosen, tödlich langweiligen, lesezermürbenden Passagen gar nicht charakterisieren, in denen Benjamin, der Ausgedachte, im Namen von Benjamin dem Echten, mit seinen Freunden darüber filibustert, warum sie als Teenager so sind wie sie sind, warum es Gott gibt und ob es ihn überhaupt interessiert.
Es sind Dialoge, in denen unentwegt die Rede ist von dem "Weg des Lebens" und davon, daß die "ganze Jugend ein einziges großes Fadensuchen" ist, aber daß diese Gespräche, die dem Roman immer wieder seitenweise seine Spannung und Schönheit rauben, bei all ihrer sonntagsphilosophischen Plattheit, noch etwas anderes signalisieren als pubertäre Larmoyanz und Klugscheißerei, hat fast schon wieder etwas und bringt mich zugleich sehr nah heran an die Antwort auf die Frage, warum ich nun plötzlich gegen die Veröffentlichung von Benjamin Leberts genialischem Erstling bin.
Wieso reden die Jungen in diesem Buch so viel und so manisch über sich selbst? Weil sonst keiner mit ihnen spricht. Weil sie, von ihren Familien vergessen, in der wichtigsten Phase ihres Lebens völlig alleingelassen sind, hinausgeschickt in die kalte Scheinselbständigkeit des Internats, und wenn sie dann, so wie Benjamin, deren Eltern zu Beginn des Schuljahres beim Abschied mit ein paar stillen Tränen bedeuten, daß dieses hier wirklich nicht das Richtige ist für sie, kriegen sie stumm eine "Rolling Stones"-CD zugesteckt mit irgendeinem dämlichen Rockhelden-Durchhaltetext drauf und einen Brief, in dem es kühl heißt: "Lieber Benni, ich weiß, Du machst eine schwierige Zeit durch. Und ich weiß auch, daß Du nun in vielen Dingen auf dich allein gestellt sein wirst. Aber denk bitte daran, es ist das Beste für Dich, und bleib tapfer! Papa."
Logisch: Wir alle sind einsam und verlassen in dieser kalten, stummen Welt. Aber unsere Kinder sind es - gerade heute - noch ein bißchen mehr als wir, egal, ob sie Hunderte von Kilometern von zu Hause entfernt in einem Internat viel zu früh viel zu klug und tapfer sein müssen, oder ob sie gezwungen sind, im Gymnasium um die Ecke oder einem Club ein paar Straßen weiter den starken Mann, das schlaue Girl zu markieren.
Das hat natürlich vor allem damit zu tun, daß Leistung und Sex längst nicht nur die zentralen Codeworte der Erwachsenenwelt sind, sie kursieren, gezielt in Umlauf gebracht, von dummen Kapitalisten und klugen "Viva"-Chefs, inzwischen genauso unter Kindern, sie fürchten sie und sie lieben sie, und sie sind von dem, was sie tatsächlich bedeuten, vollkommen überfordert. Daß aber ihre Eltern, die bereits selbst in dem Jugendwahn der modernen Popkultur groß geworden sind und dabei wiederum nichts anderes gelernt haben, als sich allein um die eigenen Sehnsüchte, Ängste und Liebesgefühle zu kümmern -, daß diese ewigen Egomanen und Berufsjugendlichen ihnen weder helfen wollen noch können, macht die Einsamkeit der Jugend beim überstürzten Erwachsenwerden erst recht zur Hölle.
Ist dies also in Wahrheit das verborgene zentrale Thema von Benjamin Leberts Roman? Ja, das ist es, aber es ist natürlich auch das zentrale Thema seines eigenen Lebens, und darum, wie gesagt, kann er es literarisch noch gar nicht wirklich bewältigen, er, das allmächtige Junggenie, das unwissende Kind, und darum erschlägt er am Ende die vielen schönen, wahrhaftigen Momente seiner Erzählung mit noch viel mehr pseudo-erwachsenem Existentialistengestammel, und darum wäre es besser gewesen, er hätte es geschrieben, aber nicht veröffentlicht.
Besser für ihn als Schriftsteller, klar - aber vor allem besser für ihn als Mensch. Denn der Talkshow- und Titelgeschichten-Wahnsinn, der nun über ihn, den bestaunenswerten Literatur-Mozart, hereinbrechen wird, wird ihm mehr als alles andere, was er bisher erlebt hat, zeigen, wie allein er in dieser Welt der egoistischen, profitversessenen, vergnügungssüchtigen Erwachsenen ist.
Ich weiß, ich habe damit angefangen. Entschuldige, Benjamin. MAXIM BILLER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main KTX: Am vergangenen Samstag (F.A.Z. vom 20. Februar) wurde an dieser Stelle der vorhersehbare und generalstabsmäßig organisierte Medienrummel um "Crazy", das in diesen Tagen erschienene Romandebüt des sechzehnjährigen Benjamin Lebert kritisiert. Heute dokumentieren wir die Selbstbezichtigung des Schriftstellers Maxim Biller. Er bezeichnet sich als "Entdecker" Leberts und schiebt sich damit gleichzeitig die Schuld an der totalen Vermarktung des Jungen zu. F.A.Z.
"So prägnant hat noch keiner das Drama Jugend auf den Punkt gebracht." (Christian Seidl im STERN)
"Es ist ein zärtliches, uneitles, ein ganz und gar erstaunliches und wunderbares Buch von einem hochtalentierten, sehr jungen Autor." (Elke Heidenreich im Spiegel)
"Dieser verdammte kleine Supermann kann zum Beispiel die Schwärze eines nächtlichen Himmels so verzweifelt schön und traurig beschreiben, daß man denkt, es hätte noch nie ein anderer vor ihm getan." (Maxim Biller in der FAZ)
"Es ist ein zärtliches, uneitles, ein ganz und gar erstaunliches und wunderbares Buch von einem hochtalentierten, sehr jungen Autor." (Elke Heidenreich im Spiegel)
"Dieser verdammte kleine Supermann kann zum Beispiel die Schwärze eines nächtlichen Himmels so verzweifelt schön und traurig beschreiben, daß man denkt, es hätte noch nie ein anderer vor ihm getan." (Maxim Biller in der FAZ)