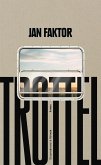Herr Harald ist der Mann in der Garderobe. Er gehört zum Theater wie der Vorhang, aber niemand kommt seinetwegen, das Rampenlicht ist für andere. Er nimmt den Menschen die Mäntel ab, die Taschen, was immer sie ihm anvertrauen, um für kurze Zeit unbeschwert zu sein, und wartet bis zum Schlussapplaus, das ist sein Einsatz. Doch eines Abends bleibt ein Mantel zurück, und in dem Mantel findet sich eine Pistole. Herr Harald trägt sie nach Hause, nur: Was will er damit tun? Er kann sich schlecht gegen alles zur Wehr setzen, was ihm an der Welt und den Mitmenschen als Zumutung erscheint. Aber vielleicht kann er ihre Aufmerksamkeit auf jemanden lenken, der wie er ein Schattendasein führt: die Frau, die für einen anderen die Noten umblättert und die er aus der Ferne verehrt.Der tragische wie komische Protagonist dieser hinreißend erzählten Geschichte ist ein Held des Alltags, ein Mann in Dienstkleidung, einer, dem es niemand dankt. Und gäbe es die Literatur nicht - und Autorinnen wie Dagmar Leupold -, wie sollten wir wissen, was für ein Reichtum an Gedanken und Gefühlen, wie viel waches Leben und wehe Sehnsucht sich dahinter verbirgt.

Dagmar Leupold macht einen Garderobier zum Helden ihres Roman "Dagegen die Elefanten!"
Wer diesen Roman gelesen hat, der wird in Zukunft nicht mehr achtlos am Garderobier im Opernhaus oder Konzertsaal vorbeigehen. Er wird hinschauen und sich fragen, wer dieser Mensch ist, was ihn bewegt. Das nämlich hat die Schriftstellerin Dagmar Leupold getan und damit den Blick für das fast Unsichtbare geschärft. In ihrem Roman "Dagegen die Elefanten!" hebt sie einen Mann, Herrn Harald, auf die große Bühne, die er niemals betreten hat. Er sitzt sein Leben lang in einem schwarzen Kittel und fein gebügelten weißen Hemd in der Operngarderobe, Balkon links, auf einem Schemel in der Ecke, trägt weiße Handschuhe wegen einer Schuppenflechte und ist flink zur Stelle, wenn Besucher ihre Mäntel und Jacken abgeben wollen.
Nun möchte man annehmen, der Roman führte uns ein Jahr lang in das Programm der Oper, gäbe musikalische Erlebnisse durch den Filter der geschlossenen Türen wieder, erzählte vom bunten Gemisch der Besucher und der noch schöner herausgeputzten Besucherinnen - aber keine dieser Erwartungen erfüllt die Autorin. Wir lernen mit Herrn Harald einen Menschen kennen, der nur auf sich selbst konzentriert ist; ob er eine Vorgeschichte hat, bleibt unbekannt, ob er die Musik liebt, weiß man nicht. Er ist hier und da und beobachtet von außen, sein Welttheater spielt sich in Selbstgesprächen im Kopf ab. Nur in seiner engen Ecke besitzt er ein persönliches Reich: Er hat ein kleines Radio, das leise eingeschaltet wird, wenn die Vorstellung begonnen hat, ein Italienisch-Lehrbuch liegt in der Schublade, um manchmal Vokabeln dieser Fremdsprache zu lernen, im Geiste führt Herr Harald manchmal ein Quiz mit sich selbst durch. Seine Gäste interessieren ihn nicht. Beflissen nimmt er Mäntel ab und gibt sie aus, für ein Gespräch bleibt keine Zeit. Warum führt uns Dagmar Leupold diese unscheinbare Person so intensiv vor?
Darin besteht das hohe Raffinement dieser Autorin, die mit ethnologischem Blick und feiner Ironie Sinnstiftung in der Sprache sucht. "Ich glaube an das erfundene Wort", lautet ihr poetisches Credo. Elf Monate lang begleitet sie den Garderobier durchs Jahr, und für jeden Monat notiert Herr Harald ein Schlüsselwort in sein Merkbuch: etwa "Zärtlichkeit", "Abenteuer", "verkrauten", "Mutti", "Keines Wegs" und zum Schluss "Gesundheit". Ein tieferer Sinn lässt sich aus diesen Codes nicht ableiten. Soll der Leser doch selbst seine Phantasie schweifen lassen.
Herr Harald pflegt seinen Alltag, alles ist ganz gewöhnlich: Waschsalon, Bibliothek, Supermarkt, Fernsehen, Spaziergänge. Drei winzige Höhepunkte ereignen sich dennoch. Eines Tages bleibt ein Mantel in der Garderobe hängen, wird nicht abgeholt, Harald nimmt ihn an sich und entdeckt in der Manteltasche eine Schreckschusspistole. Die packt er zu Hause in den Römertopf und verstaut diesen in seinem Backofen. Bei einem Klavierkonzert verliebt er sich in die ins Dunkel gehüllte Notenumblätterin, tauft sie Johanna oder Marie, begegnet ihr auch in der Garderobe, sie hat fohlenbraunes Haar, aber er wagt es nicht, mehr als wenige Worte und ein kurzes Lächeln mit ihr zu wechseln. Und schließlich taucht eines Tages vor seiner Wohnungstür eine Katze auf, betritt stolz und keck sein Domizil und wird von ihm aufgenommen. Nanu nennt Herr Harald diesen Überraschungsgast und lässt ihn selbstverständlich bei sich gewähren.
Es ist eine hohe Kunst, aus fast nichts einen Roman zu komponieren, der aus Kleinigkeiten, Momentaufnahmen und Kopfgeburten ein Lebensgespinst flicht, weil die Sprache elegant und abgründig Welten schafft, die im Diesseits und Jenseits liegen. Dagmar Leupold hat mit ihrer Prosa immer wieder überrascht. Sei es der Roman über die Lebensgeschichte ihres Vaters ("Nach den Kriegen - Roman eines Lebens", 2004) oder "Helligkeit der Nacht" (2009), ein imaginiertes Zwiegespräch zwischen dem Selbstmörder Heinrich von Kleist und der Selbstmörderin Ulrike Meinhof. Immer findet Leupold einen neuen, ungewöhnlichen Ton, der aufhorchen lässt. Sei es komisch, sei es tragisch, mal ironisch, mal bitterernst. Die Autorin spielt auf einer reichhaltigen Klaviatur, die manchmal auch verstörend wirkt, aber das lässt sie unbeirrt. Schon in ihrer siebzehnjährigen Tätigkeit als Dozentin am Studio für Literatur und Theater an der Tübinger Universität, zugelassen für alle Fakultäten, hatte die in München lebende Schriftstellerin ein überzeugendes Konzept von "Sprachlichkeit und Schriftlichkeit" entwickelt. Ihren Kollegen Ingo Schulze, der auch einmal dort zu Gast war, begeisterte diese offene Form des Umgangs mit Literatur, Sprache und Wirklichkeit. Die Zusammenarbeit des Studios mit der Universität Tübingen endete jedoch 2021 im Unfrieden. Schulze protestierte damals im "Schwäbischen Tagblatt": "Wer heute das Studio für Literatur und Theater abschaffen will, begeht einen Frevel."
Dagmar Leupold hat sich nicht einschüchtern lassen. Ihr neuer Roman ist weiteres Zeugnis einer subtilen Sprachkunst, die aus einem scheinbar blinden Stein Funken zu schlagen vermag. Dafür braucht es keine Aufgeregtheiten und Sensationen, keinen thrilling Effekt, dafür braucht es einen feinfühligen, unkonventionellen und aufmerksamen Umgang mit der Sprache. LERKE VON SAALFELD
Dagmar Leupold: "Dagegen die Elefanten!". Roman.
Verlag Jung und Jung, Salzburg 2022. 266 S., geb., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Für Christoph Schröder ist Dagmar Leupold "zarte" Lektüre in trostlosen Zeiten. Wie Leupold sich in diesem Buch einem gesellschaftlichen Außenseiter widmet, seinen Schrullen und seiner Perspektive auf den Alltag, findet Schröder goldig. Ob Harald, so der Name des Helden, in seiner Stammkneipe sitzt oder seiner Arbeit an der Garderobe eines Opernhauses nachgeht, Leupold ist nah dran, beobachtet die Figur durchs Jahr und zollt ihr mit ihrer Sprache Respekt, findet Schröder. Eine Liebesgeschichte, eine zarte, was sonst, bietet das Buch auch, meint der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH