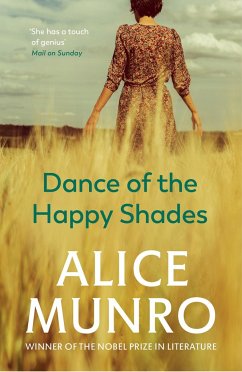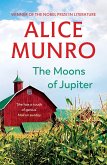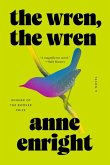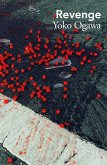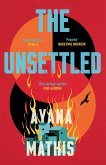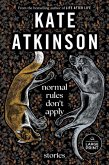**Winner of the Nobel Prize in Literature** Winner of the Man Booker International Prize for 2009, Alice Munro is the author of eleven collections of stories, most recently The View from Castle Rock, and a novel, Lives of Girls and Women. She has received many awards and prizes, including three of Canada's Governor General's Literary Awards and two Giller Prizes, the Rea Award for the Short Story, the Lannan Literary Award, the W.H. Smith Book Award in the UK, the National Book Critics Circle Award in the US, and was shortlisted for the Booker Prize for The Beggar Maid. Her stories have appeared in The New Yorker, Atlantic Monthly, The Paris Review, and other publications, and her collections have been translated into thirteen languages. She lives with her husband in Clinton, Ontario, near Lake Huron in Canada.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ihre Kurzgeschichten sind wie ein überstürztes, pubertäres Rendezvous: Jetzt liegt das Debüt der kanadischen Meistererzählerin Alice Munro in subtiler Übersetzung auf Deutsch vor.
Eine verschlafene Kleinstadt am See, wo sich das Leben nur zur Sommersaison auf der Promenade einstellt; ein verlassenes Café, wo sich die Aushilfskellnerin mehr für ihre Nagelpflege als für etwaige Gäste interessiert; zwei Halbwüchsige aus der Kreisstadt, erlebnishungrig und gefühlsgierig, die auf der Suche nach der passenden Gesellschaft für den Abend sind: das ist so eine typische Versuchsanordnung, mit der Alice Munro zu Werke geht. Viel braucht diese kanadische Erzählerin von Weltrang nicht, damit sich Spannung in ihren Geschichten aufbaut: keine große Bühne, kein heldenhaftes Personal, erst recht kein welterschütterndes Ereignis, das uns durch Schicksalhaftes aufwühlt oder packt.
Ihr reichen Alltagsillusionen, Sehnsüchte und karge Existenzen, um immer wieder unerbittlich zu erkunden, wie eine Welt zum Einsturz kommt und wer sich wohl am besten in den Trümmern einrichtet. Oftmals ist es genau das Randständige, von dem sie uns erzählt, das umso stärker wirkt, sobald wir erst bemerken, dass jenseits dieses Randes nichts als Ungewissheit existiert. Wer erst ins Rutschen kommt, kann sich an nichts mehr klammern.
Den zugereisten Halbstarken zum Beispiel gelingt es schließlich, zwei Freundinnen ins Auto zu bekommen. Doch irgendwie verläuft die Sache nicht nach Plan: "Ein Mädchen lag in meinem Arm, verächtlich, gefügig, wütend, stumm und unerreichbar. Ich wollte lieber mit ihr reden, als sie zu berühren, aber das kam nicht in Frage; Reden war für sie nicht eine solche Kleinigkeit wie Berühren." Also besorgt man sich eine Flasche starken Fusel, man trinkt und fährt und schläft zusammen. Und als der Abend plötzlich endet, fragt man sich verwundert, wer wen benutzt und wer wem etwas vorgemacht hat.
Auf einmal nämlich redet dieses Mädchen doch noch: "Thanks for the Ride", ruft sie den Jungs im Auto hinterher. "Danke für die Schlittenfahrt" übersetzt Heidi Zerning diesen Schlusssatz, zugleich Titel der Geschichte, treffend. Denn wenn Worte größere Intimität als sinnliche Berührung haben sollen, kommt es auf deren Doppelsinn genauestens an. Das Abenteuer der Verführung kehrt sich um. Zu spät erkennt hier der verstörte männliche Erzähler, wie ihm die Überlegenheit genommen wurde.
Solche Desillusionierungen sind seit langem Markenzeichen der modernen Kurzgeschichte. Auf knappem Raum von vielleicht zwanzig oder dreißig Seiten, die kaum Gelegenheit zu langer psychologischer Entwicklung bieten, pointiert sich alles ganz im Momentanen eines plötzlichen Erkennens, einer Erfahrung der Enttäuschung, des Zerbrechens lang vertrauter Illusionen oder manchmal auch des kurzen Glücks. Die klassische Form der Kurzgeschichte hat deshalb selbst etwas von einem überstürzten, pubertären Rendezvous: zum allmählichen Kennenlernen, Annähern, Warmwerden und Reden miteinander bleibt hier kaum Zeit - sie muss schon zielstrebig zur Sache gehen, den Figuren schnell zu Leibe rücken und uns ohne langes Vorspiel mit ihnen intim werden lassen, bevor diese Gelegenheit gleich auch schon wieder endet. In ihren besten Ausprägungen allerdings gewinnt die Form bei Munro daraus ihre wahre Größe. Wenn ein Roman die Wirklichkeit vereinnahmt und umarmen will, dann lässt Munro ihr mit diesen Geschichten die Distanz: gefügig, stumm und unerreichbar ist ihnen die moderne Lebenswelt - sie bleibt ein Rätsel und bleibt eben dadurch spannend.
"Tanz der seligen Geister" ist der Band, mit dem die damals siebenunddreißigjährige Autorin 1968 in Toronto debütierte. Die fünfzehn Erzählungen darin entstanden in den Jahren ihrer ersten Ehe, als sie drei Kinder großzuziehen, einen Haushalt zu versorgen und eine ordentliche Mittelklasseexistenz zu führen hatte. Wie sie einmal bemerkte, blieb ihr darum jeden Tag nur sehr wenig Zeit zum Schreiben, weshalb sie sich angeblich auf die Kurzgeschichte, die überschaubar schien, verlegte. Im Debütband, der jetzt endlich auf Deutsch vorliegt, mögen solche Zwänge durchaus spürbar sein; manches darin wirkt ein wenig absehbar und zuweilen etwas vorschnell auf die Schlusspointe hingeschrieben. Das Erstaunliche ist aber, wie oft uns diese alten Texte überraschen und ergreifen und - zumal in Zernings subtiler Übersetzung - neu bewegen.
Längst gilt Munro neben Margret Atwood als bedeutendste Autorin Kanadas, ist vielfach preisgekrönt und mit mehr als einem Dutzend Bänden großartiger Erzählungen hervorgetreten. Wenn wir jetzt ihren Anfängen erneut begegnen, zeigt sich schon viel von dieser Meisterschaft. Die Geschichten spielen meist im Kleinbürgermilieu der kanadischen Provinz, um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts, fernab der Großstädte, fern auch der Zentren, wo die Standards von Kultur vermutet werden. Und dennoch rückt uns diese Welt sehr nah, wenn wir in ihr das Unstete, das Ungewisse einer Existenz erkennen, die ständig vor dem Einbruch steht und manchmal daraus ihre Freiheit neu gewinnt.
In der Titelgeschichte wird die Ballettmusik von Gluck, unerwartet dargeboten auf dem Sommerfest einer Klavierlehrerin, für einen flüchtigen Moment zum Zeichen einer solchen wunderbaren Wendung: Alle hören dem Musikstück gebannt zu, "als seien sie an etwas erinnert worden, von dem sie vergessen hatten, dass sie es vergessen hatten". Solche Wunder vollbringt auch das Erzählen. Alice Munro erinnert uns daran.
TOBIAS DÖRING
Alice Munro: "Tanz der seligen Geister". Erzählungen. Aus dem Englischen von Heidi Zerning. Dörlemann Verlag, Zürich 2010. 384 S., geb., 23,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main