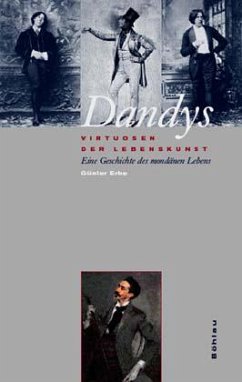In unserer glitzernden Medienwelt, in der Schein mehr gilt als Sein, kommen die Attitüden des Dandys, die früher nur in exklusiven Kreisen Resonanz fanden, wieder in Mode. Der Dandy, der modebewusste Beau, in der Regel ein Aristokrat und Müßiggänger, beherrschte zu Anfang des 19. Jahrhunderts die elegante Männerwelt und erlebte im Fin de siecle eine Renaissance. Welche Faszination ging von ihm aus? Von der Regency-Epoche über die Ära des Bürgerkönigs Louis Philippe, die Belle epoque, bis zu seinen letzten Ausläufern im 20. Jahrhundert wird dieser Gesellschaftstypus in europäischem Maßstab dargestellt. Im Typ des Dandys durchdringen Mode-, Gesellschafts- und Literaturgeschichte einander auf spannende Weise. Zugleich bietet das Buch auch eine Geschichte der mondänen Gesellschaft der europäischen Metropolen, in der prominente Dandys wie George Brummell, Lord Byron, Benjamin Disra li, Charles Baudelaire oder Oscar Wilde zu Wort kommen. Memoiren, Briefe, Tagebücher von Zeitzeugen, B iografien, Reiseliteratur, Anstandsbücher und Traktate, sittengeschichtliche Darstellungen, Artikel der Modepublizistik, Modekupfer und Karikaturen sowie Werke der schönen Literatur sind die reichhaltigen Quellen, auf die sich Günter Erbe in seiner Untersuchung stützt.

Trivialität ist zu bekämpfen: Günter Erbe führt den Dandy ins Feld
Aristokratische Lebensentwürfe gab es seit der Antike. Die "Nikomachische Ethik" war nicht das Werk eines Einsiedlers, der Autor gehörte vielmehr zur Oberschicht der führenden kulturellen Metropole am Mittelmeer. Aristoteles beobachtete die gehobene Gesellschaft von Athen, um über die Kunst des Lebens nachzudenken. Er redete nicht dem Dünkel das Wort, sondern schälte den zivilisatorischen Kern der vornehmen Lebensführung heraus. Es gelte, die Affekte, Begierde also und Zorn, zu meistern. Man müsse die Mitte, das Maß finden, freigiebig und hochherzig, witzig und gewandt sein. Ebenso lehrte in der frühen Neuzeit Michel de Montaigne in seinen "Essais" die Selbstbeherrschung, die Mäßigung und die Weltläufigkeit. Am Hof von Versailles entfalteten sich die Elemente der monde, der großen Welt. Norbert Elias zählt dazu in seiner "Höfischen Gesellschaft" die reiche Durchbildung des Geschmacks, gutes Aussehen und Benehmen, Eleganz und Esprit. Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts wurde die aristokratische Lebensweise brüchig. Spätestens seit der Revolution von 1789 verbanden sich adelige und bürgerliche Kreise. Den Ton gab nicht mehr der König an, sondern der König der Moden: der Dandy.
Die Gewohnheiten der guten Gesellschaft, Müßiggang und Verfeinerung, hebt Günter Erbe hervor, standen in der öffentlichen Kritik. Je mehr sich jedoch der Adel mit dem Bürgertum verschränkte, desto mehr übernahm das Zweckmäßige die Vormundschaft über die Eleganz. Das Spielerische der Lebewelt drohte vom Ernst des Berufslebens vereinnahmt zu werden. Dem Dandy war die Brüchigkeit der high society bewußt, und so spitzte er die Elemente des vornehmen Lebens zu, um den Vorrang des Ästhetischen noch einmal zu behaupten. Er steigerte die Selbstkontrolle und das Spiel mit der Maske, suchte in der Mode nach Originalität innerhalb des Schicklichen, entwickelte im Gespräch eine Schlagfertigkeit und Impertinenz, die das Erlaubte gerade noch achtete. Da sich die gehobene Gesellschaft öffnete, konnte der Dandy sowohl Aristokrat als auch Bürger sein; er stabilisierte den Kreis der oberen Zehntausend und zersetzte ihn zugleich - denn ein Teil der Dandys war eben von bürgerlicher Herkunft, und alle Dandys gemeinsam trieben die Konventionen des high life zum Äußersten.
Weil in England die Grenzen zwischen Hochadel, Landadel und Bürgertum schon im achtzehnten Jahrhundert fließend waren, wurde dort die Herrenmode ab etwa 1760 von der ländlichen Gentry beeinflußt. Der bestickte höfische Gehrock aus Samt und Seide wich einem einfachen, zugeknöpften Gehrock aus Wolle, der für das vornehme Landleben bequemer erschien. Auch die Schöße wurden zurückgeschnitten, um beim Reiten mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Die Kniebundhose ersetzte man durch eine lange Hose, und es entstand der moderne Anzug für den Mann. Hatte der höfische Gehrock unmittelbar den hohen sozialen Rang des Trägers zu erkennen gegeben, so trugen um 1800 Aristokrat wie Bürger dieselbe städtische Zivilkleidung. Der Gentleman konnte sich jetzt nur noch dadurch auszeichnen, daß sein Anzug einen besonders guten Schnitt hatte und die Accessoires wie Krawatte, Manschettenknöpfe und Hut fein auf die ganze Erscheinung abgestimmt waren. Der Dandy versuchte, das Musterbild des modernen Gentleman zu sein.
Aus den Londoner Kaffeehäusern waren exquisite Klubs hervorgegangen, die die Bühne für den Dandy bildeten. Zu den ersten bedeutenden neuen Modehelden zählte der Prinz von Wales, der spätere König Georg IV. Doch als der wahre König der Dandys wurde ein blutjunger bürgerlicher Emporkömmling anerkannt: George Bryan Brummell. Er war der Sohn des Privatsekretärs von Premierminister Lord North und Enkel eines Dienstboten, hatte jedoch eine elitäre Ausbildung genossen: Schulzeit in Eton, Studium am Oriel College in Oxford und Kornett im Zehnten Husarenregiment, das vom Prinzen von Wales befehligt wurde.
Als Brummell 1799 ein Kapital von dreißigtausend Pfund geerbt hatte, verließ er mit einundzwanzig Jahren das Militär, bezog im Londoner West End eine Wohnung und beschloß, fortan nichts anderes zu tun, als sich selbst zum Kunstwerk zu machen. Er besaß ein natürliches Talent für die Fragen des Stils, befreite die Kleidung des Landedelmanns vom Pferdegeruch und verlieh seinem Auftreten eine raffinierte Einfachheit. Die besten Schneider, Schuh- und Hutmacher von London gewährten ihm vorläufig unbegrenzten Kredit, da er ihnen laufend neue Kunden zuführte, die gekleidet sein wollten wie er. Selbst als ihm der Prinz von Wales die Gunst entzog, weil Brummell über den zunehmenden Leibesumfang des Thronfolgers spottete, verlor er nicht die Fassung. Als ihn der Prinz auf einem Ball demonstrativ schnitt, sagte der Parvenü mit lauter Stimme zu Lord Alvanley: "Wer ist eigentlich dein dicker Freund?" 1816 war Brummell bankrott; er mußte nach Frankreich fliehen und sich einschränken, doch er bewahrte die Haltung.
Günter Erbe verknüpft geschickt geschichtliche Linien mit biographischen Porträts und zeigt immer wieder neue Facetten des Dandytums. Lord Byron gefiel sich nicht nur als Mann von Welt, er kultivierte daneben auch ein geistiges Dandytum. Angesichts der geschäftigen, modernen Gesellschaft schlüpfte er in die Rolle des zivilisationsmüden, verzweifelten Romantikers. Er verzichtete auf die Krawatte und trug das Hemd offen, um seine Ungebundenheit zur Schau zu stellen, oder er wählte orientalische Kostüme, um seine Sehnsucht nach Abenteuern zu bezeugen. Mit seiner Art des Dandytums wurde in Paris ein wahrer Kult getrieben. Die französischen Lebemänner und Bohemiens kehrten den Salons den Rücken und flanierten auf den Boulevards mit ihren fashionablen Cafés und Restaurants. Die Künstler-Dandys ließen das Haar bis zur Schulter wachsen, trugen breitkrempige Hüte und schwarze Gehröcke aus Samt. Für Baudelaire waren die Dandys heroische Protestfiguren: "Alle sind Vertreter dessen, was das Beste am menschlichen Stolz ist, des bei den Heutigen allzu seltenen Bedürfnisses, die Trivialität zu bekämpfen."
Für Erbe sind die Dandys eine historische Erscheinung. Sie gingen aus der Verschränkung zwischen Adel und Bürgertum hervor, wie sie von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg stilprägend war. Danach begann die moderne Massengesellschaft, die dem Bonvivant den Resonanzboden entzog. Heute sind Filmschauspieler, Popmusiker oder Sportgrößen die Modehelden. Der Autor bekundet für den Gegenstand seiner Untersuchung eine unaufdringliche Sympathie. Er behandelt den Dandy mit jener spielerischen Leichtigkeit, die ihm entspricht. So ist ein Stück unterhaltsame, aufschlußreiche Kulturgeschichte entstanden. Es zeigt sich, daß das Dandytum keine bloße Laune war, sondern aus einem besonderen geschichtlichen Moment erwuchs und einen zivilisatorischen Kern besaß. Anleihen sind noch möglich.
ERWIN SEITZ
Günter Erbe: "Dandys". Virtuosen der Lebenskunst. Eine Geschichte des mondänen Lebens. Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 2002. 346 S., Abb., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Wirkliche Dandys gibt es nicht mehr, bedauert Erwin Seitz, denn sie seien aus einer bestimmten historischen Epoche hervorgegangen, als sich Lebensweisen des Bürgertums und Adels immer mehr verschränkten. Diese Epoche war spätestens mit dem 1. Weltkrieg vorbei. Aber es gibt Hoffnung, denn es gibt noch Autoren, die von diesen stil- und geistvollen Lebemännern berichten und dabei den richtigen Ton anzuschlagen wissen, freut sich Seitz. Je mehr sich das Bürgertum mit dem Adel vermischte, bemerkt Seitz, um so mehr bekam das Zweckmäßige Vorrang vor der Eleganz. Dies ist - historisch gesehen - der Moment für den Auftritt des Dandys, erläutert er, der die Brüchigkeit der mondänen Adelswelt erkannt und zugespitzt habe. Geschickt verknüpfe der Autor biografische Porträts berühmter Dandys wie George Bryan Brummell mit geschichtlichen Linien, so dass eine lebendige Kulturgeschichte mondäner Lebensentwürfe entstanden sei, die ihren Gegenstand mit jener "spielerischen Leichtigkeit" behandele, die ihm angemessen ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH