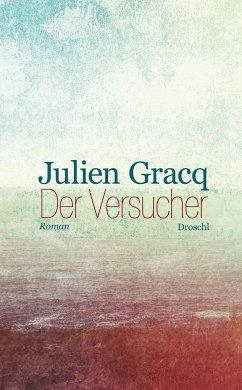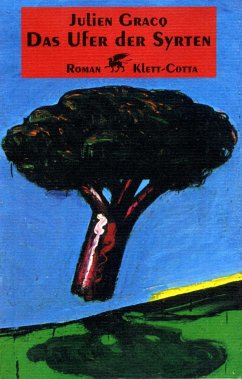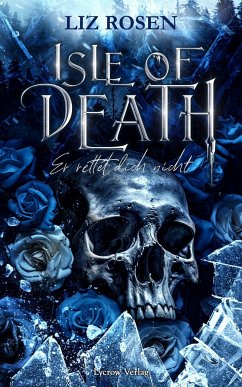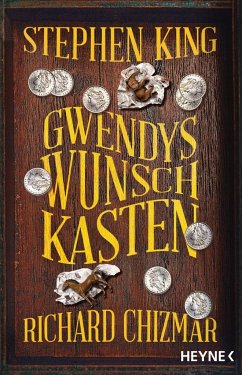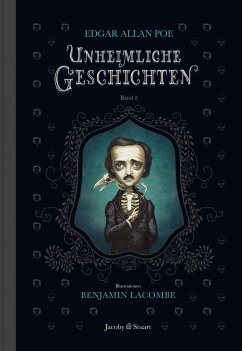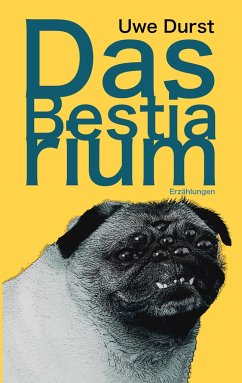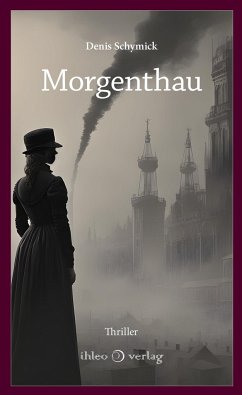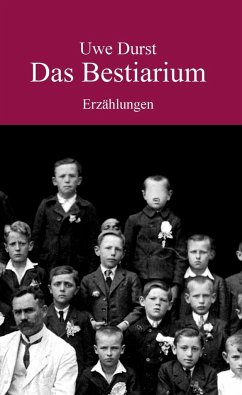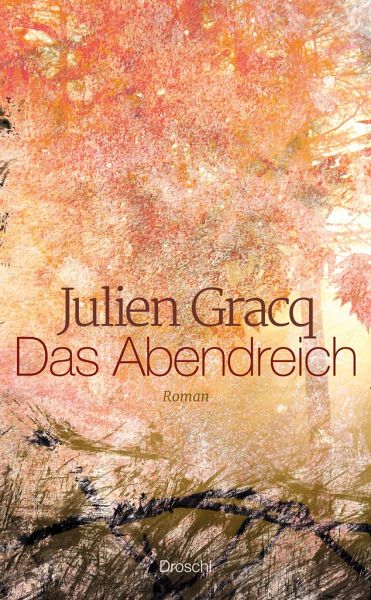
Das Abendreich
Versandkostenfrei!
Versandfertig in ca. 2 Wochen
23,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das Reich ist bedroht: Von Osten her nähern sich Feinde, barbarische Horden, die auf alle diplomatischen Interventionen nur mit der Enthauptung der Botschafter reagieren. Der Erzähler bricht mit einigen Freunden aus der selbstgewissen Lethargie der kulturmüden Hauptstadt auf und begibt sich in die Grenzregion, wo eine Entscheidungsschlacht bevorsteht.Gracqs Roman "Das Abendreich" aus den frühen 50er Jahren, nie zur Veröffentlichung freigegeben, ist nicht minder eindringlich als seine großen Romane dieser Zeit, "Das Ufer der Syrten" und "Der Balkon im Walde". Seine unerhört eindringliche...
Das Reich ist bedroht: Von Osten her nähern sich Feinde, barbarische Horden, die auf alle diplomatischen Interventionen nur mit der Enthauptung der Botschafter reagieren. Der Erzähler bricht mit einigen Freunden aus der selbstgewissen Lethargie der kulturmüden Hauptstadt auf und begibt sich in die Grenzregion, wo eine Entscheidungsschlacht bevorsteht.
Gracqs Roman "Das Abendreich" aus den frühen 50er Jahren, nie zur Veröffentlichung freigegeben, ist nicht minder eindringlich als seine großen Romane dieser Zeit, "Das Ufer der Syrten" und "Der Balkon im Walde". Seine unerhört eindringliche Prosa taucht die Personen, die Landschaften, die Handlung des Romans in beinahe surrealistisches Licht, gleichzeitig ist "Das Abendreich" auch eine Art Vorläufer der phantastischen Reiche und mythischen Endkämpfe in Tolkiens Epos "Herr der Ringe". Während "das Abendreich" zerfällt, erweisen sich die Phänomene der sichtbaren Welt - die Natur, das Licht, die Wege und die Jahreszeiten - als die eigentlichen Akteure. Die Mythen der europäischen Romantik werden mit denen des phantastischen Romans verschmolzen, in einer Stilistik, die ihresgleichen sucht, da für Gracq der Roman weder ein Mittel der Erkenntnis, noch der Aufklärung ist, sondern eine neue und extreme Erfahrung darstellen muss.
Gracqs Roman "Das Abendreich" aus den frühen 50er Jahren, nie zur Veröffentlichung freigegeben, ist nicht minder eindringlich als seine großen Romane dieser Zeit, "Das Ufer der Syrten" und "Der Balkon im Walde". Seine unerhört eindringliche Prosa taucht die Personen, die Landschaften, die Handlung des Romans in beinahe surrealistisches Licht, gleichzeitig ist "Das Abendreich" auch eine Art Vorläufer der phantastischen Reiche und mythischen Endkämpfe in Tolkiens Epos "Herr der Ringe". Während "das Abendreich" zerfällt, erweisen sich die Phänomene der sichtbaren Welt - die Natur, das Licht, die Wege und die Jahreszeiten - als die eigentlichen Akteure. Die Mythen der europäischen Romantik werden mit denen des phantastischen Romans verschmolzen, in einer Stilistik, die ihresgleichen sucht, da für Gracq der Roman weder ein Mittel der Erkenntnis, noch der Aufklärung ist, sondern eine neue und extreme Erfahrung darstellen muss.