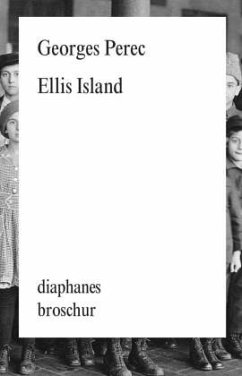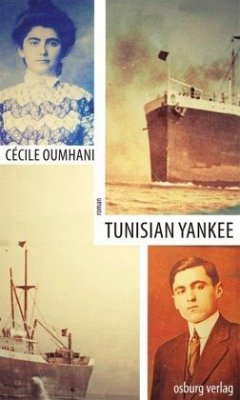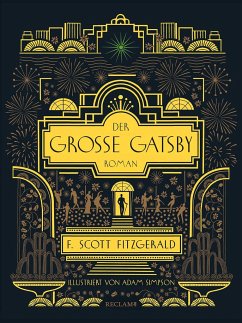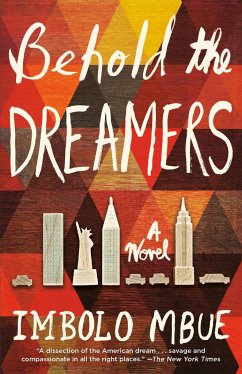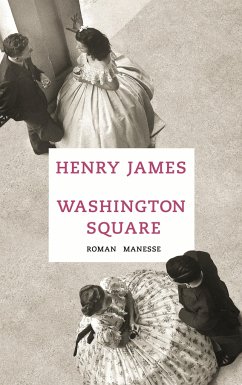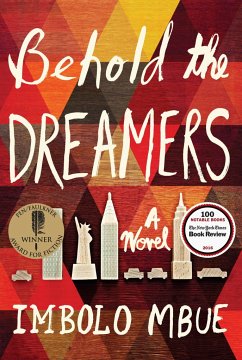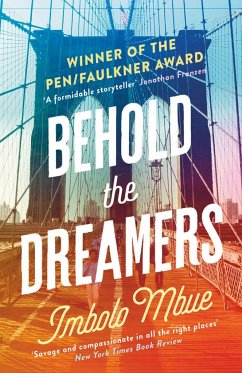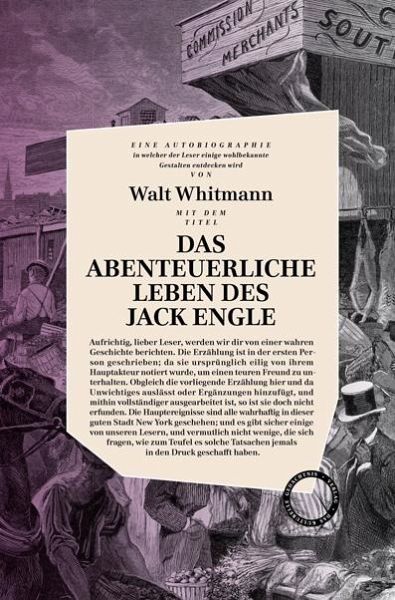
Das abenteuerliche Leben des Jack Engle
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
12,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
"Eine Weltsensation zur rechten Zeit."Wieland Freund in der Literarischen Welt"Seltsam, dass die erste literarische Entdeckung der Trump-Ära ausgerechnet einen New-York-Roman von Walt Whitman ans Licht zieht. Eine Übersetzung wäre dem deutschen Publikum zu wünschen."Lothar Müller in der Süddeutschen Zeitung
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.