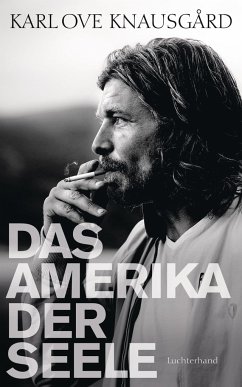Essays von Karl Ove Knausgård
Warum schreiben, warum malen, warum fotografieren? Warum lesen, warum Gemälde betrachten, warum in Galerien gehen? Kann es dabei um etwas anderes gehen als um die großen Fragen des Lebens? Und was hat diese Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Leben zu tun?
Das Amerika der Seele ist eine Sammlung von Texten, die einen weiten Bogen spannen: von der Gnade, die darin liegen kann, der Beerdigung des eigenen Vaters beizuwohnen, bis zur Bedeutung der Einsamkeit in den Bildern der US-amerikanischen Fotokünstlerin Francesca Woodman. Vom Massaker auf Utøya bis zu Knut Hamsuns missglücktem Meisterwerk »Mysterien«.
Warum schreiben, warum malen, warum fotografieren? Warum lesen, warum Gemälde betrachten, warum in Galerien gehen? Kann es dabei um etwas anderes gehen als um die großen Fragen des Lebens? Und was hat diese Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Leben zu tun?
Das Amerika der Seele ist eine Sammlung von Texten, die einen weiten Bogen spannen: von der Gnade, die darin liegen kann, der Beerdigung des eigenen Vaters beizuwohnen, bis zur Bedeutung der Einsamkeit in den Bildern der US-amerikanischen Fotokünstlerin Francesca Woodman. Vom Massaker auf Utøya bis zu Knut Hamsuns missglücktem Meisterwerk »Mysterien«.
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Peter Praschl erfährt aus den Essays Karl Ove Knausgards, wie der Mann denkt, wenn er nicht erzählt. Er trifft auf Argumente und Außenwelt, auf die Gedanken des Autor zu den Fotos von Cindy Sherman, zu Hamsuns "Mysterien", zu Breivik oder zu Wolken, und staunt über die Fähigkeit des Autors zur Abstraktion. Vor allem ab Seite 203, wo sich Knausgard ausführlich über die Empfindung des Scheißenmüssens und seine Beziehung zum Tod auslässt, und der Rezensent, dem jetzt nichts erspart bleibt, feststellt, wie weit das Vermögen des Autors, Individualität in Allgemeines zu überführen, tatsächlich reicht. Allein diesen Text findet Praschl furios. Wen das Thema nicht so interessiert, meint er, der kann sich ja immer noch mit den siebzehn anderen Essays beschäftigen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH